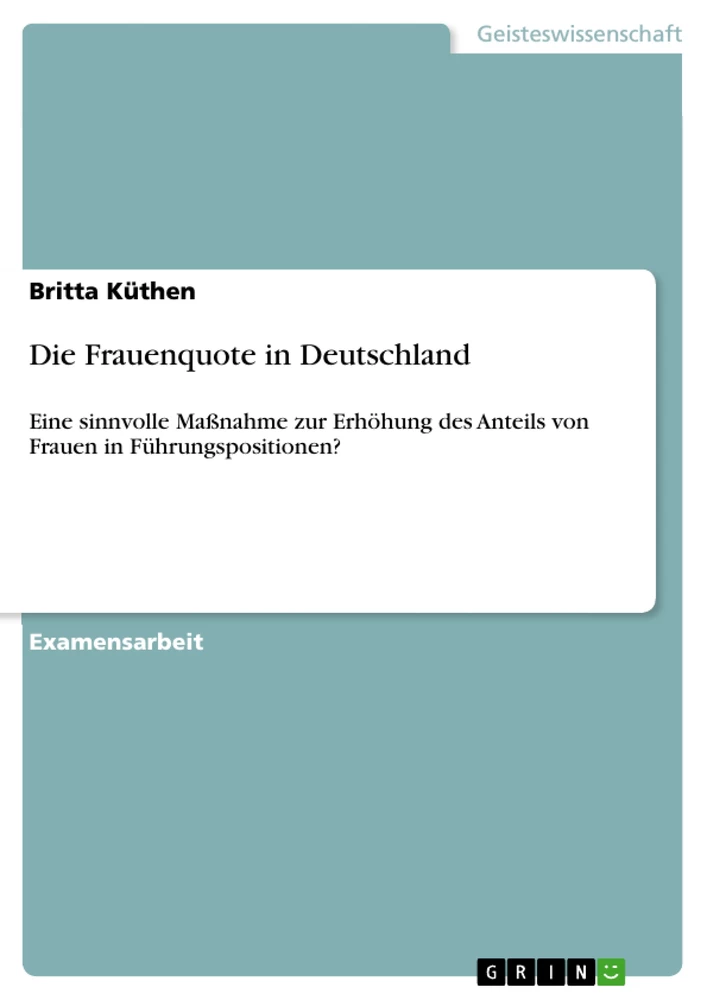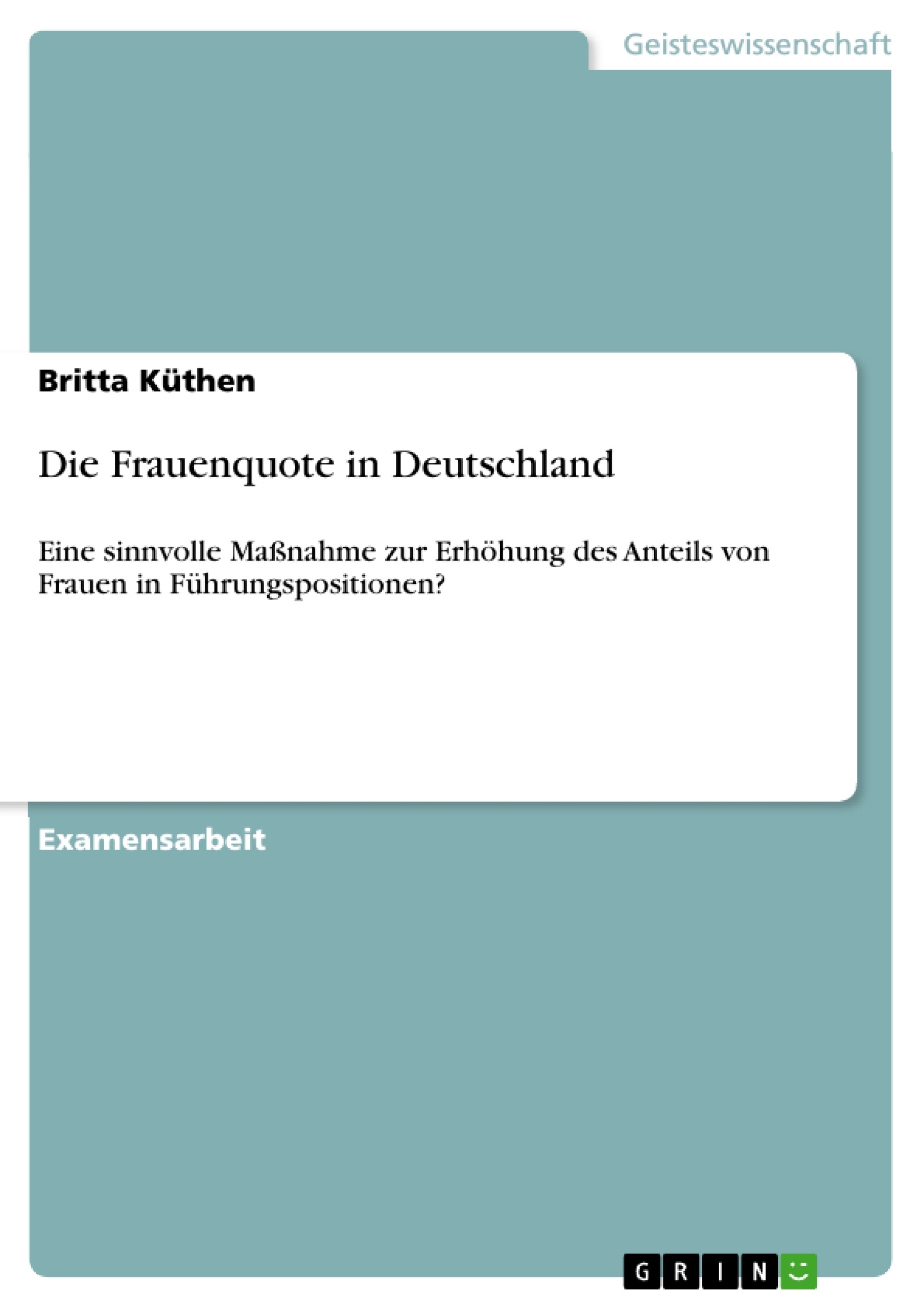Die Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland ist eng mit der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit verknüpft. Die Unterscheidung in ein weibliches und ein männliches Geschlecht sowie die Zuschreibung damit einhergehender charakterlicher Eigenschaften und Fähigkeiten sind die Grundlage für eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzieht sich im Deutschen Reich ein Wandel vom „ganzen Haus“, also einer „sozialen Einheit von Produktions- und Familienleben“ im bäuerlichen und handwerklichen Bereich, hin zur bürgerlichen Kleinfamilie. Dieser Wandel begründete sich in der zunehmenden Ausbreitung der kapitalistischen Arbeitsweise im Rahmen der Industrialisierung und der damit einhergehenden Trennung von Arbeits- und Wohnstätte (vgl. ebd.: 18). Im Zuge dieses Wandels entsteht zunächst im wohlhabenden und gebildeten Bürgertum das Idealbild, dass Frauen sich ganz der Hausarbeit und der Kindererziehung zu widmen haben, während der Mann die Rolle des Ernährers und des Familienoberhauptes inne hat (vgl. Rinken 2010: 64; vgl. Peuckert 2008: 18ff.).
Das bürgerliche Modell des männlichen Familienernährers wird zwar Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend auch in Arbeiterschichten populär, eine schichtübergreifende Etablierung und Durchsetzung dieses Familientyps bleibt jedoch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts aus (vgl. Gildemeister/Hericks 2012: 48). Die Mehrheit der Bevölkerung kann aufgrund der schwachen sozio-ökonomischen Lage (niedrige Löhne, hohe Arbeitslosigkeit) nicht auf das Einkommen der Frauen verzichten (vgl. Peuckert 2008: 19, Klenner et al. 2012: 25).
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland im Wandel der Ernährermodelle
- Frauen und Karriere im Deutschland des 21. Jahrhunderts
- Frauen in Führungspositionen – Zahlen und Fakten
- Gründe für den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen
- Geschlechterstereotypen und Geschlechtsrollenorientierung
- Vereinbarkeit von Karriere und Kindern - Die doppelte Vergesellschaftung von Frauen
- Einfluss von Partnerschaft auf die Karriere
- Statistische Diskriminierung
- Zugang zu informellen Netzwerken
- Innerbetriebliche Segmentation
- Zwischenfazit
- Politische Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen
- Gleichstellungspolitik in der EU und Deutschland
- Lösung Frauenquote? - Eine Übersicht über den aktuellen Stand der Verhandlungen in der EU und in Deutschland
- Vorbild Norwegen?
- Alternative Maßnahmen zur Erhöhung der Quote von Frauen in Führungspositionen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland. Sie analysiert historische Entwicklungen der Frauenerwerbstätigkeit, aktuelle Zahlen und die Gründe für die Ungleichheit. Darüber hinaus werden politische Maßnahmen, insbesondere die Frauenquote, und alternative Ansätze zur Verbesserung der Situation beleuchtet.
- Geschichtliche Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland
- Analyse des aktuellen Status quo von Frauen in Führungspositionen
- Diskussion verschiedener Ursachen für die geschlechtsspezifische Ungleichverteilung
- Bewertung politischer Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung
- Präsentation und Diskussion alternativer Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland im Wandel der Ernährermodelle: Die Einleitung skizziert die Verknüpfung der Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit mit der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit. Sie beschreibt den Wandel vom "ganzen Haus" zur bürgerlichen Kleinfamilie im 19. Jahrhundert und die damit verbundene Idealvorstellung der Frau als Hausfrau und Mutter. Die Autorin zeigt, dass sich dieses Modell, obwohl im Bürgertum etabliert, nicht schichtübergreifend durchsetzte, da die ökonomische Lage vieler Familien eine Erwerbstätigkeit der Frauen notwendig machte. Die Entstehung der ersten Frauenbewegung und ihre Erfolge im Kampf um Bildung und Wahlrecht werden ebenfalls kurz beleuchtet. Der Einfluss des Nationalsozialismus, der die Entwicklungen der ersten Frauenbewegung beendete und traditionelle Geschlechterrollen wieder verstärkte, wird ebenfalls angeschnitten.
Frauen und Karriere im Deutschland des 21. Jahrhunderts: Dieses Kapitel präsentiert aktuelle Daten zum geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen. Es analysiert verschiedene Gründe für diese Ungleichheit, darunter Geschlechterstereotypen, die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Karriere und Familie, den Einfluss von Partnerschaft auf Karrierechancen, statistische Diskriminierung, den Zugang zu informellen Netzwerken und innerbetriebliche Segmentierung. Diese Faktoren werden detailliert erörtert, um ein umfassendes Bild der Herausforderungen für Frauen im Berufsleben zu zeichnen. Das Zwischenfazit des Kapitels fasst die zentralen Ergebnisse zusammen.
Politische Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen: Das Kapitel untersucht politische Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen, beginnend mit einem Überblick über die Gleichstellungspolitik in der EU und Deutschland. Die Diskussion der Frauenquote als mögliches Instrument zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen steht im Mittelpunkt. Der aktuelle Stand der Verhandlungen sowie das Beispiel Norwegens als mögliches Vorbild werden beleuchtet. Schließlich werden alternative Maßnahmen vorgestellt und diskutiert, die dazu beitragen könnten, die Anzahl von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen.
Schlüsselwörter
Frauenquote, Führungspositionen, Geschlechtergleichstellung, Frauenerwerbstätigkeit, Geschlechterstereotypen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gleichstellungspolitik, Deutschland, EU, Norwegen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Frauen in Führungspositionen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland. Sie analysiert die historischen Entwicklungen der Frauenerwerbstätigkeit, aktuelle Zahlen und die Gründe für die Ungleichheit. Darüber hinaus werden politische Maßnahmen, insbesondere die Frauenquote, und alternative Ansätze zur Verbesserung der Situation beleuchtet.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: die geschichtliche Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland, den aktuellen Status quo von Frauen in Führungspositionen, verschiedene Ursachen für die geschlechtsspezifische Ungleichverteilung, die Bewertung politischer Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung und alternative Lösungsansätze.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Frauen und Karriere im 21. Jahrhundert, ein Kapitel zu politischen Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen und ein Fazit. Die Einleitung beleuchtet die Geschichte der Frauenerwerbstätigkeit im Kontext von Ernährermodellen. Das zweite Kapitel analysiert aktuelle Daten und Gründe für die Ungleichheit. Das dritte Kapitel untersucht politische Maßnahmen, insbesondere die Frauenquote, und alternative Ansätze. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Gründe für den geringen Frauenanteil in Führungspositionen werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht verschiedene Gründe, darunter Geschlechterstereotypen, die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Karriere und Familie, den Einfluss von Partnerschaft auf Karrierechancen, statistische Diskriminierung, den Zugang zu informellen Netzwerken und innerbetriebliche Segmentierung.
Welche politischen Maßnahmen werden diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert die Gleichstellungspolitik in der EU und Deutschland, insbesondere die Frauenquote, den aktuellen Stand der Verhandlungen und das Beispiel Norwegens als mögliches Vorbild. Zusätzlich werden alternative Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen vorgestellt und diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenquote, Führungspositionen, Geschlechtergleichstellung, Frauenerwerbstätigkeit, Geschlechterstereotypen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gleichstellungspolitik, Deutschland, EU, Norwegen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist es, den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland zu untersuchen und die Ursachen sowie mögliche Lösungsansätze zu analysieren.
- Quote paper
- Britta Küthen (Author), 2013, Die Frauenquote in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232608