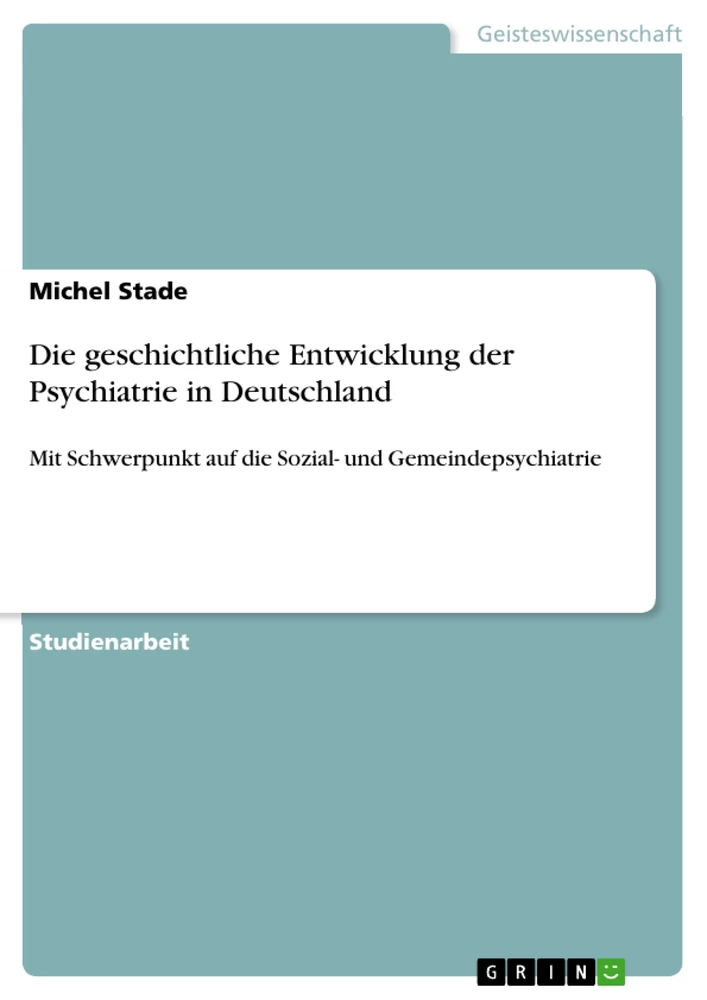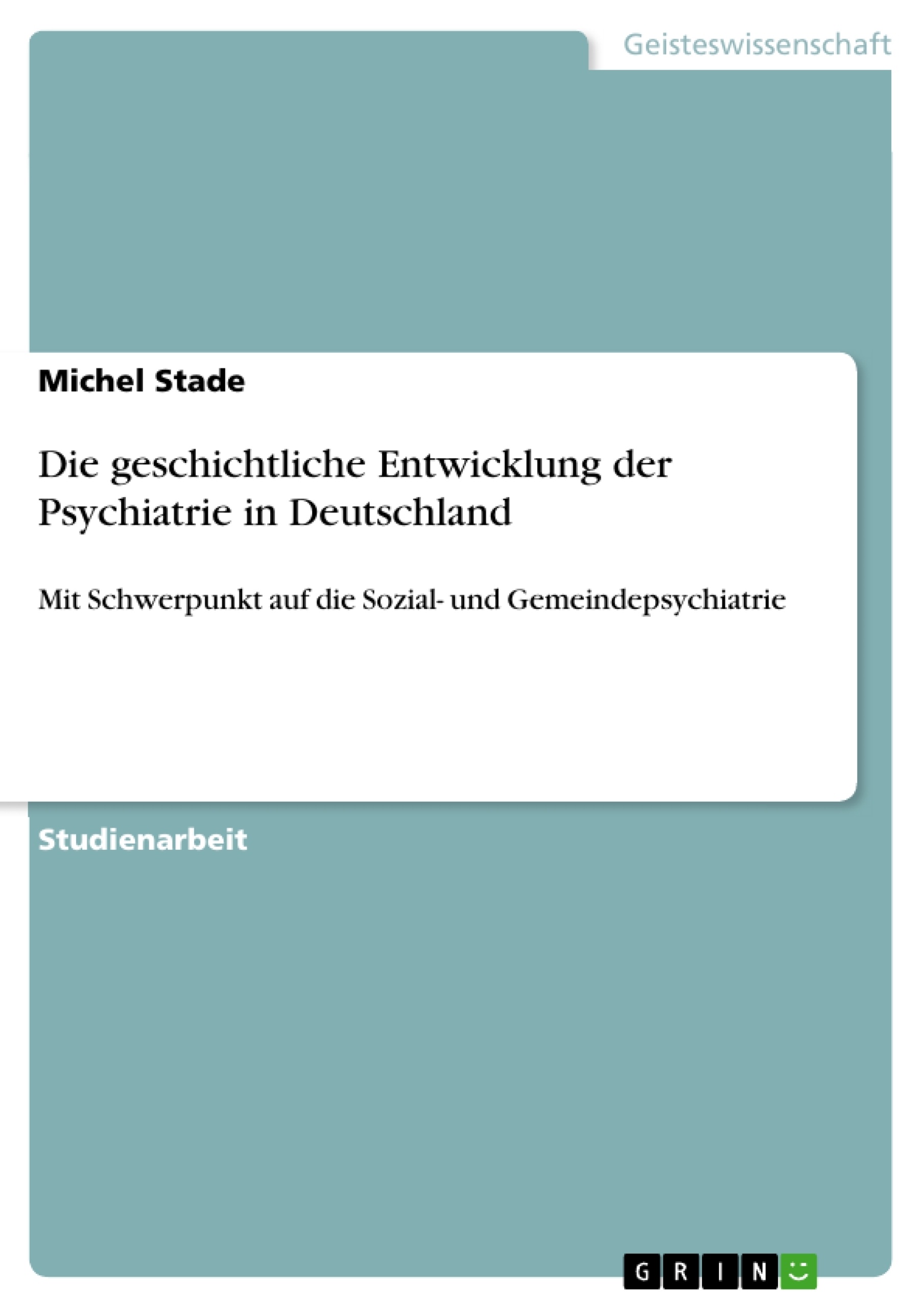Viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung leben heutzutage in der Gemeinde und nehmen, soweit es ihnen möglich ist, an dem gesellschaftlichen Leben teil, wobei keine Verdrängung dieser Menschen mehr stattfindet. Vielmehr hat eine fast vollständige Partizipation stattgefunden. Das Sozialgesetzbuch I § 10 besagt, dass „Menschen, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind oder denen eine solche Behinderung droht, … unabhängig von der Ursache der Behinderung zur Förderung ihrer Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe ein Recht auf Hilfe [haben] (…)“ (Stascheit 2008, S. 77). Diese Hilfen sind zu gewähren, damit sich die körperlich, geistig oder seelisch behinderten selbst entwickeln können und so weit wie möglich von Hilfen
unabhängig werden. Weiter heißt es in § 10 Absatz 4 des SGB I, dass „ihre Entwicklung zu fördern [ist] und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern [sei]“ (Stascheit 2008, S. 77). Diese Integration von u.a. psychisch kranken Menschen fand jedoch nicht immer
mit dem gleichen Selbstverständnis wie heute statt, sondern in der Geschichte der Psychiatrie war die räumliche Isolierung und Ausgrenzung psychisch kranker Menschen üblich und bei einem Großteil der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt. Gegenstand dieser Arbeit soll deshalb „Die geschichtliche Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland mit Schwerpunkt auf die Sozial- und Gemeindepsychiatrie“ sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die historische Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert
- 3. Die Entwicklung der Psychiatrie nach dem 2. Weltkrieg
- 3.1. Die Gemeindepsychiatrie auf dem Hintergrund der Psychiatrie-Enquête
- 3.2. Die Sozialpsychiatrie
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschichtliche Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die Sozial- und Gemeindepsychiatrie. Sie beleuchtet die Veränderungen der Psychiatrie vom 18. und 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit. Die Arbeit adressiert die Frage nach der Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert und den Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Auswirkungen der Psychiatrie-Enquête und die Ansätze der Sozialpsychiatrie.
- Die historische Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert
- Die Psychiatrie-Reform nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Entstehung und Bedeutung der Gemeindepsychiatrie
- Die Rolle der Sozialpsychiatrie im Wandel der psychiatrischen Versorgung
- Die gesellschaftliche Ausgrenzung psychisch Kranker und deren Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der geschichtlichen Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Veränderung der psychiatrischen Versorgung von der Ausgrenzung hin zur Integration psychisch kranker Menschen in den Mittelpunkt. Sie beschreibt den Wandel vom Ausschluss hin zur Partizipation und verweist auf das Sozialgesetzbuch I § 10 als Grundlage für die heutige integrative Versorgung. Die Arbeit kündigt die methodische Vorgehensweise an, indem sie die zu behandelnden Fragestellungen und den Aufbau der Arbeit skizziert.
2. Die historische Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die Ausgrenzung psychisch Kranker im 18. und 19. Jahrhundert. Etwa 25% der Bevölkerung wurden ausgegrenzt, darunter Bettler, Arme und "Irre". Geistliche Stifte und Klöster zerfielen, und die gesellschaftliche Unterstützung schwand. "Irre" wurden als sozial unbrauchbar angesehen und in speziellen Gefängnissen untergebracht. Trotzdem gab es erste Reformversuche, wie die Angliederung eines Irrenturms an das Wiener Hauptspital 1784 und die Berücksichtigung eines Heilungsmotivs im Juliusspital Würzburg 1785. Die Anfänge der modernen Psychiatrie in Deutschland begannen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, mit der Eröffnung zahlreicher psychiatrischer Anstalten und der Veröffentlichung der "Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie". Behandlungsmethoden wie "Ekel- und Schmerztherapie" wurden angewendet. Wilhelm Griesinger gilt als bedeutender Reformer, der psychische Erkrankungen als Gehirnkrankheiten ansah. Die französische Revolution brachte einen Wandel, mit Philippe Pinels "Befreiung der angeketteten Irren" als symbolischem Akt. Unterschiedliche Theorien zu psychischen Erkrankungen wurden aufgestellt, von Immanuel Kants philosophischem Ansatz bis zu C.F.W. Rollers Betonung der Erziehung und Umwelt. Die Kranken wurden oft lebenslang in Anstalten weggesperrt, ohne aktive Tagesgestaltung oder Entlassungsprogramme.
Schlüsselwörter
Psychiatriegeschichte, Deutschland, Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie, Psychiatrie-Enquête, Ausgrenzung, Integration, psychische Erkrankung, Wilhelm Griesinger, Philippe Pinel, Partizipation, Selbstbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zur Psychiatriegeschichte in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland, insbesondere die Sozial- und Gemeindepsychiatrie, vom 18. und 19. Jahrhundert bis in die Nachkriegszeit. Sie beleuchtet den Wandel von der Ausgrenzung zur Integration psychisch Kranker und analysiert die Auswirkungen der Psychiatrie-Enquête sowie die Ansätze der Sozialpsychiatrie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert, die Psychiatrie-Reform nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entstehung und Bedeutung der Gemeindepsychiatrie, die Rolle der Sozialpsychiatrie, die gesellschaftliche Ausgrenzung psychisch Kranker und deren Integrationsprozess.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung der Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert, ein Kapitel zur Entwicklung der Psychiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg (inklusive Gemeinde- und Sozialpsychiatrie) und ein Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was beschreibt das Kapitel zur Psychiatrie im 18. und 19. Jahrhundert?
Dieses Kapitel schildert die weit verbreitete Ausgrenzung psychisch Kranker, die oft als sozial unbrauchbar galten und in Anstalten ohne adäquate Behandlung untergebracht wurden. Es werden erste Reformversuche erwähnt und wichtige Persönlichkeiten wie Wilhelm Griesinger und Philippe Pinel genannt. Es werden auch die unterschiedlichen Theorien zu psychischen Erkrankungen und die damaligen Behandlungsmethoden beschrieben.
Welche Rolle spielt die Psychiatrie-Enquête?
Die Psychiatrie-Enquête wird im Kontext der Entwicklung der Gemeindepsychiatrie nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen dieser Enquête auf die Veränderungen in der psychiatrischen Versorgung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die geschichtliche Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland zu untersuchen und den Wandel von der Ausgrenzung zur Integration psychisch Kranker zu analysieren. Sie beleuchtet die Entwicklung der Sozial- und Gemeindepsychiatrie und deren Bedeutung für die heutige psychiatrische Versorgung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Psychiatriegeschichte, Deutschland, Sozialpsychiatrie, Gemeindepsychiatrie, Psychiatrie-Enquête, Ausgrenzung, Integration, psychische Erkrankung, Wilhelm Griesinger, Philippe Pinel, Partizipation, Selbstbestimmung.
Welche Bedeutung hat das Sozialgesetzbuch I § 10?
Das Sozialgesetzbuch I § 10 wird in der Einleitung erwähnt und dient als Grundlage für die heutige integrative Versorgung psychisch Kranker.
- Quote paper
- Michel Stade (Author), 2011, Die geschichtliche Entwicklung der Psychiatrie in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232498