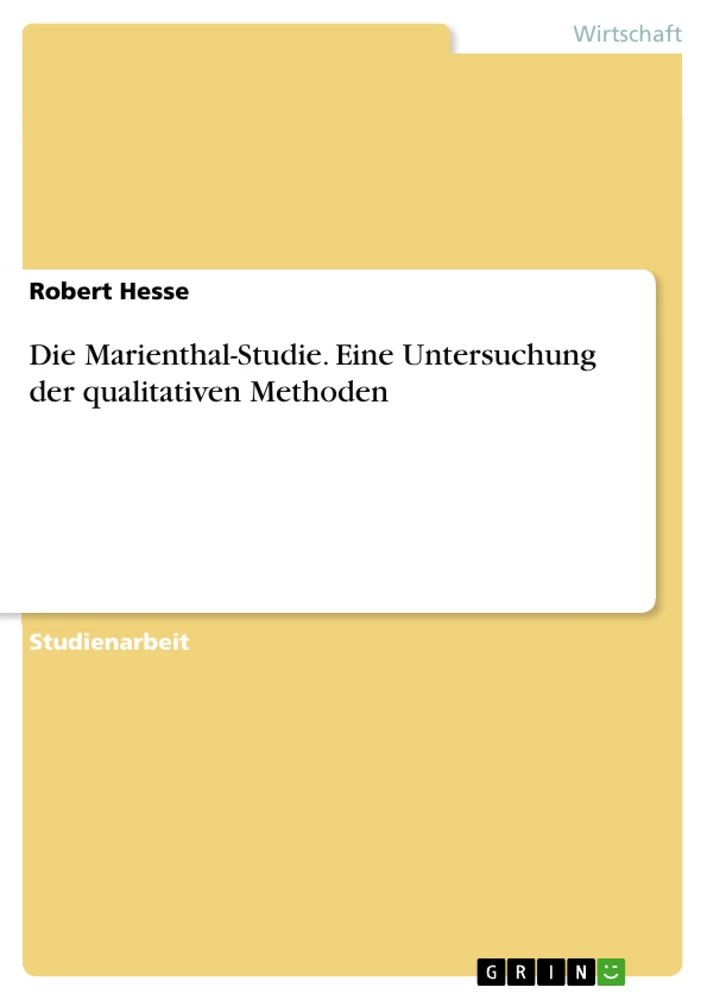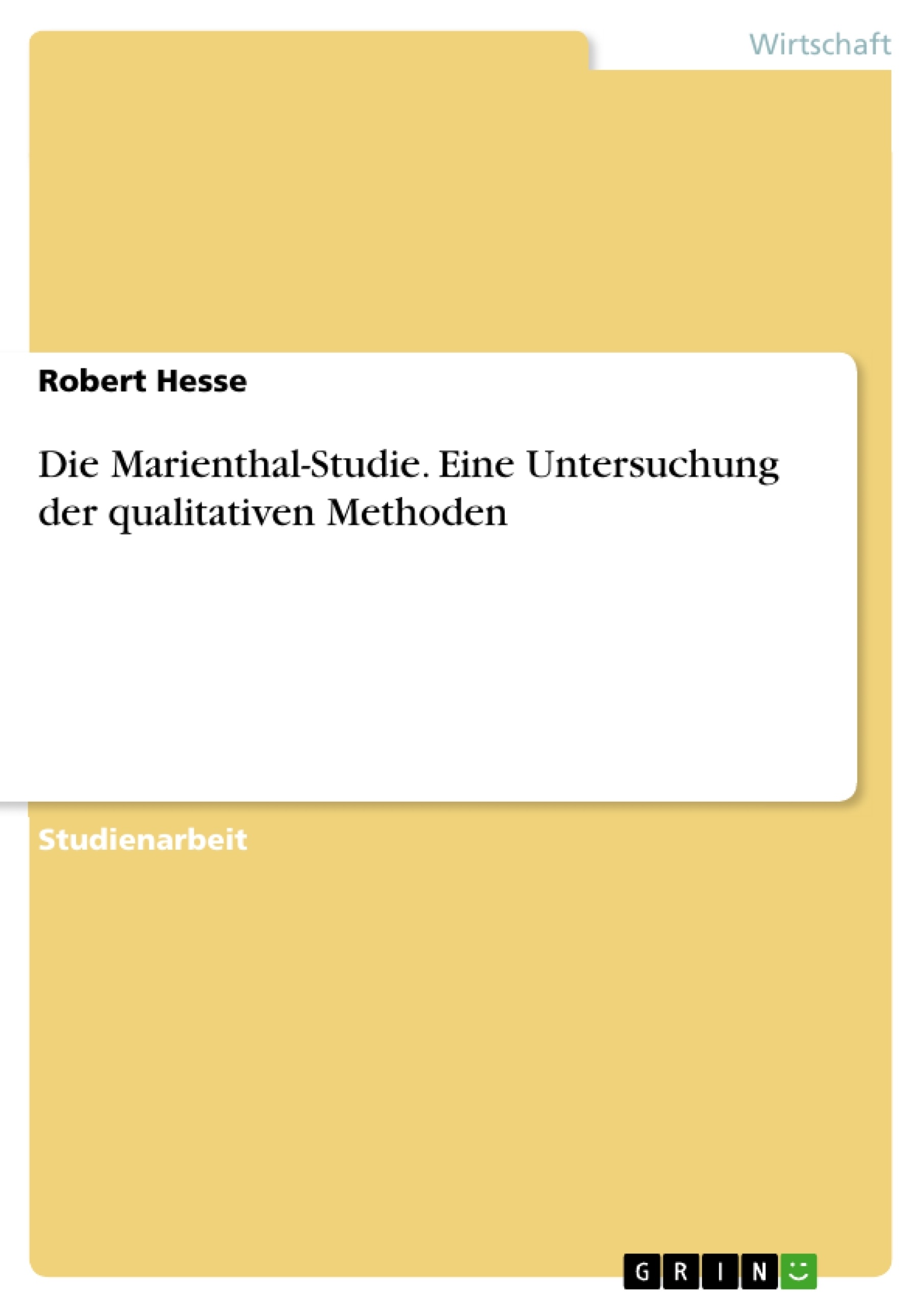Stellen sie einmal vor, dass Volkswagen plötzlich Insolvenz anmelden muss. Die Folgen für die deutsche Wirtschaft wären verheerend und die Arbeitslosenzahl würde in Deutschland von aktuell 3,156 Millionen (stand Februar 2013, Anm. d. A.) um ca. 225.000 auf knapp 3,4 Millionen Arbeitssuchende anwachsen. Besonders hart dürfte dieses Szenario aber die Stadt Wolfsburg treffen, welche bekanntlich als Arbeitersiedlung des dort erbauten Volkswagen-Werkes entstanden ist. Rund ein Drittel der 122.000 Einwohner der Stadt Wolfsburg sind heute in der dort direkt beim VW-Konzerns angestellt und schätzungsweise ein weiteres Drittel ist indirekt damit verbunden (Dienstleister, Zulieferer u.ä.). Die Folgen für die Stadt, welche sich aus einer plötzlichen Arbeitslosigkeit eines Drittels Ihrer Einwohner ergeben würden, sind kaum auszumalen.
Die Einwohner von Marienthal mussten im Jahre 1929 leider aber genau diese Erfahrung machen. Innerhalb kürzester Zeit verloren ca. 1300 von ca. 1500 Einwohnern ihren Job. Im Gegensatz zum heutigen globalen Zeitalter, in welchem die Arbeit des Unternehmens aus New York in München erledigt werden kann und ein beruflicher Umzug in eine andere Stadt alltäglich praktiziert wird, befanden sich die Marienthaler damals in einer ausweglosen Situation. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise war auch im weiteren Umkreis keinerlei Arbeit zu finden.
Die psychischen und sozialen Auswirkungen auf die betroffenen Menschen und das Leben in ihrem Dorf sind noch heute kaum vorstellbar und waren zu der damaligen Zeit in keinster Weise nachzuvollziehen. Darum entschloss sich eine österreichische Forschungsgruppe eben diese durch eine Studie zu erforschen. Die daraus entstandene Marienthal-Studie gehört zu den Klassikern der sozialwissenschaftlichen Forschung und gilt durch ihren Methodenreichtum bis heute als vorbildliche empirische Studie.
Die folgende Arbeit soll genau diese Studie hinsichtlich Ihrer herausragenden Forschungsmethoden untersuchen. Im Fokus sollen dabei die angewandten qualitativen Methoden stehen, welche von den quantitativen abgegrenzt und anschließend hinsichtlich der ethischen Aspekte sowie Ihrer Anwendbarkeit in der heutigen Zeit bewertet werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe
- Der Ort: Marienthal — Das Industriedorf
- Das Forschungsteam
- Anlass der Studie
- Ein ganzes Dorf wird arbeitslos
- Entstehungskontext der Marienthal-Studie
- Die Marienthal - Studie
- Grundkonzept der Studie
- Forschungsfragen
- Gang der Untersuchung
- Methoden zur Datenerhebung
- Nicht-reaktive Techniken
- Reaktive Techniken
- Methodenmix am Beispiel die Zeit und die Haltung
- Bewertung der Studie
- Grundkonzept der Studie
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Marienthal-Studie, einer klassischen sozialwissenschaftlichen Untersuchung aus den 1930er Jahren. Ziel der Arbeit ist es, die in der Studie angewandten qualitativen Methoden zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf ihre ethischen Aspekte und ihre Anwendbarkeit in der heutigen Zeit.
- Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf eine Dorfgemeinschaft
- Die Entwicklung von Methoden der empirischen Sozialforschung
- Die ethischen Aspekte der Datenerhebung in der Sozialforschung
- Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden
- Die historische und gesellschaftliche Einbettung der Marienthal-Studie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Marienthal-Studie vor und erläutert den Kontext der Studie. Sie beschreibt die Situation in Marienthal, einem Dorf, dessen Bewohner aufgrund der Schließung einer Textilfabrik arbeitslos wurden. Die Einleitung betont auch die Bedeutung der Marienthal-Studie für die sozialwissenschaftliche Forschung.
Das Kapitel "Hintergründe" gibt einen Überblick über die Geschichte des Ortes Marienthal und stellt das Forschungsteam vor. Es werden die Biografien der wichtigsten Teammitglieder, Paul Felix Lazarsfeld, Marie Jahoda und Hans Zeisel, beschrieben und deren Motivation für die Studie beleuchtet.
Das Kapitel "Die Marienthal-Studie" geht auf das Grundkonzept der Studie ein und beschreibt die Forschungsfragen, die das Team zu beantworten versuchte. Es werden die Methoden zur Datenerhebung erläutert, die in der Studie verwendet wurden. Dazu gehören sowohl nicht-reaktive Techniken, wie z.B. Auswertung amtlicher Statistiken, Dokumentenanalyse und verdeckte Beobachtung, als auch reaktive Techniken, wie z.B. teilnehmende Beobachtung, mündliche Befragung und schriftliche Befragung.
Im Kapitel "Bewertung der Studie" werden die in der Marienthal-Studie angewandten Methoden aus heutiger ethischer Sicht bewertet. Die Arbeit diskutiert die Frage, inwieweit die damaligen Methoden in der heutigen Zeit noch anwendbar sind und welche ethischen Herausforderungen mit der Datenerhebung und -analyse verbunden sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Marienthal-Studie, qualitative Methoden der Sozialforschung, Arbeitslosigkeit, Dorfgemeinschaft, empirische Sozialforschung, ethische Aspekte der Datenerhebung, Methodenvielfalt, non-reaktive Techniken, reaktive Techniken, teilnehmende Beobachtung, Dokumentenanalyse, verdeckte Beobachtung, mündliche Befragung, schriftliche Befragung, Zeitbudget, Haltungstypen, historische Einbettung.
- Quote paper
- Bachelor Robert Hesse (Author), 2013, Die Marienthal-Studie. Eine Untersuchung der qualitativen Methoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232420