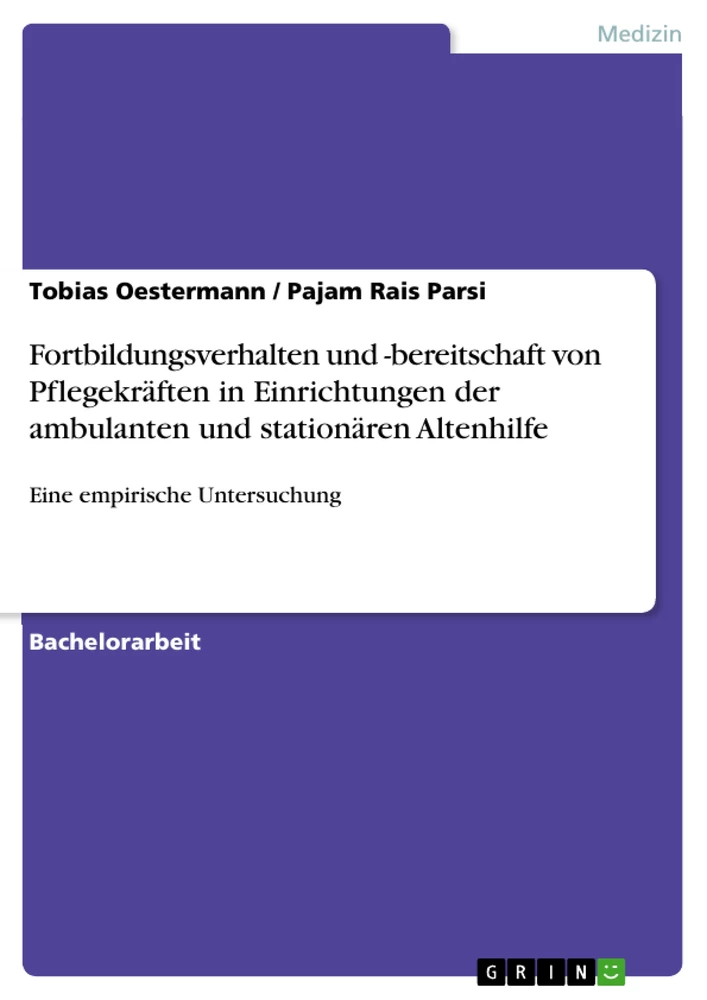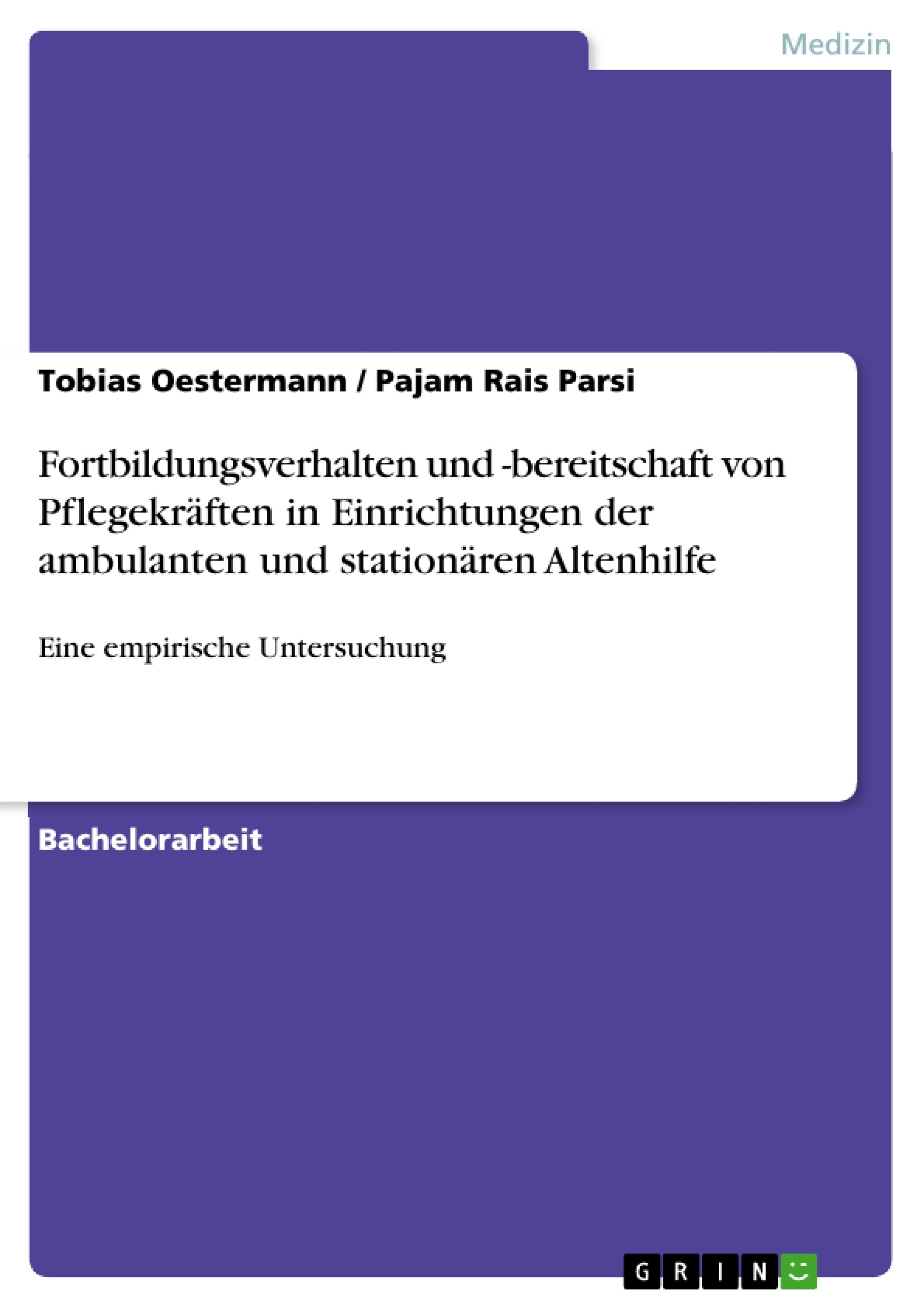Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Fortbildungsbereitschaft von Pflegekräften in ambulanten und stationären Einrichtungen der Altenhilfe untersucht. Hierfür wurden insgesamt 185 Pflegekräfte aus jeweils sechs ambulanten bzw. stationären Altenhilfeeinrichtungen befragt. Neben dem bisherigen Fortbildungsverhalten wurden die Gründe für die Teilnahme an Fortbildungen und die Einstellung zu Nutzen und Wichtigkeit von Fortbildungen erhoben. Zudem wurden Faktoren erfasst, welche die Teilnahme an Fortbildungen erschweren sowie die Zufriedenheit mit der allgemeinen Arbeitssituation.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die untersuchten Pflegekräfte eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen aufweisen. Bivariate Analysen zeigten jedoch Unterschiede zwischen verschiedenen Teilstichproben. So sind z.B. ältere Pflegekräfte dem Fortbildungsnutzen gegenüber kritischer eingestellt sind als jüngere Pflegekräfte. Weibliche Pflegende haben hingegen ein stärkeres Interesse an Fortbildungen teil-zunehmen als ihre männlichen Kollegen. Pflegefachkräfte nehmen häufiger an Fortbildungen teil als Pflegehilfskräfte. Wenn sie darüber hinaus noch Zusatzqualifikationen erworben haben, steigert dies ebenfalls die Fortbildungsbereitschaft. Pflegende in stationären Einrichtungen weisen eine höhere Teilnahmebereitschaft auf als die Pflegekräfte, die in ambulanten Einrichtungen tätig sind. Je höher der allgemein-bildende Schulabschluss ist, desto wichtiger werden Fortbildungen von den Mitarbeitern angesehen. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass Pflegekräfte, die bis zu zwei Jahre in derselben Einrichtung angestellt sind, eine höhere Motivation aufweisen mehr Verantwortung zu übernehmen und beruflich aufzusteigen als ihre Kollegen, die bereits länger in der Einrichtung tätig sind. Je zufriedener Pflegekräfte mit der Arbeitssituation sind, desto mehr Fortbildungen besuchen sie. Die Zufriedenheit mit der Bezahlung hat keinen nach-gewiesenen direkten Einfluss auf die Teilnahme an Fortbildungen. Pflegekräfte, die mit der Bezahlung unzufrieden sind, beurteilen den Nutzen von Fortbildungen jedoch kritischer als die Pflegekräfte, die mit ihrer Bezahlung zufrieden sind.
Die beschriebenen Ergebnisse wurden interpretiert und diskutiert. Zudem wurde die Bedeutung der vorliegenden Ergebnisse für die Praxis dargestellt und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Relevanz des Themas
- 1.2 Fragestellung und Hypothese
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Definitionen und Zusammenhänge
- 2.1.1 Fortbildung
- 2.1.2 Weiterbildung in Abgrenzung zu Fortbildung
- 2.1.3 Motivation als Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen
- 2.2 Verpflichtungen der Pflegekräfte zur Aktualisierung ihres Wissens
- 2.2.1 Verpflichtung aufgrund gesetzlicher Grundlagen
- 2.2.2 Verantwortung aufgrund des Berufsverständnisses
- 2.2.3 Verpflichtung durch bundeslandspezifische Berufsordnungen
- 2.3 Verpflichtungen der Pflegeeinrichtung zur Ermöglichung von Fortbildungen
- 2.3.1 Verpflichtung durch das Heimgesetz
- 2.3.2 Verpflichtung durch die Heimpersonalverordnung
- 2.3.3 Verpflichtung durch Rahmenverträge gemäß § 75 SGB XI
- 2.3.4 Vertragliche Verpflichtung für ambulante Einrichtungen gemäß § 132 und 132 a SGB V
- 2.4 Aktuelle Fortbildungsangebote in der Pflege
- 2.5 Bisherige Studienergebnisse
- 3 Untersuchungsmethodik
- 3.1 Feldzugang
- 3.2 Feldbeschreibung
- 3.2.1 Beschreibung der Einrichtungen
- 3.2.2 Beschreibung des Untersuchungsinstrumentes und Begründung der Fragen
- 3.2.3 Durchführung des Pretests
- 3.2.4 Abweichungen von der Planung
- 3.3 Methode der Datenauswertung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Befragungszeitraum und Rücklauf
- 4.2 Beschreibung der Ergebnisse der Gesamtpopulation
- 4.3 Darstellung, Interpretation und Diskussion bivariater Zusammenhänge
- 4.3.1 Differenzierung nach Alter
- 4.3.2 Differenzierung nach Geschlecht
- 4.3.3 Differenzierung nach Berufsausbildung
- 4.3.4 Differenzierung nach Zusatzqualifikation
- 4.3.5 Differenzierung nach Art der Einrichtung
- 4.3.6 Differenzierung nach Art des Schulabschlusses
- 4.3.7 Differenzierung nach Dauer der Zugehörigkeit zur Einrichtung
- 4.3.8 Differenzierung nach Zufriedenheit mit der Bezahlung
- 4.3.9 Differenzierung nach Gesamtzufriedenheit mit der Arbeitssituation
- 5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Fortbildungsbereitschaft und das Fortbildungsverhalten von Pflegekräften in ambulanten und stationären Altenhilfeeinrichtungen. Ziel ist es, die Motivation der Pflegekräfte für die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu ergründen und den Einfluss verschiedener Faktoren auf diese Motivation zu analysieren.
- Einfluss des Alters und Geschlechts auf die Fortbildungsbereitschaft
- Zusammenhang zwischen beruflicher Qualifikation und Fortbildungsverhalten
- Auswirkungen der Arbeitssituation (Zufriedenheit, Bezahlung, Aufstiegschancen) auf die Teilnahme an Fortbildungen
- Bedeutung von Zusatzqualifikationen für die Fortbildungsmotivation
- Unterschiede im Fortbildungsverhalten zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein, erläutert die Relevanz von lebenslangem Lernen im Pflegeberuf, insbesondere im Kontext des sich schnell verändernden medizinisch-pflegerischen Wissens. Es wird die Bedeutung der Aktualisierung von Fachwissen für eine qualifizierte Pflege betont und die Forschungsfrage sowie die Hypothesen der Arbeit formuliert. Die hohe Arbeitsbelastung und der hohe Krankenstand in Pflegeberufen werden als potenzielle Einflussfaktoren auf die Fortbildungsbereitschaft genannt.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es werden die Begriffe "Fortbildung" und "Weiterbildung" definiert und voneinander abgegrenzt. Die Rolle der Motivation (intrinsisch und extrinsisch) wird erläutert. Anschließend werden die gesetzlichen und berufsständischen Verpflichtungen von Pflegekräften und Einrichtungen zur Fortbildung detailliert dargestellt und analysiert. Schließlich werden relevante Ergebnisse aus vorherigen Studien zum Thema Fortbildungsbereitschaft in der Pflege vorgestellt und diskutiert.
3 Untersuchungsmethodik: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert den Zugang zu den teilnehmenden Einrichtungen, die Auswahlkriterien und die Datenerhebungsmethode (Fragebogen). Die Beschreibung des Fragebogens, die Durchführung und Auswertung des Pretests, sowie die Methode der Datenauswertung mit dem Statistikprogramm PASW werden detailliert dargestellt.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es beginnt mit der Beschreibung des Befragungszeitraums und des Rücklaufs der Befragung. Anschließend werden die Ergebnisse der Grundauszählung der Gesamtpopulation vorgestellt. Der Hauptteil dieses Kapitels widmet sich der detaillierten Darstellung und Interpretation von bivariaten Zusammenhängen zwischen verschiedenen Faktoren (Alter, Geschlecht, Berufsausbildung, Zusatzqualifikationen, Art der Einrichtung, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Zufriedenheit mit Bezahlung und Arbeitssituation) und der Fortbildungsbereitschaft und dem Fortbildungsverhalten der Pflegekräfte.
Schlüsselwörter
Fortbildungsbereitschaft, Fortbildungsverhalten, Altenpflege, ambulante Altenhilfe, stationäre Altenhilfe, Pflegekräfte, Motivation, Zufriedenheit, Arbeitsbelastung, gesetzliche Verpflichtungen, Weiterbildung, Zusatzqualifikationen, empirische Untersuchung, bivariate Analysen.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Fortbildungsbereitschaft von Pflegekräften
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Fortbildungsbereitschaft und das Fortbildungsverhalten von Pflegekräften in ambulanten und stationären Altenhilfeeinrichtungen. Ziel ist die Ergründung der Motivationsfaktoren für die Teilnahme an Fortbildungen und die Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf diese Motivation.
Welche Faktoren werden auf ihren Einfluss auf die Fortbildungsbereitschaft untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Alter, Geschlecht, beruflicher Qualifikation, Arbeitssituation (Zufriedenheit, Bezahlung, Aufstiegschancen), Zusatzqualifikationen und der Art der Einrichtung (ambulant vs. stationär) auf die Fortbildungsbereitschaft und das Fortbildungsverhalten.
Welche Methoden wurden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Untersuchungsmethodik. Es wurde ein Fragebogen eingesetzt, um Daten von Pflegekräften zu erheben. Die Datenauswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm PASW, wobei bivariate Zusammenhänge analysiert wurden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Relevanz des Themas, Fragestellung und Hypothese), theoretischer Hintergrund (Definitionen, gesetzliche und berufsständische Verpflichtungen, vorherige Forschungsergebnisse), Untersuchungsmethodik (Feldzugang, Feldbeschreibung, Methode der Datenauswertung), Ergebnisse (Befragungszeitraum, Rücklauf, Ergebnisse der Gesamtpopulation, bivariate Zusammenhänge) und Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Fortbildungsbereitschaft, Fortbildungsverhalten, Altenpflege, ambulante Altenhilfe, stationäre Altenhilfe, Pflegekräfte, Motivation, Zufriedenheit, Arbeitsbelastung, gesetzliche Verpflichtungen, Weiterbildung, Zusatzqualifikationen, empirische Untersuchung, bivariate Analysen.
Welche konkreten Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen den Rücklauf der Befragung, die Ergebnisse der Grundauszählung der Gesamtpopulation und eine detaillierte Darstellung und Interpretation bivariater Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren (Alter, Geschlecht, Berufsausbildung, Zusatzqualifikationen etc.) und der Fortbildungsbereitschaft/dem Fortbildungsverhalten der Pflegekräfte.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Der theoretische Teil umfasst Definitionen von "Fortbildung" und "Weiterbildung", die Erläuterung der Rolle der Motivation (intrinsisch und extrinsisch), die Darstellung der gesetzlichen und berufsständischen Verpflichtungen von Pflegekräften und Einrichtungen zur Fortbildung sowie die Diskussion relevanter Ergebnisse aus vorherigen Studien.
Welche Art von Einrichtungen wurden in die Studie einbezogen?
Die Studie umfasst sowohl ambulante als auch stationäre Altenhilfeeinrichtungen.
Wie wird die Hypothese der Arbeit formuliert?
Die genaue Formulierung der Hypothese ist im Text der Bachelorarbeit selbst zu finden. Die Einleitung deutet aber auf eine Untersuchung möglicher Zusammenhänge zwischen Arbeitsbelastung, Krankenstand und Fortbildungsbereitschaft hin.
- Quote paper
- cand M.A. Berufspädagogik Pflege und Gesundheit Tobias Oestermann (Author), Pajam Rais Parsi (Author), 2011, Fortbildungsverhalten und -bereitschaft von Pflegekräften in Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232222