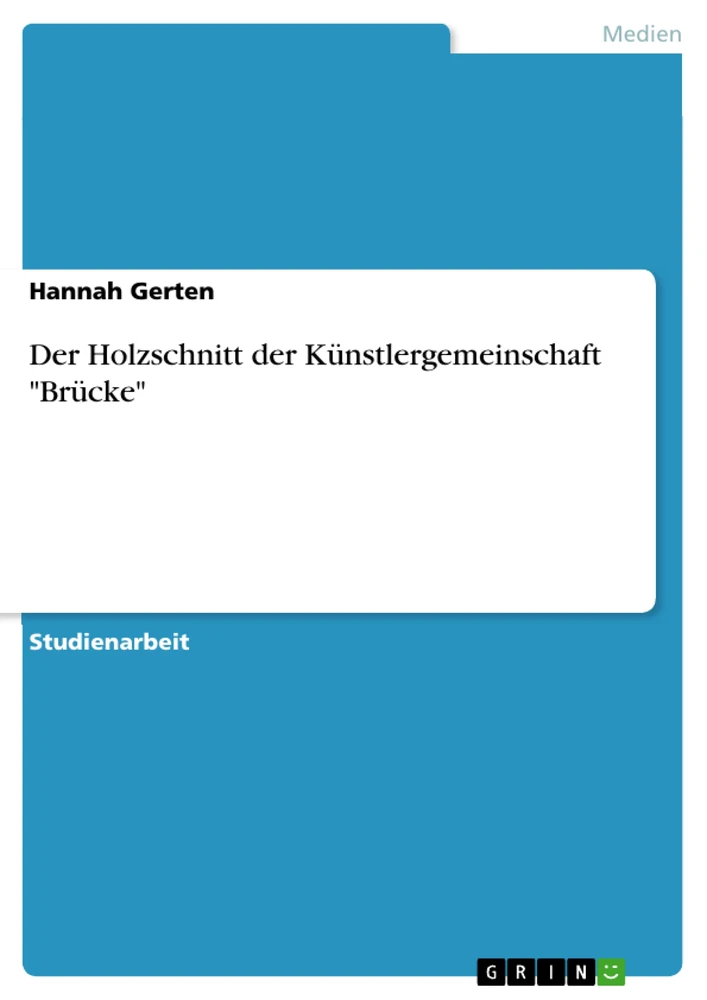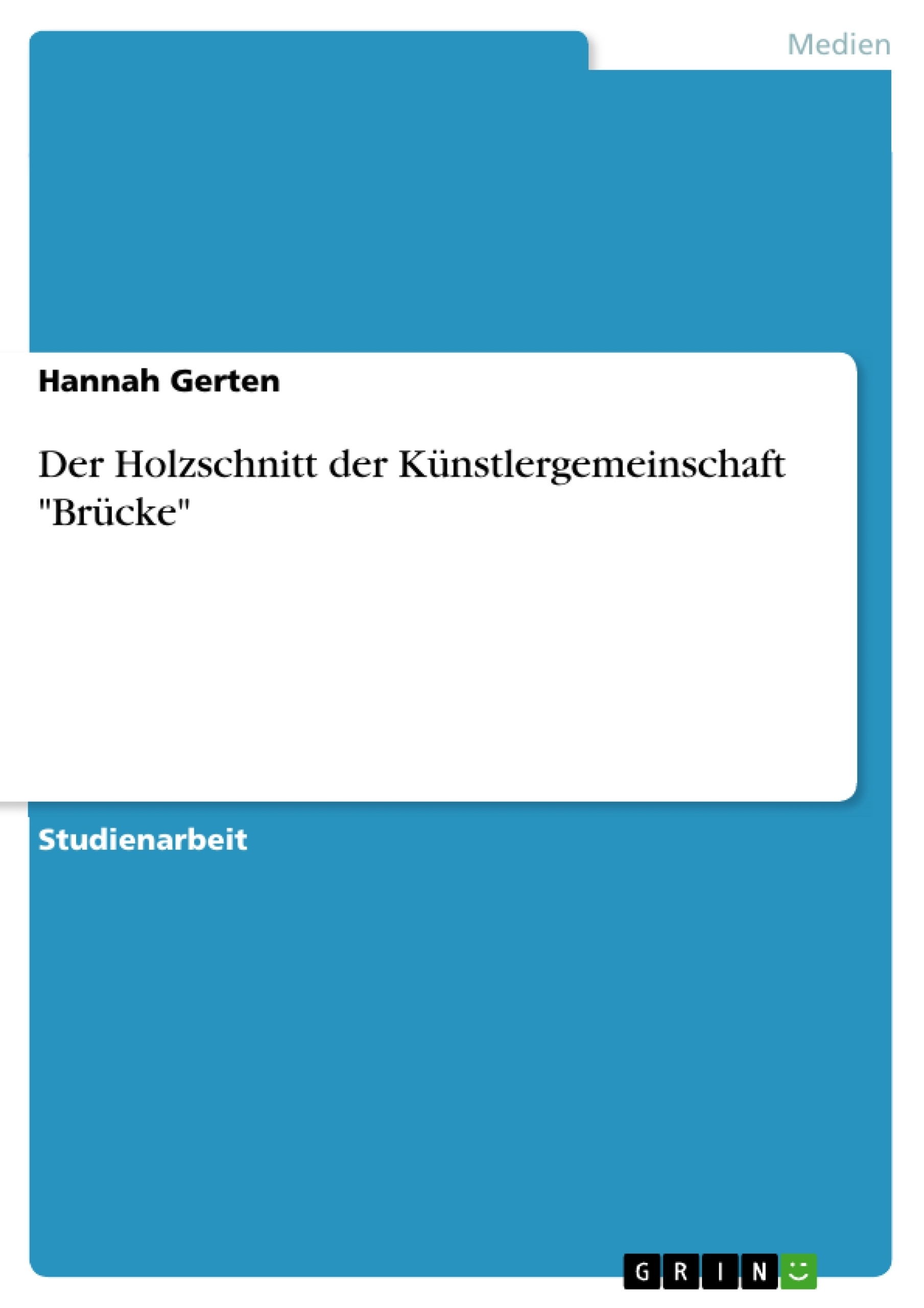Der Holzschnitt, vor allem der Flächenholzschnitt in Langholz, wird als die herausragende Leistung der Kunst des deutschen Expressionismus gesehen. So bezeichnete Paul Westheim bereits 1921 den Holzschnitt als „die Leidenschaft der jungen Künstlergeneration“, für Wolf-Dieter Dube ist er „die Essenz dessen, was man unter ‚Expressionismus‘ zu verstehen hat.“ Durch die Vereinfachung und Reduzierung auf elementare Formen sowie eine flächige Farbgebung weist der Holzschnitt der „Brücke“-Künstlergemeinschaft die Hauptmerkmale des Expressionismus auf. Die Expressionisten wehrten sich gegen die klassische Formensprache der Akademiekunst, weil sie ihnen nicht natürlich und zu realitätsfern erschien. Sie wollten „den harten Tatsachen unserer Existenz ins Auge schauen“ und klarstellen, dass es „unaufrichtig und verlogen wäre, immer nur die erfreulichen Seiten des Lebens darzustellen.“
Der Holzschnitt hatte im 19. Jahrhundert an Bedeutung verloren, weil sich vielseitigere und effektivere Druckverfahren entwickelt hatten. Er wurde zu jener Zeit beinahe ausschließlich für Reproduktions- und Illustrationszwecke verwendet. Ende des 19. Jahrhunderts erfuhr er jedoch mit dem Hauptvertreter Albrecht Dürer eine neue Blütezeit, die durch die Künstler der „Brücke“- Gemeinschaft fortgeführt wurde. Dube bezeichnet sie aus diesem Grund als die „Begründer des neuen Holzschnitts“, Eberhard Roters nennt sie die „Erneuerer des deutschen Holzschnitts“
Im Folgenden soll zunächst das druckgraphische Oeuvre der „Brücke“-Künstler vor dem sozialgeschichtlichen Hintergrund beleuchtet werden, um auf ihre Motivwahl und die Art ihres Schaffens Rückschlüsse zu ziehen. Anschließend werden die Holzschnitte der Künstlergruppe in Bezug zu anderen, teilweise als Vorbild dienenden Werken gesetzt sowie analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Anfänge der „Brücke“ – Dresden
- 2.1 Die Gründung der „Brücke“-Künstlergemeinschaft
- 3 Das Programm
- 5 Die Entwicklung der „Brücke“ in den Jahren bis zur Auflösung 1913
- 5.1 Weiterwirken nach dem Krieg
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das druckgraphische Werk der Künstlergruppe „Brücke“, insbesondere den Holzschnitt, im Kontext des deutschen Expressionismus. Ziel ist es, die Motivwahl, die Arbeitsweise und die Bedeutung des Holzschnitts für die „Brücke“-Künstler zu analysieren und in Beziehung zu anderen Werken zu setzen.
- Der Holzschnitt als zentrales Medium des Expressionismus
- Die Gründung und das Programm der „Brücke“-Künstlergemeinschaft
- Die Abgrenzung von der akademischen Kunsttradition
- Die Arbeitsmethoden und der Gruppenstil der „Brücke“
- Der Einfluss des Holzschnitts auf die Entwicklung des Expressionismus
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die herausragende Bedeutung des Holzschnitts, insbesondere des Flächenholzschnitts, für den deutschen Expressionismus hervor. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit vor und verortet den Holzschnitt der „Brücke“ im Kontext der Kunstgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wobei auf die Wiederbelebung der Technik nach einer Phase des Rückgangs hingewiesen wird. Die Einleitung betont die Bedeutung der „Brücke“-Künstler als Erneuerer des deutschen Holzschnitts.
2 Die Anfänge der „Brücke“ – Dresden: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der „Brücke“-Künstlergemeinschaft in Dresden um die Jahrhundertwende. Es beschreibt den Kontext der akademischen Kunsttradition und die oppositionelle Haltung der jungen Künstler, die sich gegen die etablierte Kunstauffassung auflehnten. Die Gründung der Gruppe am 7. Juni 1905 durch vier Architekturstudenten wird detailliert dargestellt, wobei deren autodidaktische Herangehensweise an die bildende Kunst betont wird. Das Kapitel unterstreicht den Wunsch der Künstler nach neuen Wegen in der Kunst und nach einer Abkehr von der konventionellen, als realitätsfern empfundenen Akademiekunst.
3 Das Programm: Dieses Kapitel analysiert das Programm der „Brücke“-Künstlergemeinschaft, das von Kirchner in Holz geschnitzt wurde. Es beschreibt den Aufruf an die Jugend, sich gegen die etablierte Kunstauffassung aufzulehnen und neue, natürliche und unverfälschte Wege in der Kunst zu beschreiten. Die Bedeutung der „Jugend“ als Symbol für Neuanfang und Revolution wird hervorgehoben, ebenso wie die Betonung künstlerischer Aufrichtigkeit und die Bedeutung der finanziellen Unterstützung durch Passivmitglieder. Der eher unverbindliche Charakter des Programms wird betont, das weniger ein festes Ziel als vielmehr eine Auflehnung gegen künstlerische Einengung darstellte.
Schlüsselwörter
Künstlergruppe Brücke, Expressionismus, Holzschnitt, Druckgraphik, Akademische Kunst, Jugend, Programm, Motivwahl, Arbeitsmethoden, Gruppenstil, Dresden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Künstlergruppe Brücke und ihrem Holzschnittwerk
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das druckgraphische Werk, insbesondere den Holzschnitt, der Künstlergruppe „Brücke“ im Kontext des deutschen Expressionismus. Analysiert werden Motivwahl, Arbeitsweise und Bedeutung des Holzschnitts für die „Brücke“-Künstler im Vergleich zu anderen Werken.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie den Holzschnitt als zentrales Medium des Expressionismus, die Gründung und das Programm der „Brücke“-Künstlergemeinschaft, die Abgrenzung von der akademischen Kunsttradition, die Arbeitsmethoden und den Gruppenstil der „Brücke“ sowie den Einfluss des Holzschnitts auf die Entwicklung des Expressionismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu den Anfängen der „Brücke“ in Dresden, dem Programm der Gruppe, der Entwicklung bis zur Auflösung 1913 (inkl. Nachwirkungen), und einem Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Zusammenfassung.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, hebt die Bedeutung des Holzschnitts für den deutschen Expressionismus hervor, stellt die Forschungsfragen und den methodischen Ansatz vor und verortet den Holzschnitt der „Brücke“ in der Kunstgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Bedeutung der „Brücke“-Künstler als Erneuerer des deutschen Holzschnitts wird betont.
Was erfahren wir über die Anfänge der „Brücke“ in Dresden?
Das Kapitel beschreibt die Entstehung der „Brücke“-Gemeinschaft in Dresden um die Jahrhundertwende, den Kontext der akademischen Kunsttradition und die oppositionelle Haltung der jungen Künstler. Die Gründung der Gruppe am 7. Juni 1905 und die autodidaktische Herangehensweise der Künstler werden detailliert dargestellt.
Was beinhaltet das Kapitel zum Programm der „Brücke“?
Dieses Kapitel analysiert das von Kirchner in Holz geschnittene Programm der Gruppe. Es beschreibt den Aufruf an die Jugend, sich gegen etablierte Kunstauffassungen aufzulehnen, die Bedeutung der „Jugend“ als Symbol für Neuanfang und Revolution, künstlerische Aufrichtigkeit und die finanzielle Unterstützung durch Passivmitglieder. Der eher unverbindliche Charakter des Programms wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Künstlergruppe Brücke, Expressionismus, Holzschnitt, Druckgraphik, Akademische Kunst, Jugend, Programm, Motivwahl, Arbeitsmethoden, Gruppenstil, Dresden.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Die Arbeit enthält Zusammenfassungen der Einleitung, des Kapitels zu den Anfängen der „Brücke“ in Dresden und des Kapitels zum Programm der Gruppe. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die jeweiligen Inhalte.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist in der gegebenen Textvorlage nicht explizit aufgeführt, aber es ist implizit, dass ein abschließendes Kapitel eine Synthese der Ergebnisse und Schlussfolgerungen liefern wird.)
- Quote paper
- Hannah Gerten (Author), 2013, Der Holzschnitt der Künstlergemeinschaft "Brücke", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232083