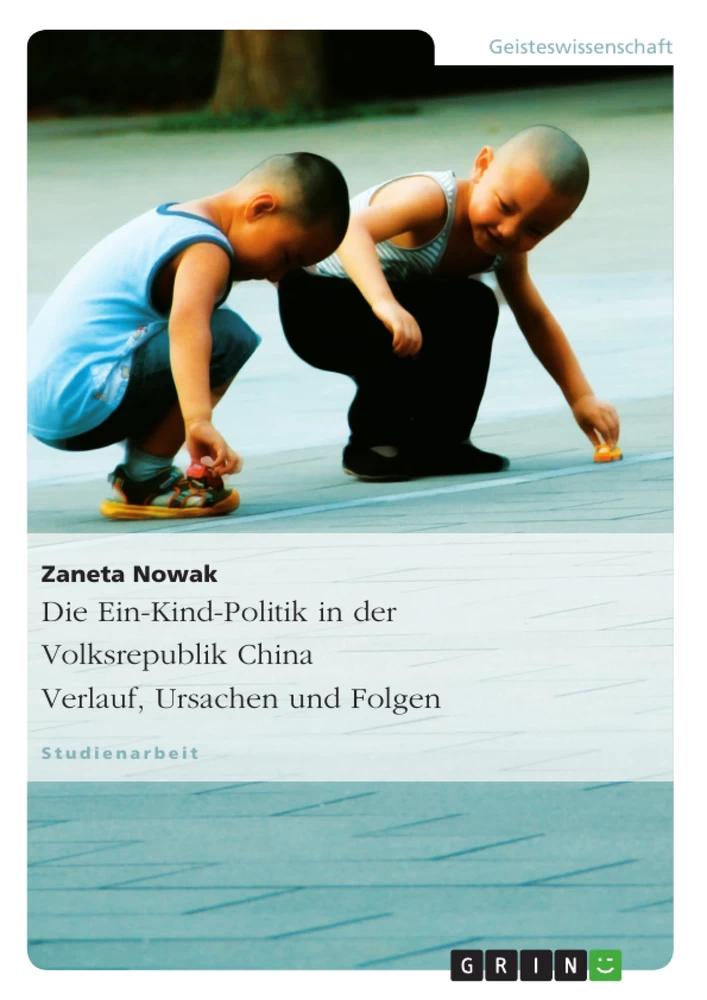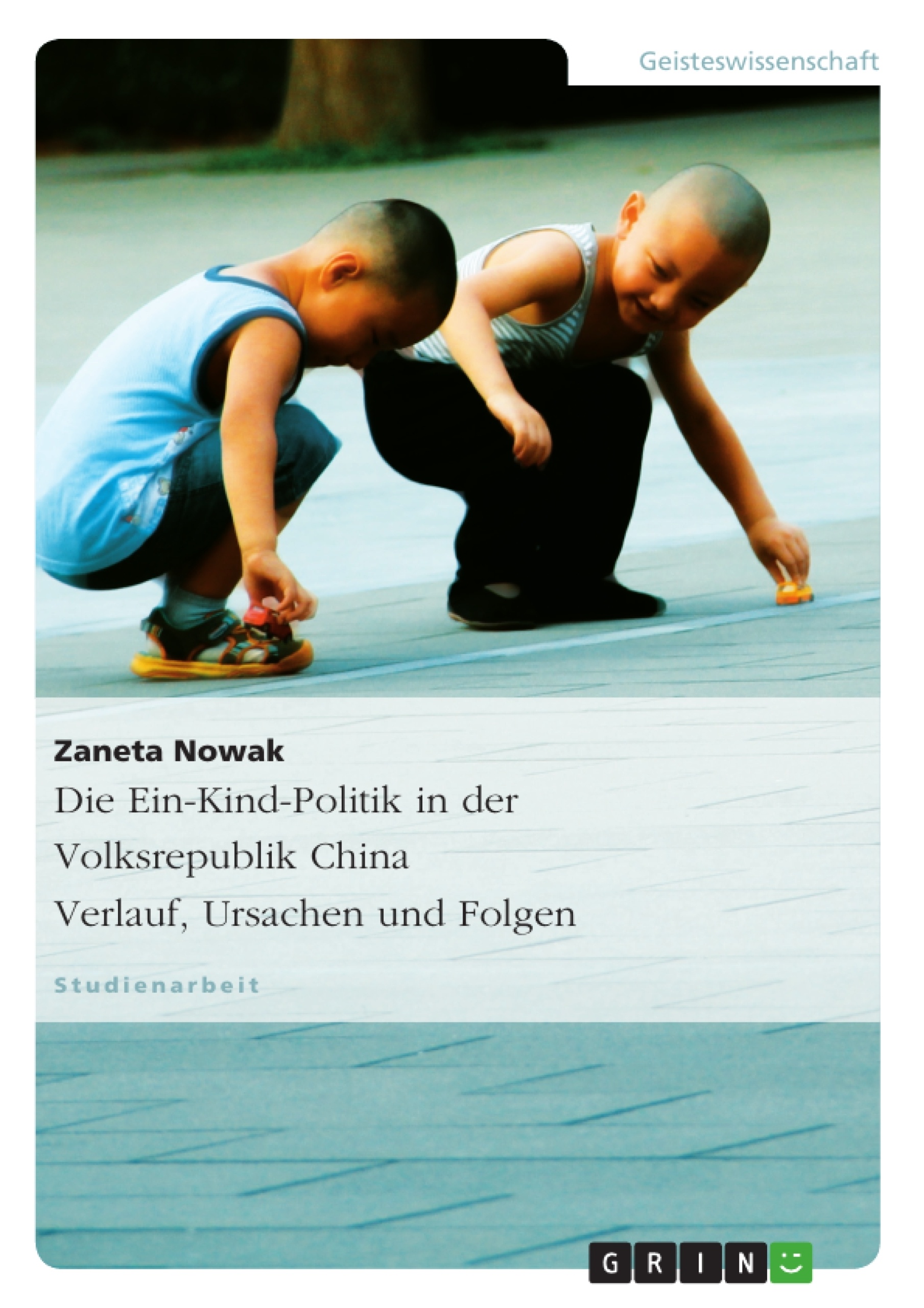Wie es der Titel dieser Arbeit bereits zu implizieren vermag, behandelt sie das Thema der Ein-Kind-Politik Chinas. Um dem schnellen Populationswachstum der Volksrepublik entgegenzuwirken, welche mit 1 Milliarde Einwohnern (Greenhlagh 2005: 260) bereits seit Jahrzehnten zum bevölkerungsreichsten Land zählte (Pierk S:1) und es vor einem Babyboom und der daraus resultierenden Knappheit an Ressourcen, Hungersnöten oder Naturkatastrophen zu bewahren, rief die Regierung im Jahr 1979 die One-child-policy ins Leben. Da die kommunistische Staatsgewalt seit jeher der Meinung war, dass die Angelegenheiten einer Familie und somit auch der Kinderplanung zu ihren Interessesphären gehörten, griff sie zu radikalen Methoden: „China takes the position that individual childbearing is a matter to be decided by the state for the good society as a whole“ (Greenhlagh 1994:7). Deren Ziel war es, die Fertilitätsrate mit unterschiedlichen Zwangsmaßnahmen und Prozeduren zu kontrollieren. Sowohl Song Jian, Entwickler dieser Idee (Greenhalgh 2005 :257), als auch die Regierung versprachen sich damit die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2000 auf 1.2 Milliarden zu begrenzen: „[...] to promote modernization by reducing the number of people who must compete for resources, both in the family and the nation“ (Fong 2002:1100).
Zu Beginn der Arbeit wird zuerst der soziopolitische und kulturelle Hintergrund Chinas erläutert, sowie die Ursachen die zu dem Beschluss geführt haben. Im Anschluss wird auf den Verlauf der Ein-Kind-Politik eingegangen, bevor abschließend die demographischen und sozialen Auswirkungen der Politik besprochen werden, die sich im Laufe der Jahre innerhalb der chinesischen Gesellschaft auf Basis dieser Normierung herauskristalisiert haben. Bei der Behandlung dieser Thematik wird der Fokus auf der staatlichen Geburtenkontrolle in Hinblick auf die Frauen liegen, da im Grunde genommen gerade sie als bloße Instrumente und Mittel zur Durchführung des Reglement dienten, von dem sie familiäre, soziale, psychische und körperliche Schäden trugen und es auch gegenwärtig tun. Dieser Verlauf wird vorwiegend an verschiedenen Fallbeispielen ländlicher Gegenden demonstriert, da hinsichtlich der dortigen familiären und wirtschaftlichen Situation die Durchsetzung auf einen größeren Widerstand traf und dementsprechend nach wie vor dort vielfältiger ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Signifikanz des Geschlechts
- Die staatliche Geburtenkontrolle
- Vorbereitungs- und Übergangsphase
- Verlauf
- Anreize
- Sanktionen
- Milderung der Maßnahmen
- Umsetzungsprobleme
- Widerstand
- Auswirkungen
- Resonanz
- Verzerrte Geschlechterproportion
- Soziokultureller Wandel
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ein-Kind-Politik der Volksrepublik China und analysiert deren Verlauf, Ursachen und Folgen. Sie untersucht die demographischen und sozialen Auswirkungen der Politik auf die chinesische Gesellschaft, insbesondere auf Frauen, die als zentrale Akteure der Geburtenkontrolle fungierten. Die Arbeit beleuchtet die staatlichen Zwangsmaßnahmen und die Reaktionen der Bevölkerung auf die Politik, wobei der Fokus auf ländlichen Regionen liegt.
- Die Bedeutung des Geschlechts in der chinesischen Gesellschaft und die daraus resultierende Bevorzugung von Söhnen.
- Die staatliche Geburtenkontrolle als Instrument zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums.
- Die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik auf die Geschlechterproportion in China.
- Der soziokulturelle Wandel in China, der durch die Ein-Kind-Politik beeinflusst wurde.
- Die Widerstandsaktionen der Bevölkerung gegen die Ein-Kind-Politik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Ein-Kind-Politik ein und erläutert den soziopolitischen und kulturellen Hintergrund Chinas. Sie beleuchtet die Ursachen für die Einführung der Politik und skizziert den Verlauf der Arbeit.
Das Kapitel "Die Signifikanz des Geschlechts" analysiert die traditionelle Bedeutung des Geschlechts in der chinesischen Gesellschaft, insbesondere in ländlichen Regionen. Es beleuchtet die Bevorzugung von Söhnen aufgrund von familiären und sozioökonomischen Faktoren.
Das Kapitel "Die staatliche Geburtenkontrolle" beschreibt die verschiedenen Phasen der Geburtenkontrolle in China, beginnend mit den Vorbereitungen und der Übergangsphase. Es analysiert die Einführung der Ein-Kind-Politik, die verschiedenen Anreize und Sanktionen, die zur Durchsetzung der Politik eingesetzt wurden, sowie die Milderung der Maßnahmen und die damit verbundenen Umsetzungsprobleme.
Das Kapitel "Auswirkungen" beleuchtet die demographischen und sozialen Folgen der Ein-Kind-Politik. Es analysiert die Auswirkungen auf die Geburtenrate, die Geschlechterproportion und den soziokulturellen Wandel in China.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Ein-Kind-Politik, die Geburtenkontrolle, die Geschlechterproportion, die soziale und demographische Entwicklung Chinas, die traditionelle chinesische Familienvorstellung, die Rolle der Frauen, die Widerstandsaktionen der Bevölkerung und die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik auf die chinesische Gesellschaft.
- Quote paper
- Zaneta Nowak (Author), 2009, Die Ein-Kind-Politik in der Volksrepublik China. Verlauf, Ursachen und Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231738