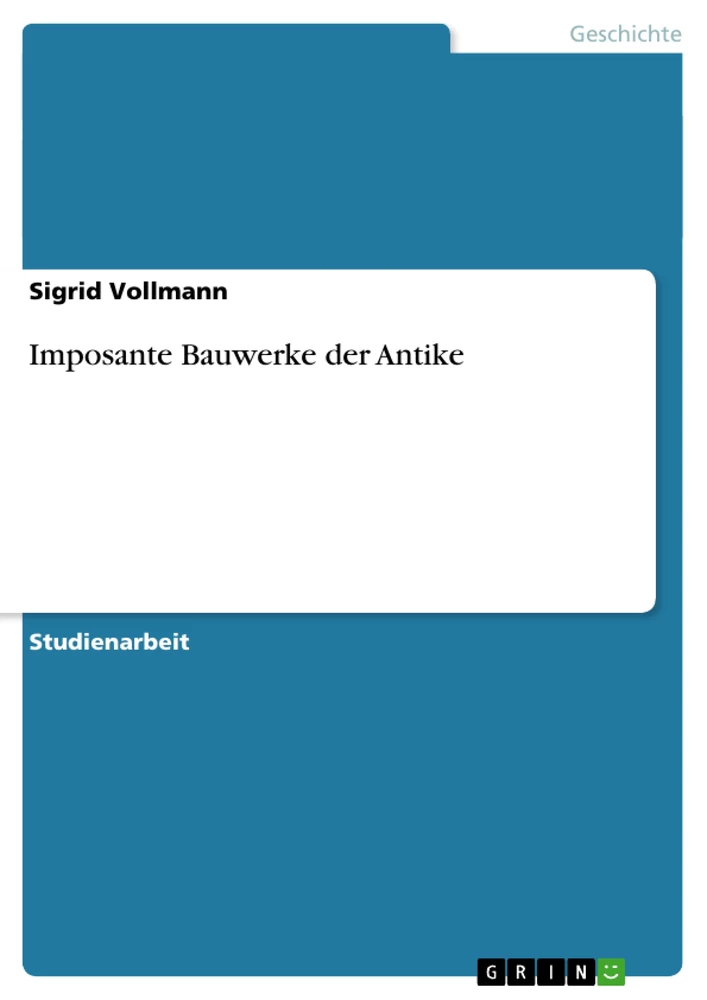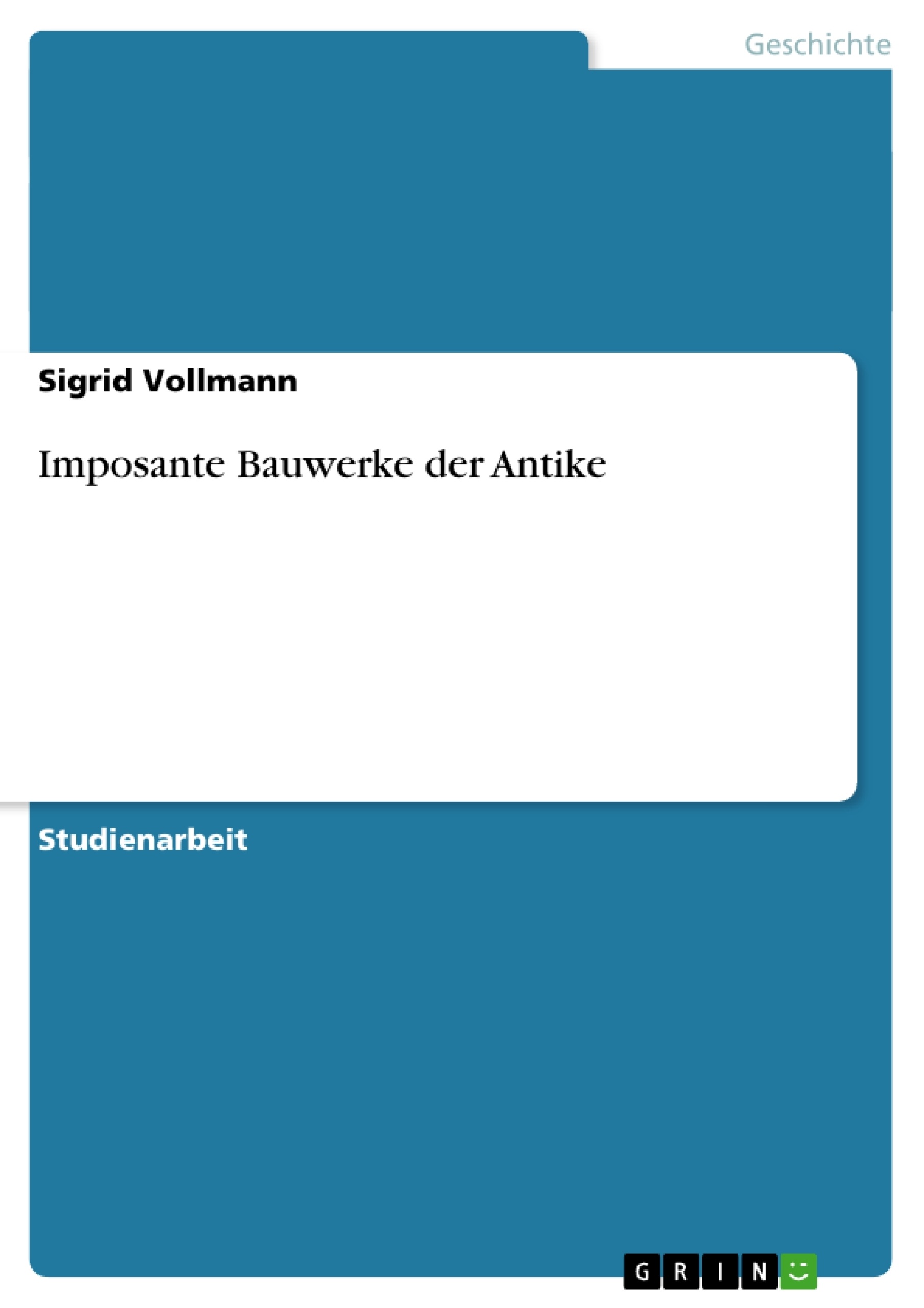Jeder kann die Sieben Weltwunder und einige andere bekannte, imposante Bauwerke der Antike aufzählen, doch kaum jemand weiß näheres darüber. Welche sind noch erhalten, welche Funde gibt es? Wie lassen sich diese BAuwerke rekonstruieren und mit welchen Methoden wurden in der damaligen Zeit diese Bauwekre gemacht?
Inhaltsverzeichnis
- Sieben Weltwunder
- Zeustempel
- Zeusstatue
- Cheopspyramide
- Pyramidenkomplex
- Chephren Pyramide
- Pyramidenbezirk
- Mykerinos Pyramide
- Pyramidenkomplex
- Die Mauern von Babylon
- Die Hängenden Gärten
- Koloss von Rhodos
- Mausoleum von Halikarnassos
- Artemision – Tempel der Diana Artemis in Ephesos
- Pharos – der Leuchtturm von Alexandrien
- Asklepieion: Asklepios-Heiligtum
- Kolosseum
- Stonehenge
- Newgrange
- Schatzhaus des Atreus
- Parthenon
- Giebeln
- Metopen
- Mykene und Tiryns
- Galerien
- Palast
- Mittelburg
- Westtreppenanlage
- Pantheon
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erforschung und Beschreibung antiker Weltwunder und bedeutender Bauwerke. Ziel ist es, einen detaillierten Einblick in die Geschichte, Architektur, Bautechniken und kulturelle Bedeutung dieser Monumente zu geben.
- Die Architektur antiker Kulturen
- Bautechniken und -materialien der Antike
- Die kulturelle und religiöse Bedeutung der Bauwerke
- Die Geschichte und der Verfall der Weltwunder
- Mythen und Legenden im Zusammenhang mit den Bauwerken
Zusammenfassung der Kapitel
Sieben Weltwunder: Der Text beginnt mit einer Erläuterung der verschiedenen Listen der sieben Weltwunder der Antike, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die unterschiedlichen Quellen und deren Widersprüche bezüglich der Zusammensetzung werden beleuchtet, unterstreichend, wie die Auswahl der Wunder kulturellen und zeitlichen Strömungen unterlag.
Zeustempel: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Zeustempel in Olympia, sein Bau, seine Architektur (Ringhallentempel mit 6x13 Säulen), Baumaterialien (Muschelkalk, Marmor), und die berühmten Skulpturen, insbesondere die kolossale Zeus-Statue des Phidias aus Gold und Elfenbein, die als eines der sieben Weltwunder galt. Es wird auch auf die Rekonstruktion einer Säule im Rahmen der Olympischen Spiele 2004 eingegangen.
Cheopspyramide: Die Cheopspyramide, das größte und älteste der drei Pyramiden von Gizeh, wird hier ausführlich behandelt. Der Text beleuchtet den Bauprozess, die verwendeten Materialien (Kalkstein, Basalt), die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen, die inneren Strukturen (Felsenkammer, Königinnenkammer, Königskammer), und die verschiedenen Theorien über den Transport der riesigen Steinblöcke und die Baumethode (Rampensystem oder Hebezeuge). Die unterschiedlichen historischen Quellen (Herodot, Strabon) und ihre jeweiligen Interpretationen werden gegenübergestellt.
Pyramidenkomplex: Dieses Kapitel erweitert den Fokus auf den gesamten Pyramidenkomplex von Gizeh, einschließlich des Totentempels, des Taltempels, der Königinnenpyramiden und der Sphinx. Die verschiedenen Theorien über die Funktionen der einzelnen Bauwerke werden diskutiert, sowie die Fragen um den Bau, die Materialien und die Symbole.
Chephren Pyramide: Die Chephrenpyramide, die zweitgrößte Pyramide von Gizeh, wird in diesem Kapitel detailliert beschrieben. Der Text analysiert die Architektur, die Bautechnik, die verwendeten Materialien und vergleicht sie mit der Cheopspyramide. Der Fokus liegt auf dem Pyramidenbezirk, dem Totentempel und der Sphinx, inklusive der Debatte um deren Funktion und Bedeutung.
Mykerinos Pyramide: Die kleinste der drei großen Pyramiden von Gizeh wird hier betrachtet. Die Unterschiede im Vergleich zu den anderen Pyramiden, insbesondere die Größe und die Bauweise, werden erörtert. Die unterschiedlichen Theorien über die Gründe für die geringere Größe der Pyramide werden untersucht. Der Pyramidenkomplex mit dem Totentempel und den Nebenpyramiden wird ebenfalls behandelt.
Die Mauern von Babylon: Die beeindruckenden Mauern von Babylon werden beschrieben, einschließlich der unterschiedlichen Beschreibungen der antiken Quellen (Herodot, Theresias, Strabon, Beressos) und der Diskrepanzen in ihren Angaben über die Höhe, Breite und Anzahl der Tore und Türme. Der Text hebt die Bedeutung der Mauern als Verteidigungsanlage hervor.
Die Hängenden Gärten: Dieses Kapitel behandelt die legendären Hängenden Gärten von Babylon, einschließlich der verschiedenen antiken Quellen (Beressos, Diodoros Sikulos, Ktesias von Knidos, Strabon, Philon von Byzanz) und ihrer Beschreibungen. Die verschiedenen Theorien über den Standort und die Funktion der Gärten werden diskutiert, ebenso die Frage, ob es sich um eine reale oder eine legendäre Konstruktion handelt.
Koloss von Rhodos: Der Koloss von Rhodos, eine riesige Statue des Sonnengottes Helios, wird im Detail untersucht. Der Text untersucht Vorbilder, die Bauweise, die verwendeten Materialien (Bronze, Eisen), die verschiedenen Theorien über seinen Standort und die ikonographischen Merkmale. Die verschiedenen Legenden und historischen Berichte über den Bau und den Untergang werden analysiert.
Mausoleum von Halikarnassos: Das Mausoleum, ein prächtiges Grabmal für König Maussolos, wird beleuchtet. Die Beschreibung konzentriert sich auf die Architektur, die beteiligten Künstler (Bryaxis, Pytheos, Leochares, Timotheos/Praxiteles, Skopas) und die Verwendung verschiedener Materialien und Bautechniken. Die Geschichte des Mausoleums und seine Zerstörung werden ebenfalls detailliert behandelt.
Artemision – Tempel der Diana Artemis in Ephesos: Dieses Kapitel beschreibt den Tempel der Artemis in Ephesos, einschließlich seiner Baugeschichte, der verwendeten Materialien und Techniken sowie der Legenden um seinen Bau. Die Zerstörung durch Herostratos und der spätere Wiederaufbau werden erörtert.
Pharos – der Leuchtturm von Alexandrien: Der berühmte Leuchtturm von Alexandrien, eines der sieben Weltwunder, wird untersucht. Der Text beschreibt seine Architektur, den Aufbau in verschiedenen Stockwerken, die verwendeten Materialien (Granit, Marmor, Bronze), und seinen Untergang.
Asklepieion: Asklepios-Heiligtum: Das Asklepieion in Pergamon, ein Heiligtum des Heilgottes Asklepios, wird vorgestellt. Der Text beleuchtet die Geschichte, den Aufbau, die verschiedenen Bauphasen und die Funktionen der einzelnen Gebäudeteile (Inkubationshallen, Theater, Bibliothek). Die Bedeutung des Heiligtums als Kultstätte und dessen Verfall wird ebenso thematisiert.
Kolosseum: Das Kapitel widmet sich dem Flavischen Amphitheater, dem Kolosseum. Die Architektur, Bauweise, Materialien, die Funktionen als Veranstaltungsort und seine Geschichte vom Bau bis zur Verwendung als Steinbruch werden detailliert dargestellt. Die Inschriften und deren Bedeutung sowie die Verwendung des Kolosseums im Mittelalter und die spätere Funktion als Gedenkstätte werden behandelt.
Stonehenge: Dieses Kapitel behandelt Stonehenge, ein prähistorisches Monument. Der Text beschreibt den Aufbau, die verwendeten Materialien (Sandstein, Blausteine), die verschiedenen Bauphasen und die verschiedenen Theorien über die Funktion von Stonehenge (Friedhof, Heiligtum).
Newgrange: Newgrange, ein gewaltiger Hügelgrab, wird hier vorgestellt, mit einer Beschreibung der Architektur, der verwendeten Materialien und den Theorien über seine Funktion als Grabmal und seine Bedeutung in der Megalithkultur. Menhire als verwandte Bauform werden kurz erwähnt.
Schatzhaus des Atreus: Das Schatzhaus des Atreus, ein mykenisches Kuppelgrab, wird detailliert beschrieben. Der Text behandelt die Architektur, die Bautechnik, die verwendeten Materialien und die Bedeutung als Grabmal eines wohlhabenden Herrschers. Die Legende um Atreus wird ebenfalls erzählt.
Parthenon: Der Parthenon, ein dorischer Tempel der Athena Parthenos, wird beschrieben. Der Text behandelt die Baugeschichte, die Architektur (Dorischer und Ionischer Stil), die berühmte Kultstatue des Pheidias und die Skulpturen der Giebel und Metopen.
Giebeln und Metopen: Die Skulpturen der Giebel und Metopen des Parthenon werden im Detail analysiert, wobei die dargestellten Szenen und deren Bedeutung im Kontext der griechischen Mythologie erläutert werden.
Mykene und Tiryns: Die mykenischen Städte Mykene und Tiryns werden betrachtet, mit Schwerpunkt auf den Kyklopenmauern, der Architektur und den Bauweisen. Die Funktion der einzelnen Bauteile (Palast, Galerien, Mittelburg, Westtreppenanlage) wird ebenfalls erläutert.
Galerien, Palast, Mittelburg und Westtreppenanlage: Diese Abschnitte detaillieren die einzelnen Gebäudeteile der mykenischen Palastanlagen, wobei die Architektur, Bauweise und Funktion im Fokus stehen.
Pantheon: Das Pantheon in Rom wird abschließend präsentiert, mit einer Beschreibung der Architektur, der Bautechnik und der Materialien. Die Geschichte des Pantheons und seine verschiedenen Bauphasen werden ebenso thematisiert.
Schlüsselwörter
Weltwunder, Antike, Architektur, Bautechnik, Materialien, Mythen, Legenden, Geschichte, Olympia, Gizeh, Babylon, Rhodos, Halikarnassos, Ephesos, Alexandrien, Pergamon, Kolosseum, Stonehenge, Mykene, Tiryns, Pantheon, Pheidias, Herodot, Strabon, Kalkstein, Marmor, Granit, Bronze, Kyklopenmauern, Megalithkultur.
Häufig gestellte Fragen zum Text über Antike Weltwunder und Bauwerke
Welche Themen werden in diesem Text behandelt?
Der Text behandelt antike Weltwunder und bedeutende Bauwerke. Es werden deren Geschichte, Architektur, Bautechniken, kulturelle Bedeutung, sowie Mythen und Legenden im Zusammenhang mit den Bauwerken erforscht und beschrieben. Die behandelten Bauwerke umfassen die Sieben Weltwunder der Antike (mit unterschiedlichen Interpretationen der Listen), den Zeustempel in Olympia, die Pyramiden von Gizeh (Cheops-, Chephren- und Mykerinos-Pyramide), die Mauern von Babylon, die Hängenden Gärten von Babylon, den Koloss von Rhodos, das Mausoleum von Halikarnassos, den Tempel der Artemis in Ephesos, den Leuchtturm von Alexandrien, das Asklepieion in Pergamon, das Kolosseum, Stonehenge, Newgrange, das Schatzhaus des Atreus, den Parthenon, die mykenischen Städte Mykene und Tiryns, und das Pantheon in Rom.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Ziel des Textes ist es, einen detaillierten Einblick in die Geschichte, Architektur, Bautechniken und kulturelle Bedeutung der beschriebenen antiken Monumente zu geben. Es werden die Architektur antiker Kulturen, Bautechniken und -materialien, die kulturelle und religiöse Bedeutung der Bauwerke, deren Geschichte und Verfall, sowie Mythen und Legenden im Zusammenhang mit ihnen untersucht.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Der Text ist in Kapitel unterteilt, die sich jeweils einem spezifischen Bauwerk oder einem thematischen Komplex widmen. Jedes Kapitel beschreibt detailliert die Architektur, die Bauweise, die verwendeten Materialien, die Geschichte und die Bedeutung des jeweiligen Bauwerks. Es werden unterschiedliche historische Quellen und Theorien verglichen und diskutiert, um ein umfassendes Bild zu vermitteln. Die Zusammenfassungen der Kapitel im Inhaltsverzeichnis geben einen guten Überblick über die einzelnen Themen.
Welche antiken Quellen werden im Text verwendet?
Der Text bezieht sich auf zahlreiche antike Quellen, wie Herodot, Strabon, Beressos, Diodoros Sikulos, Ktesias von Knidos, Philon von Byzanz und andere, um die Beschreibungen und Interpretationen der Bauwerke zu belegen und zu vergleichen. Die Unterschiede und Widersprüche in den antiken Berichten werden ebenfalls thematisiert.
Welche Bautechniken und Materialien werden beschrieben?
Der Text beschreibt eine Vielzahl von Bautechniken und Materialien, die in der Antike verwendet wurden. Dazu gehören beispielsweise der Einsatz von Kalkstein, Marmor, Granit, Bronze, Basalt, die Errichtung von Ringhallentempeln, die Konstruktion von Pyramiden mit verschiedenen Methoden (Rampensysteme oder Hebezeuge), der Bau von Kuppelgräbern und die Errichtung von mächtigen Stadtmauern. Die spezifischen Techniken und Materialien werden für jedes einzelne Bauwerk detailliert erläutert.
Welche kulturelle und religiöse Bedeutung haben die Bauwerke?
Der Text hebt die kulturelle und religiöse Bedeutung der einzelnen Bauwerke hervor. Viele der beschriebenen Strukturen dienten kultischen Zwecken (Tempel, Heiligtümer), während andere die Macht und den Reichtum von Herrschern symbolisierten (Pyramiden, Mausoleen). Die Mythen und Legenden, die mit den Bauwerken verbunden sind, werden ebenfalls beleuchtet und in den Kontext ihrer kulturellen Bedeutung eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Textes?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Textes treffend beschreiben, sind: Weltwunder, Antike, Architektur, Bautechnik, Materialien, Mythen, Legenden, Geschichte, Olympia, Gizeh, Babylon, Rhodos, Halikarnassos, Ephesos, Alexandrien, Pergamon, Kolosseum, Stonehenge, Mykene, Tiryns, Pantheon, Pheidias, Herodot, Strabon, Kalkstein, Marmor, Granit, Bronze, Kyklopenmauern, Megalithkultur.
- Quote paper
- Dr. Sigrid Vollmann (Author), 2012, Imposante Bauwerke der Antike, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231701