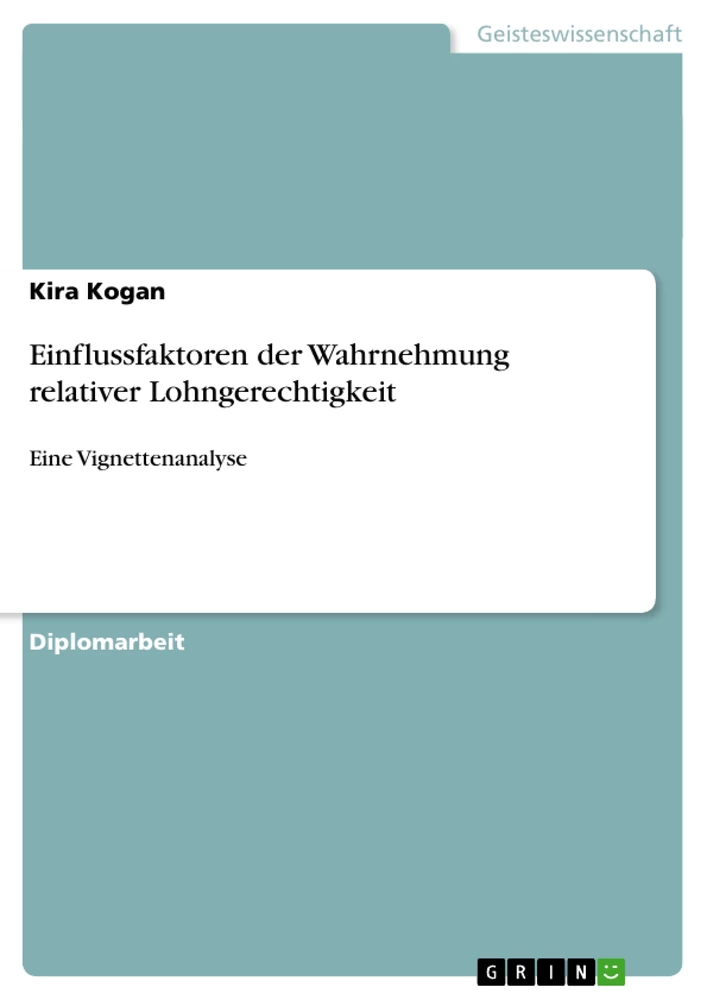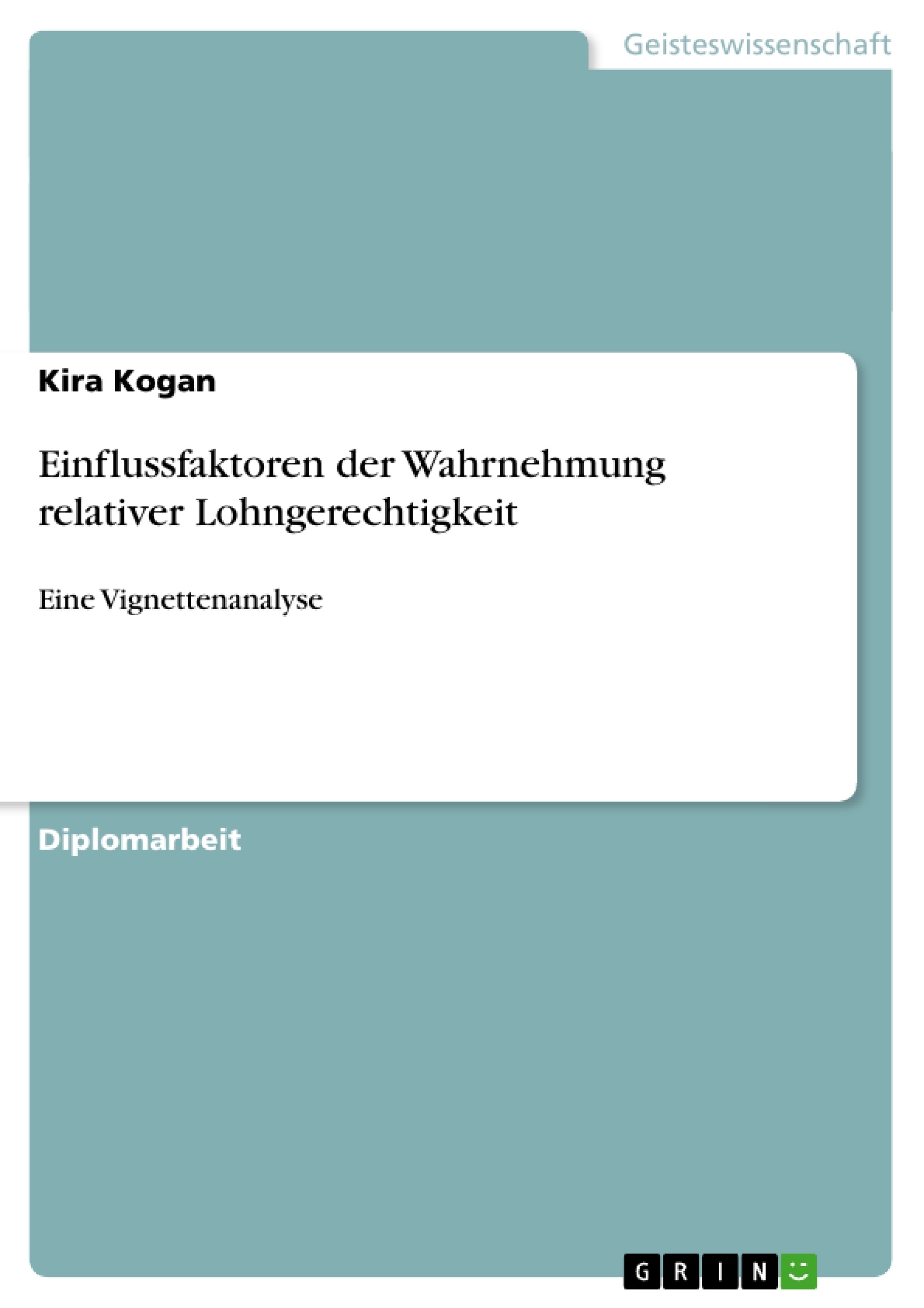Die wirtschaftliche Weltkrise der vergangenen Jahre hat weltweit zur Stagnation der Reallöhne geführt, was an eine Zunahme von Einkommensungleichheit geknüpft wurde (Busch 2009). Während sich die Wirtschaft mittlerweile schrittweise von der Depression erholt, bleibt die Frage der Einkommensverteilung und der relativen Einkommensgerechtigkeit in Deutschland so aktuell wie nie. Laut Ergebnissen der Studie von Hinz und Liebig (2010) bewerten 51,6 Prozent der Befragten die heutigen sozialen Ungleichheiten in Deutschland als „zu groß“ und 39,1 Prozent als „viel zu groß“ (Hinz und Liebig 2010, S. 5). Dabei bewerten mindestens 64 Prozent der Auskunftspersonen ihr eigenes Erwerbseinkommen als „ungerechterweise zu niedrig“ (Hinz und Liebig 2010, S. 9). Die Studienergebnisse von Liebig und Schupp aus den Jahren 2005 und 2007 zeigen, dass das subjektive Ungerechtigkeitsempfinden bezüglich des eigenen Netto-Erwerbseinkommens im Beobachtungszeitraum zugenommen hat. Während im Jahr 2005 insgesamt rund 26 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland ihr Erwerbseinkommen als ungerecht bewerteten, betrug 2007 der Anteil derjenigen, die ihr Einkommen als ungerecht einstuften bereits 35 Prozent (Liebig und Schupp 2008, S. 435).
Vor allem im mittleren und oberen Einkommensbereich wachsen die Ungerechtigkeitsgefühle bezüglich des eigenen Einkommens: 2005 waren 21 Prozent der Erwerbstätigen mit einem Bruttoeinkommen von 3000 Euro mit ihrem Lohn unzufrieden, 2007 ist die Zahl der unzufriedenen Beschäftigten dieser Einkommensklasse auf 36 Prozent gestiegen. Die niedrigsten Schichten der Gehaltsskala zeigen hingegen kein wachsendes Gefühl, ungerecht entlohnt zu werden. Der Verfasser der DIW-Studie, Jürgen Schupp, äußert die Meinung, dass dies an den sich unter der Bevölkerung verbreitenden Eindruck gebunden werden kann, dass hoher Arbeitseinsatz nicht unbedingt gutes Einkommen sichert, was das Leistungsprinzip der gerechten Einkommensverteilung verletzt. (Liebig und Schupp 2008). Informationen über die wachsende Kluft zwischen den Einkommen, die mit der Einkommensunzufriedenheit der abhängig Beschäftigten korrespondiert, liefert auch der Armutsbericht der Bundesregierung:
„Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, die zwischen 1,1 % und 2,0 % variierte, gingen die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer real zwischen 2002 und 2005 von durchschnittlich 24.873 Euro auf 23.684 Euro um 4,8 % zurück. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Theoretischer Teil
- 1 GERECHTIGKEITSKRITERIEN DER LOHNDIFFERENZIERUNG UND ARTEN DER LOHNGERECHTIGKEIT
- 1.1 LEISTUNGSPRINZIP UND LEISTUNGSGERECHTIGKEIT
- 1.2 ANFORDERUNGSGERECHTIGKEIT UND VERHALTENSGERECHTIGKEIT
- 1.3 LEISTUNGSPRINZIP UND MARKTGERECHTIGKEIT
- 1.4 BEDARFSPRINZIP UND BEDARFSGERECHTIGKEIT
- 2 THEORIEN DER VERTEILUNGSGERECHTIGKEIT
- 2.1 GLEICHHEITSPRINZIP UND THEORIE DES SOZIALEN VERGLEICHS
- 2.2 GLEICHHEITSPRINZIP UND EINKOMMENSGLEICHHEIT
- 2.3 THEORIE DES SOZIALEN VERGLEICHS UND STATUS-VALUE THEORIE
- 2.4 EQUITY-THEORIE UND LEISTUNGSGERECHTIGKEIT
- 2.5 HUMANKAPITAL THEORIE UND QUALIFIKATIONSGERECHTIGKEIT
- 3 STAND DER FORSCHUNG
- 3.1 Faktoren, die die Wahl eines Verteilungsprinzips beeinflussen
- 3.2 Empirische Studien zur Lohngerechtigkeit
- 4 HYPOTHESEN
- 4.1 Vignettenebene
- 4.1.1 Arbeitsbeitrag
- 4.1.2 Länge der Betriebszugehörigkeit und Bildungsgrad
- 4.1.3 Familienstand
- 4.2 Befragtenebene
- 4.2.1 Persönlichkeitsmerkmale
- 4.2.2 Arbeitstätigkeit
- 4.2.3 Unternehmenseigenschaften
- 4.2.4 Finanzielle Situation der Befragten
- 4.3 Interaktionseffekte
- 4.3.1 Effektstärke und Familienstand
- 4.3.2 Effektstärke und Bildungsgrad
- 4.3.3 Effektstärke und Alter
- 4.3.4 Effektstärke und Länge der Betriebszugehörigkeit
- 4.3.5 Effektstärke und Vorgesetztenfunktion
- 4.1 Vignettenebene
- 1 GERECHTIGKEITSKRITERIEN DER LOHNDIFFERENZIERUNG UND ARTEN DER LOHNGERECHTIGKEIT
- II Empirischer Teil
- 1 DATEN- UND METHODENVORSTELLUNG
- 1.1 Sekundäranalyse
- 1.2 Methode Faktorielle Survey
- 1.3 Datensatz
- 1.4 Operationalisierung
- 2 ERGEBNISSE
- 2.1 Deskriptive Ergebnisse
- 2.1.1 Korrelationskoeffizienten
- 2.1.2 Datenstruktur
- 2.2 Multivariate Ergebnisse
- 2.2.1 Vignettenebene
- 2.2.2 Befragtenebene
- 2.3 Interaktionseffekte
- 2.3.1 Effektstärke und Familienstand
- 2.3.2 Effektstärke und Bildungsgrad
- 2.3.3 Effektstärke und Alter
- 2.3.4 Effektstärke und Länge der Betriebszugehörigkeit
- 2.3.5 Effektstärke und Vorgesetztenfunktion
- 2.1 Deskriptive Ergebnisse
- 1 DATEN- UND METHODENVORSTELLUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit mittels einer Vignettenanalyse. Ziel ist es, die Bedeutung verschiedener Gerechtigkeitsprinzipien und deren Interaktion mit individuellen und situativen Faktoren zu analysieren.
- Gerechtigkeitsprinzipien bei der Lohndifferenzierung (Leistung, Anforderung, Bedarf)
- Theorien der Verteilungsgerechtigkeit (Equity-Theorie, Theorie des sozialen Vergleichs)
- Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Lohngerechtigkeit auf individueller und situativer Ebene
- Interaktionseffekte zwischen verschiedenen Einflussfaktoren
- Empirische Überprüfung der Hypothesen mittels einer Vignettenstudie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund der Studie vor dem Kontext der weltweiten Wirtschaftskrise und steigender Einkommensungleichheit. Sie verweist auf Studien, die eine wachsende Unzufriedenheit mit der eigenen Einkommenssituation in Deutschland aufzeigen, insbesondere im mittleren und oberen Einkommensbereich, und begründet damit die Relevanz der Forschungsfrage nach Einflussfaktoren der Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit. Die Einleitung legt den Fokus auf die zunehmende subjektive Wahrnehmung von Ungerechtigkeit im Bezug auf die Einkommensverteilung und dient als Grundlage für die darauffolgende Forschungsarbeit.
I Theoretischer Teil: Dieser Teil der Arbeit legt das theoretische Fundament für die empirische Untersuchung. Kapitel 1 beleuchtet verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien (Leistung, Anforderung, Bedarf) und ihre Anwendung auf die Lohndifferenzierung. Kapitel 2 präsentiert relevante Theorien der Verteilungsgerechtigkeit, einschließlich der Equity-Theorie und der Theorie des sozialen Vergleichs. Kapitel 3 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zu Einflussfaktoren auf die Wahl von Verteilungsprinzipien und empirische Studien zur Lohngerechtigkeit. Kapitel 4 formuliert schließlich Hypothesen, die im empirischen Teil der Arbeit getestet werden, sowohl auf der Ebene der Vignetten als auch der Befragten, inklusive Interaktionseffekten.
II Empirischer Teil: Der empirische Teil beschreibt die Methodik und Ergebnisse der Studie. Kapitel 1 detailliert die verwendete Methode (faktorielle Survey-Methode), den Datensatz und die Operationalisierung der Variablen. Kapitel 2 präsentiert die deskriptiven und multivariaten Ergebnisse der Analyse, getrennt nach Vignetten- und Befragtenebene sowie Interaktionseffekten. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und interpretiert, wobei die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Lohngerechtigkeit beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Lohngerechtigkeit, relative Lohngerechtigkeit, Gerechtigkeitsprinzipien, Equity-Theorie, Theorie des sozialen Vergleichs, Vignettenanalyse, Einkommensungleichheit, Einflussfaktoren, Empirische Sozialforschung, Arbeitsmarktsoziologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht die Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit. Sie analysiert die Bedeutung verschiedener Gerechtigkeitsprinzipien und deren Interaktion mit individuellen und situativen Faktoren.
Welche Gerechtigkeitsprinzipien werden betrachtet?
Die Studie betrachtet die Gerechtigkeitsprinzipien Leistung, Anforderung und Bedarf im Kontext der Lohndifferenzierung.
Welche Theorien der Verteilungsgerechtigkeit werden verwendet?
Die Studie stützt sich auf die Equity-Theorie und die Theorie des sozialen Vergleichs.
Welche Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Lohngerechtigkeit werden untersucht?
Die Studie untersucht Einflussfaktoren auf individueller (z.B. Persönlichkeitsmerkmale, Arbeitstätigkeit, finanzielle Situation) und situativer Ebene (z.B. Arbeitsbeitrag, Betriebszugehörigkeit, Bildungsgrad, Familienstand, Unternehmenseigenschaften). Interaktionseffekte zwischen diesen Faktoren werden ebenfalls analysiert.
Welche Methode wird verwendet?
Die Studie verwendet eine faktorielle Survey-Methode (Vignettenanalyse) mit Sekundäranalyse bestehender Daten.
Welche Daten werden verwendet?
Die Studie nutzt einen bestehenden Datensatz, der im Detail im empirischen Teil beschrieben wird.
Wie sind die Ergebnisse strukturiert?
Die Ergebnisse sind in deskriptive und multivariate Analysen unterteilt, getrennt nach Vignetten- und Befragtenebene sowie Interaktionseffekten. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und interpretiert.
Welche Hypothesen werden getestet?
Die Studie formuliert Hypothesen auf Vignetten- und Befragtenebene, einschließlich Interaktionseffekten zwischen verschiedenen Einflussfaktoren (z.B. Effektstärke und Familienstand, Bildungsgrad, Alter, Betriebszugehörigkeit, Vorgesetztenfunktion).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Lohngerechtigkeit, relative Lohngerechtigkeit, Gerechtigkeitsprinzipien, Equity-Theorie, Theorie des sozialen Vergleichs, Vignettenanalyse, Einkommensungleichheit, Einflussfaktoren, Empirische Sozialforschung, Arbeitsmarktsoziologie.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie besteht aus einem theoretischen und einem empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt Gerechtigkeitsprinzipien, Theorien der Verteilungsgerechtigkeit und den Stand der Forschung. Der empirische Teil beschreibt die Methode, den Datensatz, die Operationalisierung und die Ergebnisse der Analyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Ziel der Studie ist es, die Bedeutung verschiedener Gerechtigkeitsprinzipien und deren Interaktion mit individuellen und situativen Faktoren für die Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit zu analysieren.
- Quote paper
- Diplom-Sozialwissenschaftlerin Kira Kogan (Author), 2012, Einflussfaktoren der Wahrnehmung relativer Lohngerechtigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231215