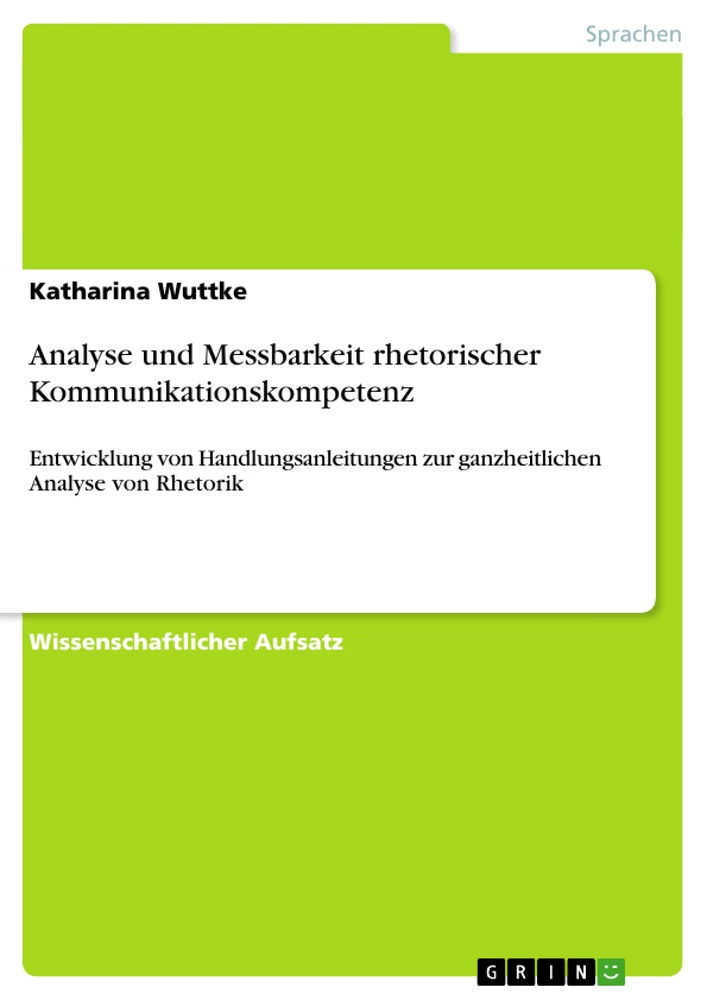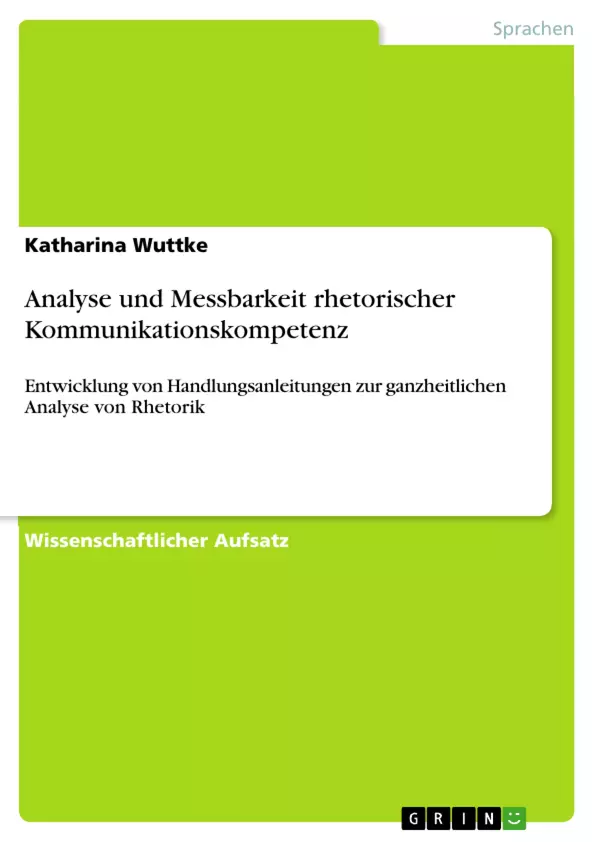Wie lässt sich rhetorische Kommunikationskompetenz messen und bewerten? Dieser Frage geht die vorliegende Arbeit nach. In Anbetracht der Tatsache, dass Rhetorik die älteste Kommunikationswissenschaft der Welt ist und rhetorische Kompetenz in unserer Gesellschaft als Schlüsselqualifikation gilt, ist es verwunderlich, dass sich bislang kaum Forscher diesem Thema gewidmet haben und es keine etablierte Methode zur Rhetorikanalyse gibt. Die bestehenden Ansätze zur rhetorischen Analyse stammen größtenteils aus dem US-amerikanischen Raum und sind entweder veraltet oder beziehen sich lediglich auf einen Teilbereich der Analyse – meist auf die Textanalyse und hier im Besonderen auf den Einsatz rhetorischer Figuren oder auf die Argumentation.
Die wissenschaftliche Inhaltsanalyse erfreut sich zwar immer größerer Beliebtheit, hält aber bislang auch keine Methode bereit, die alle notwendigen Analyse- Bereiche – also beispielsweise auch die non- und paraverbale Kommunikation – zu einer Methode zusammenfügt, mit der sich rhetorische Fähigkeiten im Ganzen analysieren und messen ließen. Diesem Desiderat widmet sich der vorliegende wissenschaftliche Projektbericht. Die Arbeit geht zunächst der Frage nach, welche Methoden und Theorien aus unterschiedlichen Fachbereich bereits zur Verfügung stehen, um rhetorische Fähigkeiten zu messen und zu bewerten. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden am Ende der Arbeit Handlungsempfehlungen zur ganzheitlichen Analyse von Rhetorik entwickelt, die sowohl den Redetext, als auch die Argumentation, die Körpersprache, die Gestik und die Mimik, die Stimme, die Präsentationsform und viele weitere Faktoren berücksichtigen.
Unter rhetorischer Kommunikationskompetenz wird in diesem Zusammenhang die Fähigkeit verstanden, Sachverhalte in Reden oder öffentlichen Sprechsituationen durch Verwendung sprachlicher Zeichen verständlich, überzeugend und souverän darstellen zu können.1 Problematisch aus Sicht der Wissenschaft ist daran, dass diese Fähigkeiten nicht direkt sichtbar sind, also empirisch durch Beobachtung nicht erschlossen werden können. Insofern benötigt ein Forscher, der Rhetorik messen und bewerten will, gute Analyse- und Interpretationsfähigkeiten. Gleichzeitig besteht die Herausforderung bei der Entwicklung einer Methode zur ganzheitlichen Rhetorikanalyse darin, möglichst alle notwendigen Faktoren mit einzubeziehen, den Forscher aber gleichzeitig nicht zu stark einzuengen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definition und thematische Einordnung von Rhetorik
- 2.1 (Rhetorische) Kommunikation
- 3. Methoden aus verschiedenen Fachbereichen zur Analyse von Rhetorik
- 3.1 Sprachliche Wirkung der Rede: Linguistische Analyse
- 3.1.1 Gesprächsanalyse nach Deppermann
- 3.1.2 Semantische, syntaktische & pragmatische Textanalyse
- 3.1.3 Stilanalyse (Analyse rhetorischer Stilmittel)
- 3.1.4 Lesbarkeitsindex nach Flesch
- 3.2 Überzeugungsfähigkeit der Rede: Die Argumentationsanalyse
- 3.2.1 Aristotelische Toposanalyse
- 3.2.2 Moderne Argumentationsanalyse-Ansätze
- 3.3 Die Funktion(en) der Rede: Kommunikationsmodelle
- 3.3.1 Lasswell-Formel
- 3.3.2 Organonmodell von Bühler
- 3.3.3 Theorie des kommunikativen Handelns nach Habermas
- 3.3.4 Grice'sche Konversationsmaxime
- 3.4 Rede und Persuasion: (Sozial-) Psychologische Ansätze
- 3.4.1 Impression-Management-Theorie nach Goffman
- 3.4.2 Yale-Ansatz der Forschergruppe um Hovland
- 3.4.3 Halo-Effekte
- 3.4.4 Elaboration-Likelihood-Model von Petty und Cacioppo
- 3.4.5 Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger
- 3.1 Sprachliche Wirkung der Rede: Linguistische Analyse
- 4. Handlungsempfehlungen zur ganzheitlichen Analyse von Rhetorik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz und zielt auf die Entwicklung von Handlungsanleitungen für eine ganzheitliche Rhetorikanalyse ab. Der Mangel an etablierten Methoden zur umfassenden Analyse rhetorischer Fähigkeiten in der Forschung motiviert dieses Projekt. Die bestehenden Ansätze sind oft unvollständig oder veraltet.
- Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz
- Entwicklung einer ganzheitlichen Methode zur Rhetorikanalyse
- Integration verschiedener Analysemethoden aus unterschiedlichen Fachbereichen (Linguistik, Argumentationsanalyse, Kommunikationswissenschaft, Psychologie)
- Berücksichtigung verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation
- Erstellung von Handlungsempfehlungen für eine umfassende Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Diese Einführung stellt die Forschungsfrage nach der Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz und deren aktuellem Forschungsstand dar. Es wird auf die fehlende etablierte Methode zur ganzheitlichen Rhetorikanalyse hingewiesen und die Notwendigkeit einer solchen Methode begründet. Das Projekt zielt darauf ab, einen ersten Vorschlag für eine solche umfassende Analyse zu liefern, wobei rhetorische Kommunikationskompetenz als die Fähigkeit definiert wird, Sachverhalte verständlich, überzeugend und souverän darzustellen.
2. Definition und thematische Einordnung von Rhetorik: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung und die verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven auf Rhetorik. Es werden verschiedene Definitionen von Rhetorik diskutiert und die Debatte um die Rolle der Rhetorik als reine Überzeugungstaktik oder als Kunst der Redekunst beleuchtet. Die Kapitel beschreibt den historischen Kontext der Rhetorik im antiken Griechenland und Rom, betont die Bedeutung von Aristoteles' Werk und stellt die verschiedenen Disziplinen vor, die sich mit Rhetorik auseinandersetzen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Rhetorik von einem politischen Instrument hin zu einer stilistischen Kunstform.
3. Methoden aus verschiedenen Fachbereichen zur Analyse von Rhetorik: Dieses Kapitel präsentiert eine Vielzahl von Methoden aus verschiedenen Disziplinen zur Analyse von Rhetorik. Es werden linguistische Ansätze (Gesprächsanalyse, semantische, syntaktische und pragmatische Textanalyse, Stilanalyse, Lesbarkeitsindex) sowie Ansätze aus der Argumentationsanalyse (Aristotelische Toposanalyse, moderne Argumentationsanalyse), Kommunikationswissenschaft (Lasswell-Formel, Organonmodell, Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns, Grice'sche Konversationsmaximen) und Psychologie (Impression-Management, Yale-Ansatz, Halo-Effekte, Elaboration-Likelihood-Model, Theorie der kognitiven Dissonanz) behandelt. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen methodischen Möglichkeiten der Rhetorikanalyse.
Schlüsselwörter
Rhetorische Kommunikationskompetenz, Rhetorikanalyse, Methodenvergleich, Linguistische Analyse, Argumentationsanalyse, Kommunikationsmodelle, (Sozial-)psychologische Ansätze, Handlungsanleitungen, Messbarkeit, Überzeugung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz und der Entwicklung einer ganzheitlichen Methode zur Rhetorikanalyse. Es untersucht den Mangel an etablierten Methoden für eine umfassende Analyse rhetorischer Fähigkeiten und bietet einen Vorschlag für eine solche Methode.
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Hauptziel ist die Entwicklung von Handlungsanleitungen für eine ganzheitliche Rhetorikanalyse. Es sollen verschiedene Analysemethoden aus Linguistik, Argumentationsanalyse, Kommunikationswissenschaft und Psychologie integriert werden, um eine umfassendere Bewertung rhetorischer Fähigkeiten zu ermöglichen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz, die Entwicklung einer ganzheitlichen Methode zur Rhetorikanalyse, die Integration verschiedener Analysemethoden aus verschiedenen Fachbereichen und die Berücksichtigung verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation. Das Dokument erstellt Handlungsempfehlungen für eine umfassende Analyse.
Welche Methoden zur Rhetorikanalyse werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert eine breite Palette an Methoden aus verschiedenen Disziplinen. Aus der Linguistik werden Gesprächsanalyse, semantische, syntaktische und pragmatische Textanalyse, Stilanalyse und der Lesbarkeitsindex nach Flesch behandelt. Aus der Argumentationsanalyse werden die aristotelische Toposanalyse und moderne Ansätze vorgestellt. Kommunikationswissenschaftliche Ansätze umfassen die Lasswell-Formel, das Organonmodell von Bühler, die Theorie des kommunikativen Handelns nach Habermas und die Grice'schen Konversationsmaximen. Psychologische Ansätze beinhalten das Impression-Management nach Goffman, den Yale-Ansatz, Halo-Effekte, das Elaboration-Likelihood-Model von Petty und Cacioppo sowie die Theorie der kognitiven Dissonanz nach Festinger.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument enthält eine Einführung, ein Kapitel zur Definition und thematischen Einordnung von Rhetorik, ein Kapitel zu Methoden aus verschiedenen Fachbereichen zur Analyse von Rhetorik, Handlungsempfehlungen zur ganzheitlichen Analyse und eine Zusammenfassung der Kapitel. Es enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis und Schlüsselwörter.
Was ist die Definition von rhetorischer Kommunikationskompetenz im Dokument?
Rhetorische Kommunikationskompetenz wird als die Fähigkeit definiert, Sachverhalte verständlich, überzeugend und souverän darzustellen.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Das Dokument bietet Zusammenfassungen der Einführung (Forschungsfrage, Forschungsstand, fehlende Methode), der Definition und thematischen Einordnung von Rhetorik (historische Entwicklung, verschiedene Perspektiven, Definitionen), und der Methoden aus verschiedenen Fachbereichen zur Analyse von Rhetorik (umfassender Überblick über verschiedene Methoden).
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Rhetorische Kommunikationskompetenz, Rhetorikanalyse, Methodenvergleich, Linguistische Analyse, Argumentationsanalyse, Kommunikationsmodelle, (Sozial-)psychologische Ansätze, Handlungsanleitungen, Messbarkeit, Überzeugung.
- Quote paper
- Katharina Wuttke (Author), 2013, Analyse und Messbarkeit rhetorischer Kommunikationskompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231153