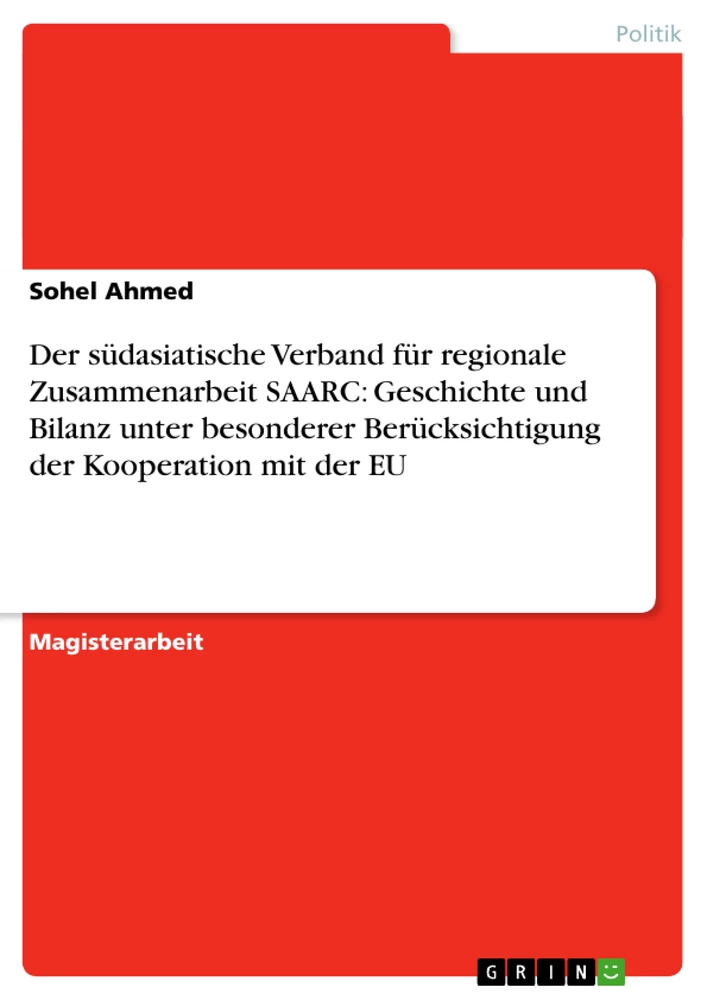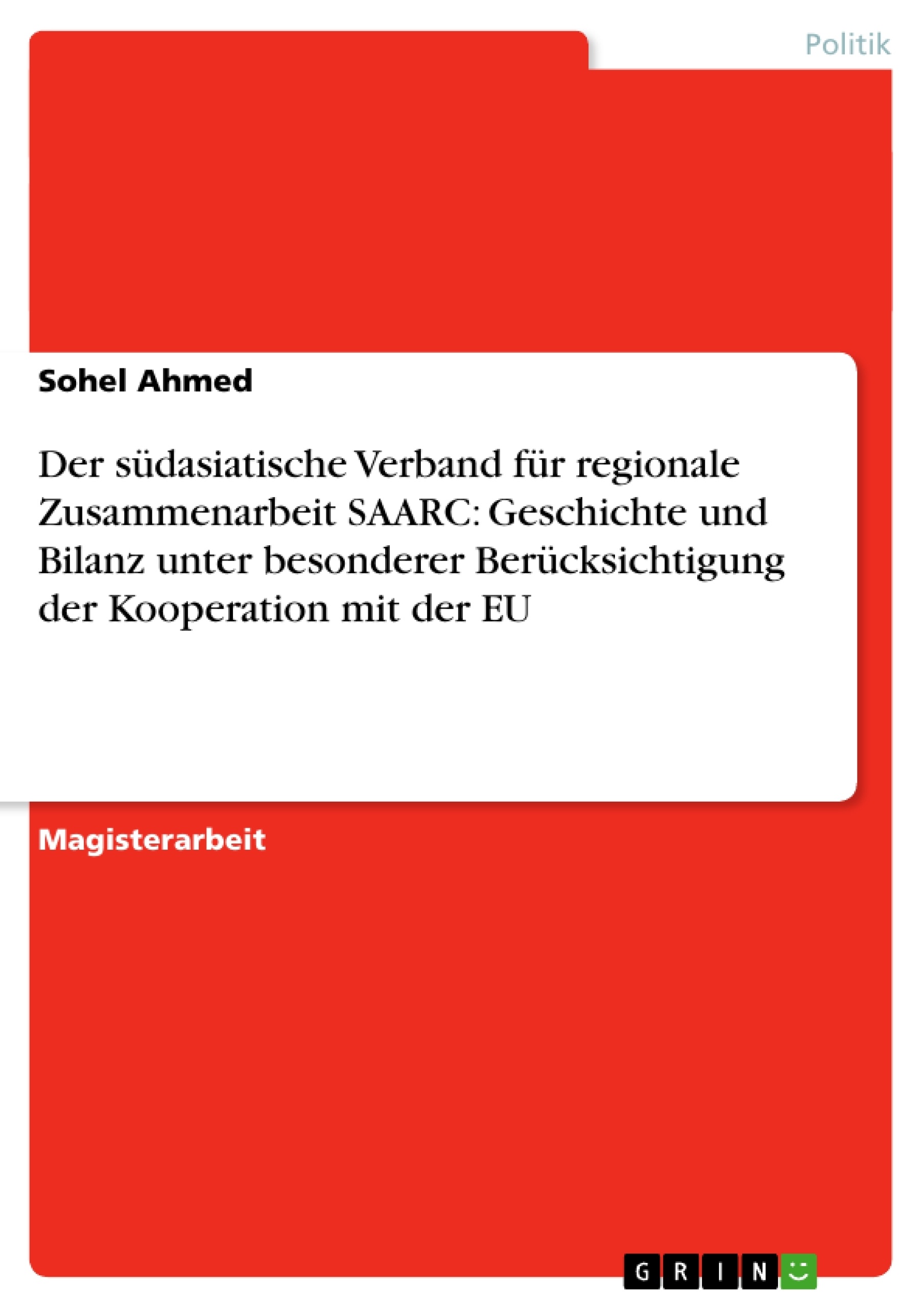Global ist seit geraumer Zeit eine zunehmende Bereitschaft zur Aufnahme regionaler Beziehungen zu verzeichnen. Dafür spricht die stetig gewachsene Zahl der, in den vergangenen Jahrzehnten beschlossenen, regionalen bzw. subregionalen ökonomischen und politischen Abkommen zwischen verschiedenen Ländern und Regionen. Zahlreiche regionale, über die Grenzen von National- und Territorialstaaten hinweg operierende Verbände, können zur Verdeutlichung dieses Trends angeführt werden: Beispielhaft sind EU, ASEAN, MERCOSUR, SADC, ECOWAS, GCC, NAFTA u.v.a. zu nennen. In diesem gewachsenen Bewusstsein der Notwendigkeit eines Ausbaus interregionaler Zusammenarbeit offenbart sich ein weltweites Bedürfnis, Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlichen Zusammenlebens zumaximieren. Als ursächlich für diese Entwicklung ist zum einen die sich im Zuge der Globalisierung ausweitende transnationale Vernetzung und Liberalisierung der Systeme, Gesellschaften und Märkte anzusehen. Hieraus resultiert in erster Linie eine verstärkte Erfordernis zu ökonomischer Zusammenarbeit, welche sich häufig als der Motor wachsender Kooperation erweist. Beim Aushandeln reziproker Interessen innerhalb der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nehmen jedoch zunehmend auchpolitische, militärische und sicherheitspolitische Fragen einen zentralen Raum ein. Mehr und mehr Staaten erkennen das Potential von inter- und intraregionaler Zusammenarbeit, umfassende Rechts- und Arbeitsgrundlagen bei überstaatlichen Transaktionen zu gewährleisten. Zum anderen stellt sich seit dem Ende der bipolaren Welt die Herausbildung einer neuen Weltordnung als globale Herausforderung dar. Auchvor diesem Hintergrund gewinnen regionale Organisationen in internationalen Beziehungen zunehmend an Bedeutung. Mehr Interdependenz und Kooperation unternationalen Akteuren treibt die Bildung internationaler Systeme voran. In diesem Kontext ermöglichen Regionalismus, Subregionalismus und Interregionalismus die Erschließung wichtiger Handlungsfelder bei der Schaffung einer neuen Ordnung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Thema und Abgrenzung
- 1.1 Untersuchungs- und Erkenntnisziele
- 1.2 Inhalt und Aufbau
- 1.3 Forschungs- und Literaturstand
- 1.4 Begriffsbestimmung
- 2. Analyse der Grundlagen des Verbandes für regionale Zusammenarbeit in Südasien SAARC
- 2.1 Historischer Abriss: Die Entwicklung von den Vorverhandlungen bis zur Gründung der SAARC
- 2.2 Gründungsmotive und Ziele des strategischen Zusammenschlusses
- 2.3 Die strukturellen Grundlagen des Verbandes
- 2.3.1 Rechtsgrundlagen der SAARC
- 2.3.2 Organisatorische Struktur und Aufbau
- 2.3.3 Haushaltspolitik und Finanzen
- 3. Indogene und exogene Determinanten der regionalen Zusammenarbeit in Südasien
- 3.1 SAARC - Innenansicht eines heterogenen Zweckverbandes
- 3.1.1 Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen in den SAARC-Mitgliedsländern
- 3.1.2 Wirtschaftliche Ausgangslage bzw. ökonomische Entwicklung in den SAARC-Mitgliedsländern
- 3.2 Regionale Kontextfaktoren zwischen Mitgliedstaaten des Verbandes
- 3.2.1 Nationalismus und der Nationalstaat
- 3.2.2 Das politische Hegemoniestreben des Indiens
- 3.2.3 Wachsende sicherheits- und friedenspolitische Herausforderung: Der Kaschmir Konflikt
- 3.2.4 Andere bilaterale Konflikte
- 3.1 SAARC - Innenansicht eines heterogenen Zweckverbandes
- 4. Handlungsfelder der Kooperation: Die Bilanz bisheriger Bemühungen
- 4.1 Überblick über bislang getroffene Kooperationsmaßnahmen
- 4.1.1 Kooperationsmaßnahmen auf administrativer Ebene
- 4.1.2 Kooperationsmaßnahmen auf der 'ausführenden Ebene'
- 4.2 Bilanz der wirtschaftspolitischen Kooperation: Potentiale, Einschränkungen und politische Maßnahmen
- 4.3 Gemeinsamer Markt: Die SAARC Freihandelszone SAFTA - Ein Durchbruch?
- 4.1 Überblick über bislang getroffene Kooperationsmaßnahmen
- 5. Integrationsprozess in der EU: Ein Modell für die SAARC?
- 5.1 Theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der regionalen Zusammenarbeit in Europa
- 5.1.1 Föderalismus/ Mehrebenenansätze (Supranationalismus)
- 5.1.2 Intergouvernementalismus
- 5.1.3 (Neo-) Funktionalismus
- 5.2 Relevanz der europäischen Ansätze für den Integrationsprozess der SAARC
- 5.1 Theoretische Ansätze und Modelle zur Erklärung der regionalen Zusammenarbeit in Europa
- 6. Interregionale Kooperationen der SAARC
- 6.1 Zur Beschaffenheit und Bedeutung interregionaler Beziehungen
- 6.2 Kooperation zwischen EU und SAARC
- 6.2.1 Entwicklung der Kooperation
- 6.2.2 Kooperationsziele und -interessen in der Zusammenarbeit zwischen SAARC und EU
- 6.2.3 Schwerpunkte und Ergebnisse der interregionalen Zusammenarbeit zwischen SAARC und EU: Die Bilanz bisheriger Bemühungen
- 6.3 Kooperation mit den anderen regionalen und internationalen Organisationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den südasiatischen Verband für regionale Zusammenarbeit (SAARC) hinsichtlich seiner Geschichte, seiner Bilanz und insbesondere seiner Kooperation mit der Europäischen Union (EU). Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Erfolge der regionalen Integration in Südasien im Kontext der vielfältigen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Faktoren.
- Historische Entwicklung der SAARC
- Analyse der strukturellen Grundlagen der SAARC
- Einflussfaktoren auf die regionale Zusammenarbeit in Südasien
- Bilanz der wirtschaftspolitischen Kooperation innerhalb der SAARC
- Vergleich des Integrationsprozesses in der EU mit dem der SAARC
Zusammenfassung der Kapitel
1. Thema und Abgrenzung: Dieses einleitende Kapitel definiert die Forschungsfrage, die Untersuchungsziele und den methodischen Ansatz der Arbeit. Es beschreibt den Aufbau und die Struktur der Arbeit und skizziert den relevanten Forschungsstand zur regionalen Zusammenarbeit in Südasien und den Beziehungen zwischen SAARC und EU. Die Abgrenzung des Themas wird klar definiert, um den Fokus der Arbeit zu präzisieren.
2. Analyse der Grundlagen des Verbandes für regionale Zusammenarbeit in Südasien SAARC: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der SAARC von ihren Vorverhandlungen bis zur Gründung. Es analysiert die Gründungsmotive, die politischen Ziele und die strukturellen Grundlagen des Verbandes, einschließlich seiner Rechtsgrundlagen, seiner Organisation und seiner Finanzpolitik. Es bietet einen umfassenden Überblick über die institutionellen Rahmenbedingungen der SAARC.
3. Indogene und exogene Determinanten der regionalen Zusammenarbeit in Südasien: Dieses Kapitel untersucht die inneren und äußeren Faktoren, die die regionale Zusammenarbeit in Südasien beeinflussen. Es analysiert die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den Mitgliedsstaaten und die regionalen Kontextfaktoren wie Nationalismus, das politische Hegemoniestreben Indiens und bilaterale Konflikte, die die Integration behindern. Der Kaschmir-Konflikt wird als ein Beispiel für eine herausfordernde sicherheitspolitische Situation diskutiert.
4. Handlungsfelder der Kooperation: Die Bilanz bisheriger Bemühungen: Dieses Kapitel bewertet die bisherigen Kooperationsmaßnahmen der SAARC auf administrativer und ausführender Ebene. Es analysiert die Bilanz der wirtschaftspolitischen Kooperation, beleuchtet Potentiale und Einschränkungen und untersucht die Bedeutung der SAARC Freihandelszone (SAFTA) für die regionale Integration. Der Fokus liegt auf einer kritischen Beurteilung des bisherigen Erfolgs der Kooperation.
5. Integrationsprozess in der EU: Ein Modell für die SAARC?: Dieses Kapitel untersucht den europäischen Integrationsprozess und seine Relevanz für die SAARC. Es analysiert verschiedene theoretische Ansätze wie Föderalismus, Intergouvernementalismus und (Neo-)Funktionalismus, um den Erfolg der EU-Integration zu erklären und die Übertragbarkeit dieser Modelle auf die SAARC zu diskutieren.
6. Interregionale Kooperationen der SAARC: Dieses Kapitel befasst sich mit den interregionalen Beziehungen der SAARC, insbesondere mit der Kooperation zwischen der SAARC und der EU. Es analysiert die Entwicklung der Zusammenarbeit, die Ziele und Interessen beider Seiten und die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen. Es wird auch die Kooperation mit anderen regionalen und internationalen Organisationen kurz beleuchtet.
Schlüsselwörter
SAARC, regionale Zusammenarbeit, Südasien, EU, Integration, Wirtschaftspolitik, Konflikte, Nationalismus, Indien, Freihandelszone, (Neo-)Funktionalismus, Intergouvernementalismus, Kooperation, Entwicklungszusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Regionale Zusammenarbeit in Südasien (SAARC) und die Europäische Union
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert den südasiatischen Verband für regionale Zusammenarbeit (SAARC), seine Geschichte, seine Bilanz und insbesondere seine Kooperation mit der Europäischen Union (EU). Der Fokus liegt auf den Herausforderungen und Erfolgen der regionalen Integration in Südasien unter Berücksichtigung vielfältiger politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktoren.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der SAARC, die Analyse ihrer strukturellen Grundlagen, die einflussnehmenden Faktoren auf die regionale Zusammenarbeit in Südasien, die Bilanz der wirtschaftspolitischen Kooperation innerhalb der SAARC und einen Vergleich des Integrationsprozesses in der EU mit dem der SAARC. Zusätzlich wird die interregionale Kooperation der SAARC, insbesondere mit der EU, untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Kapitel 1 definiert die Forschungsfrage, die Ziele und den methodischen Ansatz. Kapitel 2 analysiert die historische Entwicklung und die strukturellen Grundlagen der SAARC. Kapitel 3 untersucht die internen und externen Einflussfaktoren auf die regionale Zusammenarbeit. Kapitel 4 bewertet die bisherigen Kooperationsmaßnahmen der SAARC. Kapitel 5 vergleicht den Integrationsprozess in der EU mit dem der SAARC. Kapitel 6 befasst sich mit der interregionalen Kooperation der SAARC, insbesondere mit der EU und anderen Organisationen.
Welche Schlüsseltheorien werden angewendet?
Zur Erklärung des Integrationsprozesses werden verschiedene theoretische Ansätze herangezogen, darunter Föderalismus, Intergouvernementalismus und (Neo-)Funktionalismus. Diese werden im Kontext des europäischen Integrationsprozesses und dessen Übertragbarkeit auf die SAARC diskutiert.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit der SAARC behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Herausforderungen für die regionale Zusammenarbeit in Südasien, darunter Nationalismus, das politische Hegemoniestreben Indiens, bilaterale Konflikte (z.B. der Kaschmir-Konflikt) und die heterogenen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Mitgliedsstaaten.
Welche Rolle spielt die EU im Kontext der SAARC?
Die Arbeit untersucht die Kooperation zwischen der SAARC und der EU, analysiert die Entwicklung dieser Zusammenarbeit, die Ziele und Interessen beider Seiten und bewertet die Ergebnisse bisheriger Bemühungen. Der Vergleich mit dem europäischen Integrationsprozess soll Aufschluss über mögliche Erfolgsfaktoren und Hemmnisse für die SAARC geben.
Welche Ergebnisse liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert eine umfassende Analyse des SAARC-Integrationsprozesses, identifiziert Schlüsselfaktoren für Erfolg und Misserfolg und beleuchtet die Bedeutung der interregionalen Kooperation, insbesondere mit der EU. Sie bietet einen kritischen Überblick über die bisherige Entwicklung und gibt Ausblicke auf zukünftige Herausforderungen und Möglichkeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
SAARC, regionale Zusammenarbeit, Südasien, EU, Integration, Wirtschaftspolitik, Konflikte, Nationalismus, Indien, Freihandelszone, (Neo-)Funktionalismus, Intergouvernementalismus, Kooperation, Entwicklungszusammenarbeit.
- Quote paper
- Sohel Ahmed (Author), 2003, Der südasiatische Verband für regionale Zusammenarbeit SAARC: Geschichte und Bilanz unter besonderer Berücksichtigung der Kooperation mit der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23060