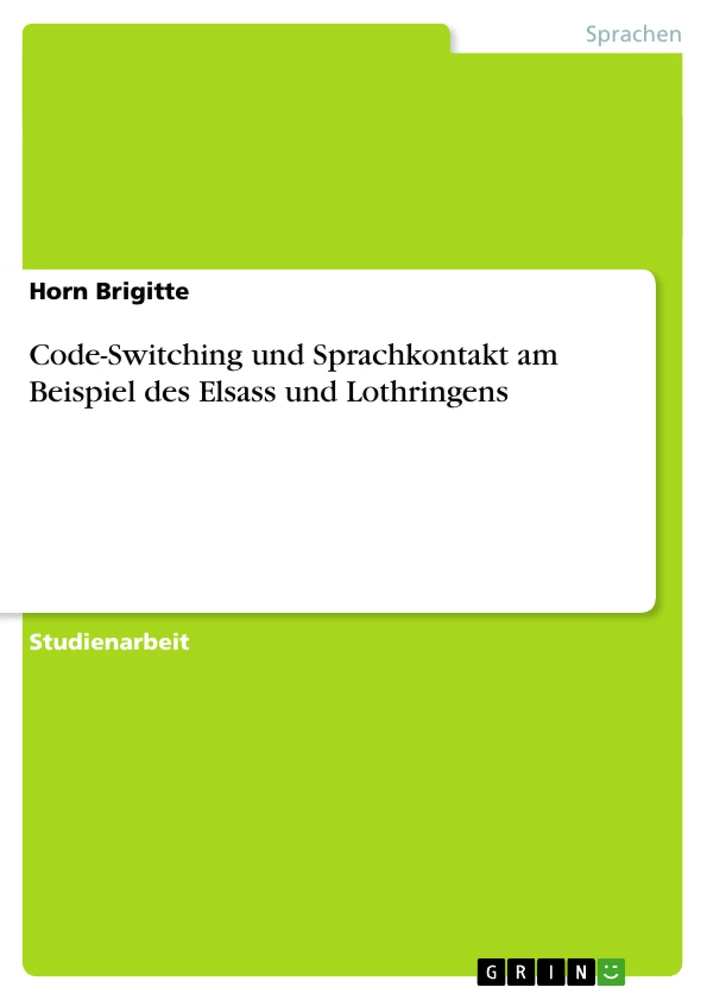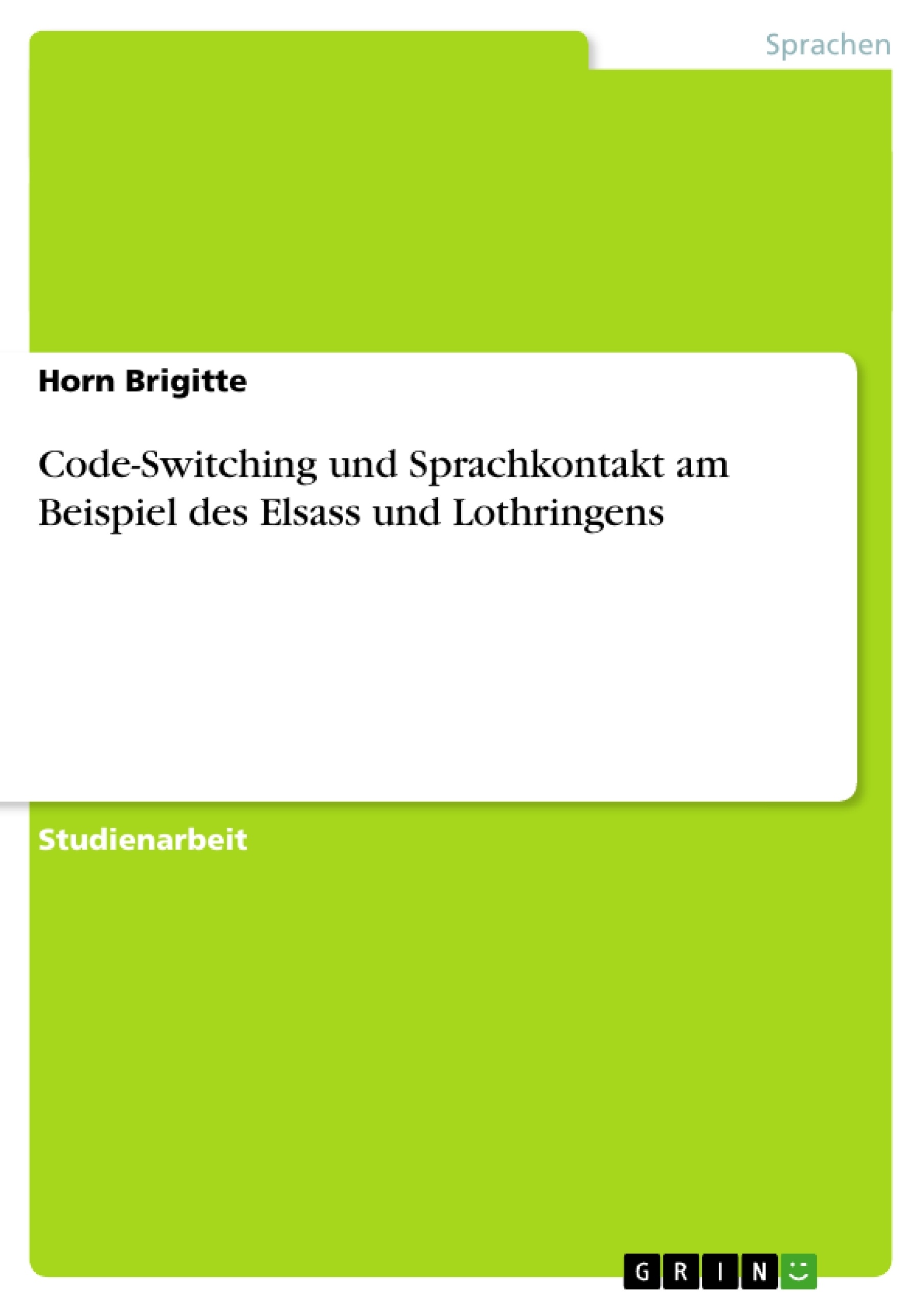Der Begriff „Code Switching“ kommt aus dem Englischen. Das Verb to switch bedeutet soviel wie wechseln, um - oder austauschen. Da es keine einheitliche Definition dieses Begriffes gibt, ist es etwas schwierig, das Thema Code-Switching zu bearbeiten. In der vorliegenden Arbeit stütze ich mich auf unser Referat vom 16.7. diesen Jahres, in welchem wir Code Switching als das Verwenden von mehr als einer sprachlichen Varietät, sei dies nun eine eigene Sprache oder ein Dialekt, im Laufe ein und derselben Konversation definiert haben. Code-switching kann sich auf verschieden große sprachliche Einheiten beziehen wie zum Beispiel ganze Sätze und Satzteile, aber auch auf einzelne Wörter, Ausrufe oder nicht übersetzbare idiomatische Wendungen. Wird eine zweite Sprache jedoch nur für einzelne Wörter benutzt, kann es sich hierbei allerdings auch um sogenannte „borrowings“ handeln. Borrowings sind Entlehnungen aus einer anderen sprachlichen Varietät. Ob es sich jeweils um Code switching oder borrowing handelt, lässt sich am Grad der phonologischen und morphosyntaktischen Integration der Elemente aus der embedded language in die Matrix language feststellen.
Damit Code switching funktionieren kann, sollten alle Teilnehmer der Konversation in ausreichendem Maße über Kenntnisse beider Sprachen verfügen und zwar sowohl hinsichtlich der Grammatik als auch des Vokabulars. Deshalb findet Code Switching hauptsächlich bei der Konversation bi- oder multilingualer Individuen statt, wie zum Beispiel im Elsass und in Lothringen. Durch die Grenznähe und aufgrund der Geschichte ist es dort zu einem engen Sprachkontakt zwischen dem Französischen und dem Deutschen gekommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsmethoden zum Thema Code Switching
- Bilingualismus im Elsass und in Lothringen
- Code-Switching und Sprachwahl aus soziologischem Blickwinkel
- Sozio-ökonomische Faktoren
- Sozio-kuturelle Faktoren
- Situational Switching
- Metaphorical Switching
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen des Code Switchings, insbesondere im Kontext des Elsass und Lothringens, und analysiert die soziolinguistischen Faktoren, die die Sprachwahl beeinflussen.
- Definition und Analyse von Code Switching
- Forschungsmethoden zur Untersuchung von Sprachverhalten
- Die sprachliche Situation im Elsass und Lothringen, einschließlich der Rolle des Elsässischen und des Lothringischen
- Soziologische Perspektiven auf Code Switching
- Die Bedeutung von Sprachkontakt und -wechsel für die Identität und soziale Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Begriff „Code Switching“ vor und definiert ihn als den Wechsel zwischen verschiedenen sprachlichen Varietäten, wie zum Beispiel Sprachen oder Dialekten, innerhalb einer Konversation. Das zweite Kapitel befasst sich mit verschiedenen Forschungsmethoden, die zur Untersuchung von Code Switching eingesetzt werden können, wie zum Beispiel Befragungen, Aufzeichnungen von Gesprächen und Interviews. Kapitel 3 analysiert den Bilingualismus im Elsass und Lothringen, wobei der Fokus auf der Sprachsituation in diesen Regionen, den verschiedenen Dialekten und dem Einfluss des Französischen auf die regionalen Sprachen liegt.
Schlüsselwörter
Code Switching, Bilingualismus, Sprachkontakt, Elsass, Lothringen, Sprachwahl, Soziolinguistik, Dialekte, Forschungsmethoden, Sprachverhalten
- Arbeit zitieren
- Horn Brigitte (Autor:in), 2003, Code-Switching und Sprachkontakt am Beispiel des Elsass und Lothringens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23040