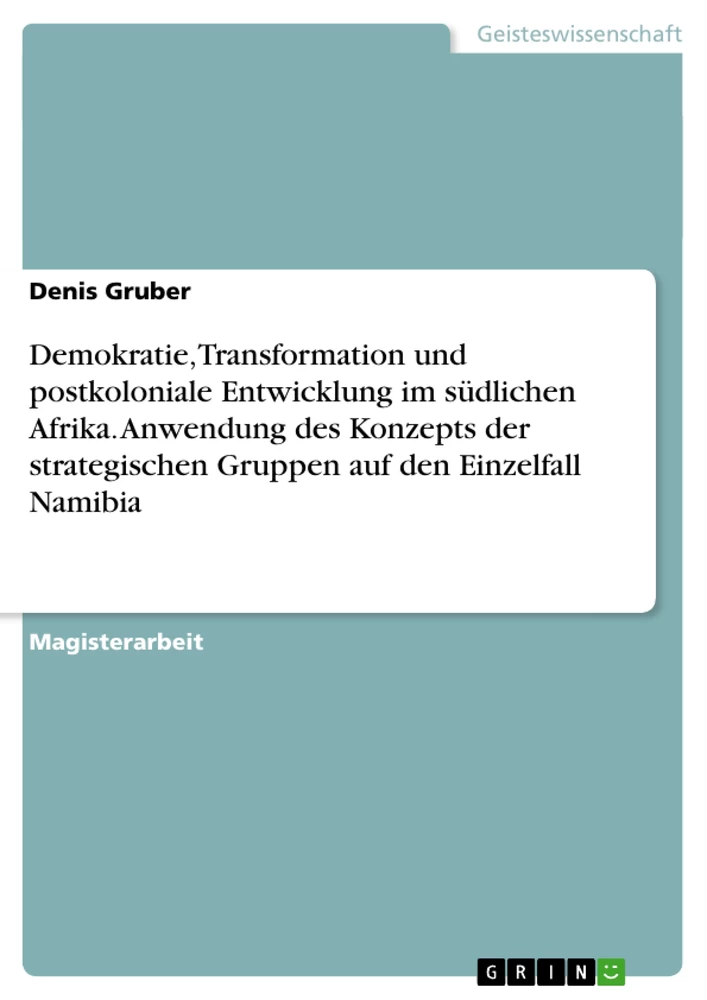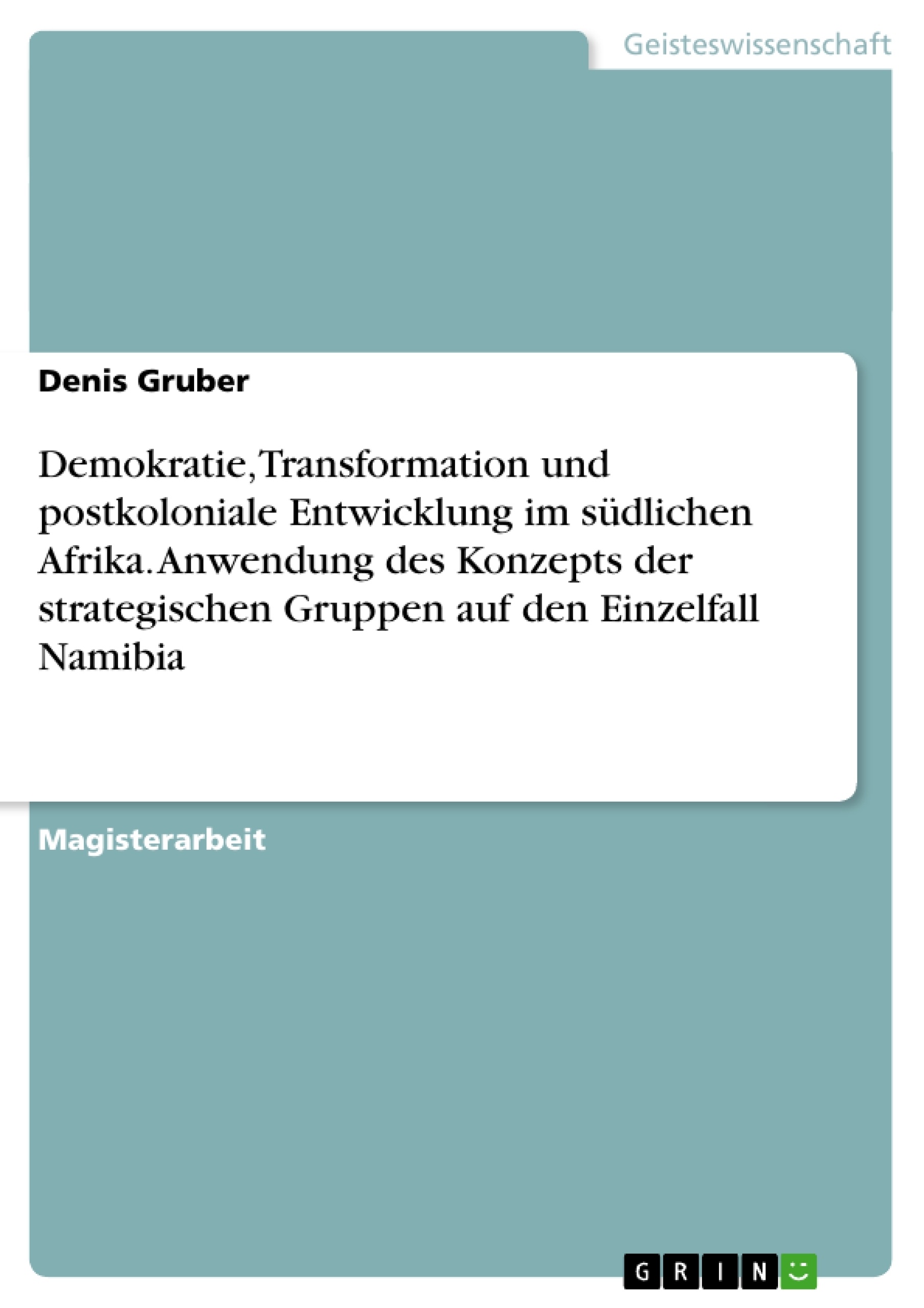Aufgrund der zahlreichen sozialwissenschaftlichen Analysen zu den historischen ‚Umbruchprozessen’ in Mittel- und Osteuropa sowie dem subsaharischen Afrika seit Ende der 1980er Jahre, kam es zu einer Fülle von Begriffen, die häufig synonym zur Beschreibung ein und derselben historischen Ereignisse und Prozesse verwendet wurden. Häufig findet man in derartigen Analysen Begrifflichkeiten wie Transformation, Transition, Revolution, Zusammenbruch, Modernisierung, Liberalisierung, Demokratisierung, Regimewandel oder Systemwechsel vor. Diese Bezüge entstammen sowohl der Transformationsforschung als auch der Entwicklungssoziologie. Neuere Ansätze beider Forschungsrichtungen richten ihren Fokus auf die Benennung und Analyse der betroffenen Akteure in Transformations- und Entwicklungsprozessen.
Diese vorrangig akteurtheoretischen Herangehensweisen bewirken sowohl eine Konzentration auf die Analyse des Handelns von Akteuren, ihren Intentionen und Perzeptionen als auch auf die Beschreibung ihrer Planungs- und Handlungskorridore. Hierbei werden auch Bezüge zur Geschichte und zu kulturellen, religiösen und ökonomischen Gegebenheiten der jeweiligen Gesellschaft hergestellt. Entwicklungssoziologische analytische Konzepte nehmen sowohl Bezug auf westliche als auch auf postkoloniale Gesellschaften und sind stärker eingebunden in akteur- und globalisierungstheoretische Rahmensetzungen, wohingegen bei transformationstheoretischen Zugängen eher der Prozess einer engen Verflechtung von politischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen im Mittelpunkt steht.
Der Entwicklungssoziologie muss hierbei eine Vorreiterrolle beigemessen werden, denn sie hat „eine Art Pfadfinderfunktion für die Erklärung allgemeiner gesellschaftlicher Theoriebildung“ inne und lenkte schon „sehr früh den Blick auf die Notwendigkeit (…) gesellschaftliche Transformationsprozesse unter Berücksichtigung verherrschaftlichter intergesellschaftlicher und wechselseitiger Penetrationsvorgänge zu beschreiben und zu erklären“ (Goetze 2002:13).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzeptuelle Rahmung des Forschungsgegenstands
- 2.1 Demokratietheoretische Überlegungen in Bezug auf die Transformationsforschung
- 2.1.1 Frühere Ansätze: Modernisierungs- und Dependenztheorien
- 2.1.2 Gegenwärtigen Ansätze in der Entwicklungssoziologie und der Transformationsforschung
- 2.2 Zur Bedeutung von, Demokratie' im afrikanischen Kontext
- 2.2.1 Demokratisierungswelle Afrikas: Ein Resultat des endenden Ost-West-Antagonismus
- 2.2.2 Ein neuerlicher, Afro-Pessimismus': Demokratisierung der Machtlosigkeit
- 2.3 Verschiedene Ansätze der Transformationsforschung
- 2.3.1 Nie endender Antagonismus? Die zwei Soziologien: Systemtheorie vs. Akteurtheorie
- 2.3.2 Systemtheoretische Überlegen
- 2.3.3 Akteurtheoretische Überlegungen
- 2.3.4 Zur Kritik an systemtheoretischen und akteurtheoretischen Ansätzen
- 2.4 Weiterführende Überlegungen zu Akteurkonstellationen
- 2.4.1 Zu den Überlegen von Norbert Elias' Spielmodellen
- 2.4.2 Akteur-Struktur-Dynamiken von Uwe Schimank
- 3. Eine akteurtheoretische Herangehensweise: Das Konzept der strategischen Gruppen
- 3.1 Von der Gruppe zur, strategischen Gruppe'
- 3.2 Die Gruppe – eine Figuration
- 3.2 Der Bielefelder Ansatz: Ein Elitenkonzept
- 3.3 Zur Charakteristik strategischer Gruppen
- 3.4 Zu den Grundlagen des Bielefelder Ansatzes: Strategie und strategisches Handeln
- 3.5 Zur Kritik am Konzept der, strategischen Gruppen'
- 3.6 Kategorie der,Konfliktfähigkeit als Grundlage des SKOG-Konzepts
- 3.7 Verschiedene strategische Gruppen und ihre Appropriationsmöglichkeiten
- 3.7.1 Persönliche Aneignungsweise
- 3.7.2 Kollektive Aneignungsweise
- 3.7.3 Korporative Aneignungsweise
- 4. Der Staat Namibia
- 4.1 Zur Entstehung des Namibia-Konflikts
- 4.2 Gegenüberstellung verschiedener Konfliktlösungsvorschläge
- 4.2.1 Südafrikas, interne Lösung I: Turnhalle' vs., westliche Kontaktgruppe'
- 4.2.2 UN-Resolution 435 und das Scheitern der, westlichen Kontaktgruppe'
- 4.2.3 Südafrikas, Totale Nationale Strategie'
- 4.2.4 Zum US-amerikanischen, constructive engagement' und, cuban linkage'
- 4.2.5 Der Durchbruch zu Verhandlungen
- 4.3 Die Transition vom autoritären zum demokratischen System
- 4.3.1 Modell eines idealtypischen Transitionsverlaufs
- 4.3.2 Namibia – kein idealtypischer Transitionsverlauf
- 4.4 Zur gegenwärtigen Entwicklung der Demokratie in Namibia
- 5. Namibia als Untersuchungsgegenstand des strategischen Gruppen-Konzepts
- 5.1 Die SWAPO: Ausgangspunkt des Entstehens einer politischen Elite
- 5.2 Faktoren für die herausragende Position der, strategischen Elite'
- 5.3 Weitere strategische Gruppen in Namibia
- 5.3.1 Staatsbeamte
- 5.3.2 Das Militär
- 5.3.3 Wirtschaftliche Unternehmer
- 5.3.4 Die Rolle der Professionals
- 5.3.5 Traditionelle Führungsstrukturen
- 5.3.5 Religiöse Spezialisten in Namibia
- 5.4 Handlungsmuster strategischer Gruppen
- 5.4.1,Politisierte Ethnizität' im Kolonialstaat und im heutigen Namibia
- 5.4.2 Neopatrimonialismus
- 5.4.3 Klientelismus und Patronagebeziehungen
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Demokratie, Transformation und postkolonialer Entwicklung im südlichen Afrika. Dabei fokussiert sie auf das Beispiel Namibias, um das Konzept der strategischen Gruppen in einen konkreten Kontext zu übertragen.
- Zusammenhang zwischen Demokratie und Transformation in postkolonialen Gesellschaften
- Das Konzept der strategischen Gruppen als analytisches Instrument
- Die Rolle von Akteuren und Handlungsmustern in der Transformation
- Der Fall Namibia: Politische Eliten und strategische Gruppen
- Neopatrimonialismus, Klientelismus und ethnische Aspekte in der Entwicklung Namibias
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und beleuchtet die Begriffslandschaft der Transformationsforschung. Sie betont die Bedeutung der Entwicklungssoziologie und der akteurtheoretischen Ansätze sowie die Problematik eurozentrischer Perspektiven in der Entwicklungstheorie.
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Ansätze der Transformationsforschung und fokussiert auf den Begriff der „strategischen Gruppe“. Es diskutiert sowohl systemtheoretische als auch akteurtheoretische Perspektiven und stellt die Konzepte von Elias und Schimank vor.
Kapitel 3 führt das Konzept der „strategischen Gruppen“ näher aus und untersucht die Eigenschaften und das strategische Handeln von Akteuren. Es analysiert auch die Kritik am Konzept und beleuchtet die Bedeutung der „Konfliktfähigkeit“ für die Bildung strategischer Gruppen.
Kapitel 4 konzentriert sich auf den Fall Namibia und zeichnet die Entstehung des Namibia-Konflikts sowie die verschiedenen Konfliktlösungsvorschläge nach. Es beschreibt auch die Transition vom autoritären zum demokratischen System in Namibia und beleuchtet die aktuelle Situation der Demokratie.
Kapitel 5 untersucht Namibia im Lichte des Konzepts der strategischen Gruppen und beleuchtet die Rolle der SWAPO sowie anderer strategischer Gruppen wie Staatsbeamte, das Militär und wirtschaftliche Unternehmer. Es analysiert die Handlungsmuster dieser Gruppen und die Einflüsse von Neopatrimonialismus, Klientelismus und ethnischen Faktoren.
Schlüsselwörter
Demokratisierung, Transformation, postkoloniale Entwicklung, Namibia, strategische Gruppen, Akteure, Handlungsmuster, Neopatrimonialismus, Klientelismus, ethnische Faktoren, SWAPO, Eliten, Konfliktfähigkeit, Südafrika, UN-Resolution 435, Transitionsverlauf, Entwicklungssoziologie, transformationsforschung
- Quote paper
- Denis Gruber (Author), 2003, Demokratie, Transformation und postkoloniale Entwicklung im südlichen Afrika. Anwendung des Konzepts der strategischen Gruppen auf den Einzelfall Namibia, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23028