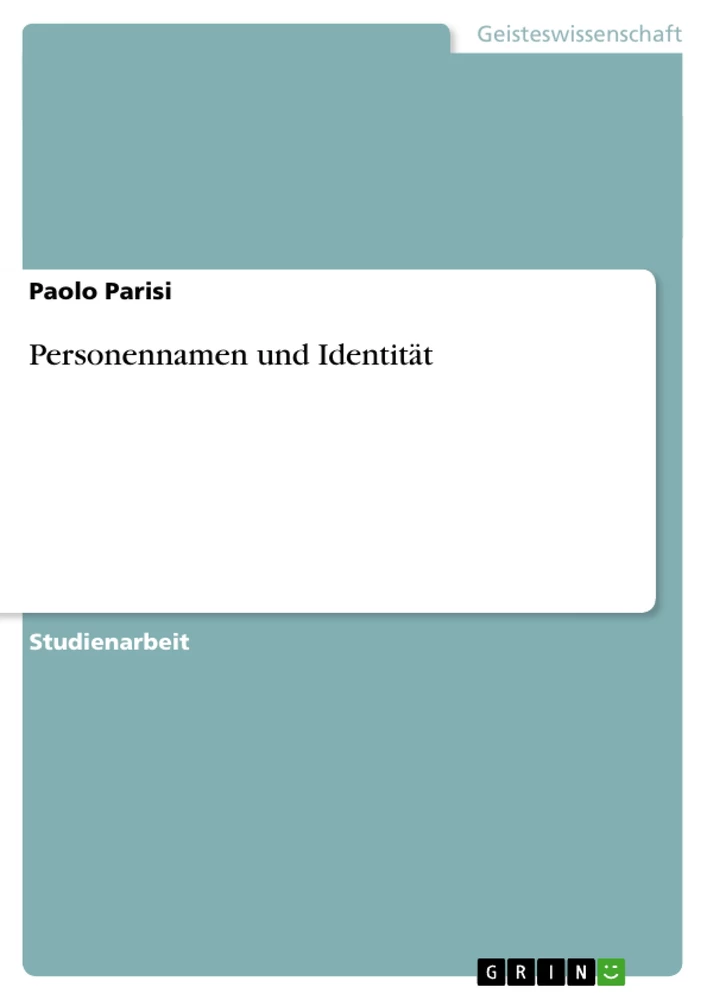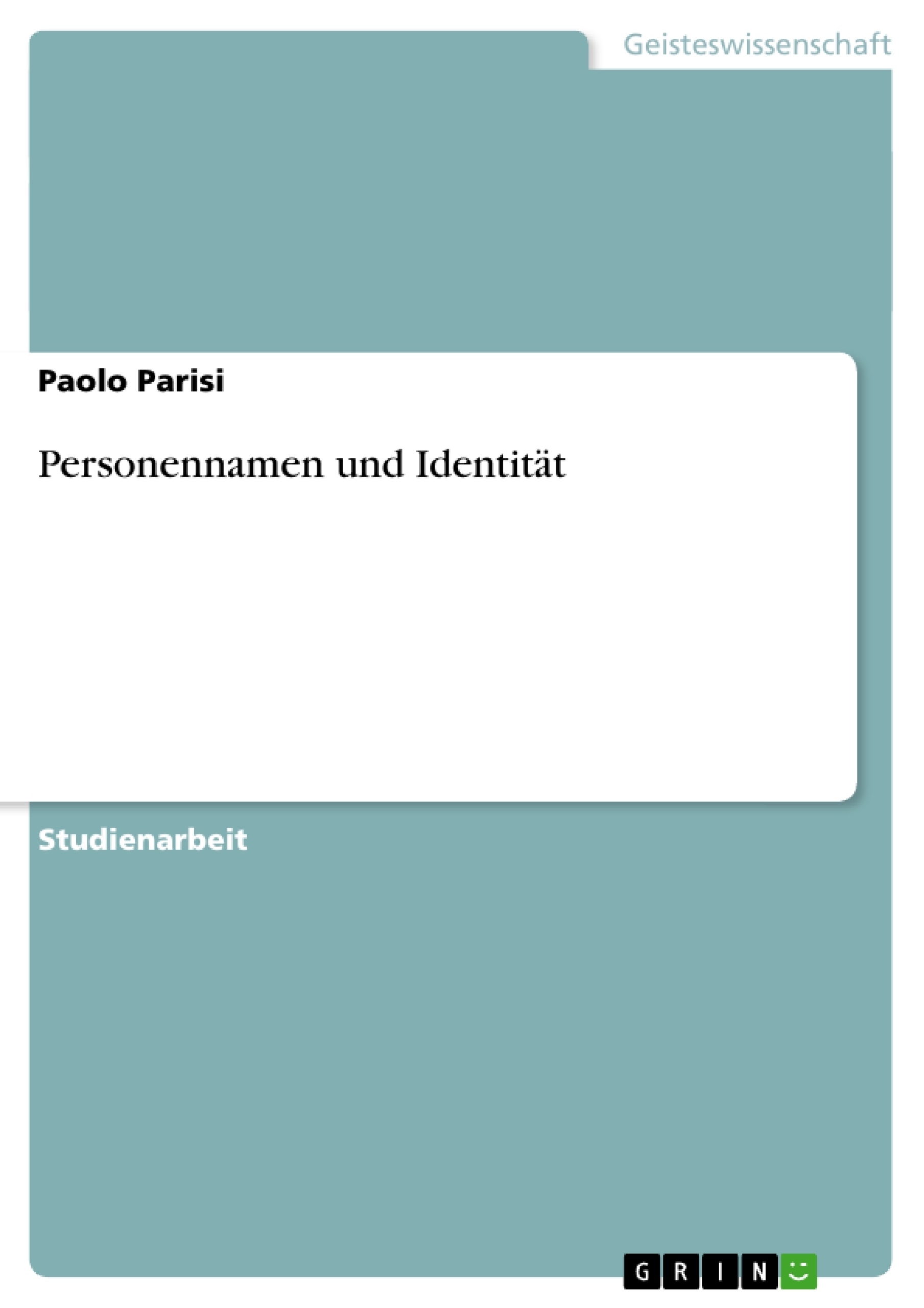Im Frühmittelalter orientierte sich die Namengebung an familiale, gentile oder regnumsspezifische Gesichtspunkte (vgl. Debus 2003: 82). Es herrschte die Grundeinstellung, dass Familie und Name den Adel ausmachen. Wes Namen ich trage, des Hause ich bin. So lautete das Motto, an das sich die damalige Gesellschaft orientierte. Doch wie der Adel, so verpflichtete auch der Name, der diesen bezeugte. Die hohe Wirksamkeit des Namens musste also dazu beigetragen haben, dass dieser eine identitätsstiftende Funktion hatte.
Genus und nomen sollten kohärent sein wie genus (Geschlecht) und mores (Verhalten, die Art). Das Leben des Adels sollte getragen werden von edlen Taten, so wie es sich für einen Adligen geziemte, vita nobilis und actio nobilis waren somit untrennbar (vgl. Bosl 1973, zit. in: Debus 2003: 82). Diese familiale und gentile Zugehörigkeit zeigte sich schließlich in Nachbenennungen, d.h. „die Wahl des Namens nach einem direkten Vorfahren“ (Seibicke 1982: 117), der Übernahme gleicher Namenglieder oder in der Alliteration der Namen (vgl. Debus 2003: 82).
„Auch in der mittelalterlichen Literatur spiegelt sich dieser Sachverhalt, so im Heldenlied – z.B. im „Hildebrandslied“ mit Hildebrand, Hadubrand, Heribrand oder im „Nibelungenlied“ mit Gunther, Gêrnôt, Gîselher –, dann auch in der Bauernstand betreffenden Dichtung – z.B. im „Helmbrecht“ “ (Debus 2003: 82 f.), in welchem, als Folge der Nachbenennung, über drei Generationen hinweg der Name Helmbrecht erscheint (vgl. ebd.).
Inhaltsverzeichnis
- Historisches
- Personennamen und Identität
- Beziehung Name-Referenzsubjekt
- Vornamen und Nachnamen
- Offizielle und inoffizielle Funktion von Namen
- Offizielle Funktion von Namen
- Inoffizielle Funktion von Namen
- Namensänderung, Änderung der eigenen Identität?
- Selektionsprinzipien und Probleme
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Ausarbeitung des Referats „Personennamen und Identität“ beleuchtet die historische Entwicklung und die Bedeutung von Personennamen für die Identität des Einzelnen. Der Text analysiert die Beziehung zwischen Namen und Referenzsubjekt, die Unterscheidung zwischen Vor- und Nachnamen sowie die offizielle und inoffizielle Funktion von Namen.
- Die historische Entwicklung der Namengebung
- Die Bedeutung von Personennamen für die Identität
- Die Beziehung zwischen Namen und Referenzsubjekt
- Die Unterscheidung zwischen Vor- und Nachnamen
- Die offizielle und inoffizielle Funktion von Namen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Namengebung. Es wird gezeigt, wie sich die Namengebung im Mittelalter an familiäre, gentile oder regnumsspezifische Gesichtspunkte orientierte und wie sich die Bedeutung von heiligen und biblischen Namen im 12. Jahrhundert durchsetzte. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Hinwendung zu deutschen Namen im 17. Jahrhundert.
Im zweiten Kapitel wird die identitätsstiftende Funktion von Personennamen erläutert. Der Text zeigt, wie der Name den Menschen namhaft macht und ihn von anderen unterscheidbar und identifizierbar macht. Die Beziehung zwischen Namen und Referenzsubjekt wird näher betrachtet, und es werden die Besonderheiten des Vor- und Nachnamens sowie die offizielle und inoffizielle Funktion von Namen analysiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Namensänderung und der Frage, ob diese eine Änderung im Wesen des Menschen signalisiert. Es werden verschiedene Beispiele für Namensänderungen, wie z.B. die Namensänderung des Saulus zum Paulus, die Papstwahl oder die Namensänderung von Mönchen und Nonnen, vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer Diskussion über die künstlerisch und politisch motivierten Namensänderungen sowie über fremdbestimmte Decknamen.
Das vierte Kapitel analysiert die Selektionsprinzipien und Probleme bei der Namengebung. Es werden die Motivation der Namengebung, die Namenverwendung in der Umgebung und die Einstellung zum eigenen Namen betrachtet. Es werden verschiedene Selektionsprinzipien, wie z.B. die Tradition, die literarische Hilfe und die Originalität, vorgestellt, und es wird die Bedeutung des Wohls des Kindes bei der Namensgebung betont.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Personennamen, Identität, Namengebung, Vornamen, Nachnamen, Namensänderung, Selektionsprinzipien, historische Entwicklung, Bedeutung, Funktion, Referenzsubjekt, offizielle Funktion, inoffizielle Funktion, Identitätsstiftung, Namensvielfalt, Namensreduktion, Familienname, Namensänderung, Deckname, Wohl des Kindes, Originalität, Tradition, Literatur, Philosophie.
- Quote paper
- Paolo Parisi (Author), 2013, Personennamen und Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230142