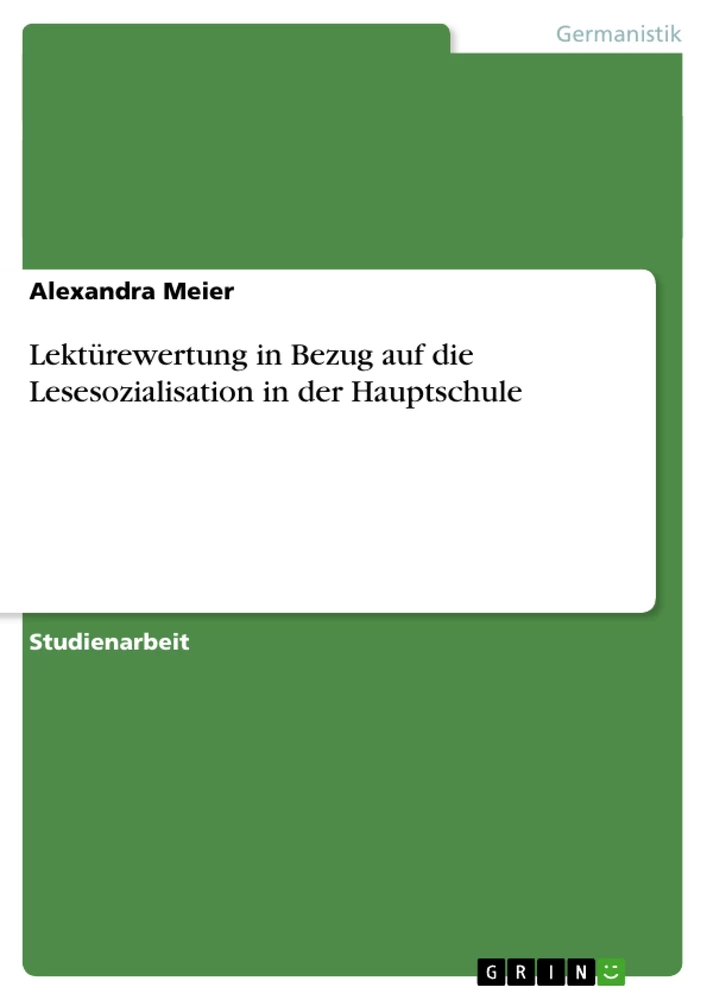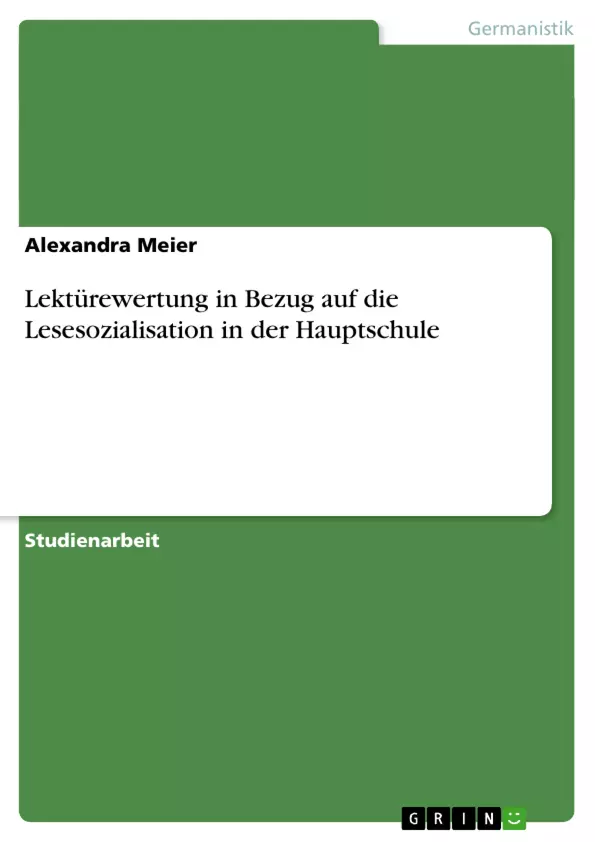[...] Das Leseverhalten hat sich also verändert! In der nun gut zehn Jahre alten Studie
„Medienwelten Jugendlicher“ nannte noch ein Drittel der Jugendlichen das Lesen als eine
ihrer liebsten Freizeitbeschäftigungen. Beliebter waren nur Sport treiben und das
Zusammensein mit Freunden. Dagegen lieferte die geschlossene Fragestellung der im Jahr
2000 durchgeführten PISA-Studie („Lesen ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen“) für 15-
jährige Schülerinnen und Schüler weit niedrigere Ergebnisse – in allen verglichenen
Ländern2.
Die PISA-Studie hat außer in Sachen Leseverhalten auch eine Verschlechterung der
Lesekompetenz festgestellt (22. Platz) und so eine Zäsur in der bildungspolitischen
Diskussion in Deutschland markiert.
Aufgrund der vorliegenden Untersuchungen können wir also feststellen, dass Lesen im
Zeitalter der Medien für die Jugendlichen zu einer Kulturtechnik geworden ist, die nicht mehr
als selbstverständlich vorausgesetzt werden kann. Die Einstellungen zum Lesen haben sich
verändert und stellen nun den Deutschlehrer vor neue Herausforderungen. Der
Deutschunterricht muss kreativer werden, mehr auf die Voraussetzungen der Schüler
eingehen, um das Interesse an Literatur und das Entstehen einer Lesekultur zu fördern.
Deswegen soll, obwohl es schon viele Untersuchungen zur Lesesozialisation von
Hauptschülern gibt, hier noch eine hinzugefügt werden. Zwei verschiedene Objekte werden
auf die gleiche Weise untersucht werden: Einmal eine Hauptschulklasse aus der Bayreuther
Umgebung, ein M-Zug, von dem man annehmen möchte, besser sozialisiert zu sein, und zum
anderen eine Regelklasse aus der Bayreuther Innenstadt, die aufgrund ihres hohen
Ausländeranteils zumindest aus Sicht der Statistik schlecht lesesozialisiert ist.
Doch will diese Untersuchung noch einen Schritt weitergehen. Es geht uns – im Gegensatz zu
den anderen Untersuchungen nicht darum, einzig bestehende Probleme aufzuzeigen oder Hypothesen zu überprüfen, sondern wir wollen vielmehr aufgrund der Ergebnisse
Wertmassstäbe finden, anhand derer wir Schullektüre für den Unterricht, für eine Gruppe vo n
Subjekten also, auswählen, eine Lektüre, die unsere spezifischen Jugendlichen über ein
positives Erlebnis mit Literatur motivieren kann, sich selbst zu sozialisieren, d.h. die Lust am
Buch bei ihnen (wieder) weckt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Einführende Beschreibung der Untersuchung
- Lesesozialisation
- Medienangebot und Medienkonkurrenz
- Die Familie als lesesozialisatorische Instanz
- Die Peergroup als lesesozialisatorische Instanz
- Die Schule als lesesozialisatorische Instanz
- Selbstsozialisation
- Zusammenfassung
- Vorstellung des Fragebogens - Erläuterungen
- Freizeitverhalten
- Leseverhalten
- Lesekompetenz
- Auswertung
- Soziokulturelle Voraussetzungen in der Klasse
- Auswertung des Fragebogens
- Schlussfolgerungen am Beispiel einer möglichen Lektüre
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Untersuchung zielt darauf ab, anhand von zwei Hauptschulklassen (M-Zug und Regelklasse) die Lesesozialisation und deren Einfluss auf das Leseverhalten und die Lesekompetenz der Schüler zu analysieren. Die Ergebnisse sollen helfen, Wertmassstäbe für die Auswahl von Schullektüren zu entwickeln, die die Schüler motivieren, sich selbst zu sozialisieren und die Freude am Lesen wiederzubeleben.
- Lesesozialisation und ihre Einflussfaktoren (Familie, Schule, Medien, Peergroup)
- Veränderungen im Leseverhalten und der Lesekompetenz von Jugendlichen
- Entwicklung von Wertmassstäben für die Auswahl von Schullektüren
- Zusammenhang zwischen Lesesozialisation, Leseverhalten und Lesekompetenz
- Motivierende Faktoren für Jugendliche beim Lesen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Hintergrund der Untersuchung dar, indem sie den Wandel im Leseverhalten von Jugendlichen im Kontext der Medienentwicklung beschreibt und die Notwendigkeit einer Untersuchung zur Lesesozialisation betont. Sie fokussiert auf die Herausforderungen des Deutschunterrichts im Zeitalter der Medien und die Zielsetzung, Wertmassstäbe für die Auswahl von Schullektüren zu entwickeln.
- Lesesozialisation: Dieses Kapitel beschreibt den Begriff der Sozialisation im Allgemeinen und erklärt den spezifischen Prozess der Lesesozialisation. Es erläutert die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Lesesozialisation (Familie, Schule, Medien, Peergroup) und die Bedeutung der Lesekompetenz für den Erfolg im Leben. Das Kapitel betont auch die Wichtigkeit einer lesefreundlichen Sozialisation für die Entwicklung einer positiven Einstellung zum Lesen.
- Vorstellung des Fragebogens - Erläuterungen: Dieses Kapitel präsentiert den Fragebogen, der für die Untersuchung verwendet wird, und erläutert die einzelnen Bereiche: Freizeitverhalten, Leseverhalten und Lesekompetenz. Der Fragebogen soll Daten über die Lesesozialisation, das Leseverhalten und die Lesekompetenz der Schüler erfassen.
- Auswertung: Das Kapitel beschreibt die Auswertung der Daten, die durch den Fragebogen erhoben wurden. Es untersucht die soziokulturellen Voraussetzungen in der Klasse und analysiert die Ergebnisse des Fragebogens. Schliesslich werden Schlussfolgerungen gezogen und am Beispiel einer möglichen Lektüre verdeutlicht, wie die Ergebnisse für die Auswahl von Schullektüren genutzt werden können.
Schlüsselwörter
Die Untersuchung befasst sich mit den Themen Lesesozialisation, Leseverhalten, Lesekompetenz, Medienangebot, Medienkonkurrenz, Schullektüren, Wertmassstäbe, Motivation, Deutschunterricht, Hauptschüler, und Jugendkultur.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich das Leseverhalten von Jugendlichen verändert?
Studien wie PISA zeigen, dass Lesen im Medienzeitalter keine selbstverständliche Kulturtechnik mehr ist und das Interesse an Literatur in der Freizeit deutlich gesunken ist.
Welche Instanzen beeinflussen die Lesesozialisation?
Die wichtigsten Faktoren sind die Familie, die Schule, die Peergroup (Gleichaltrige) sowie das allgemeine Medienangebot und die Medienkonkurrenz.
Was ist das Ziel der Untersuchung in den Bayreuther Hauptschulklassen?
Die Arbeit möchte Wertmaßstäbe finden, um Schullektüren so auszuwählen, dass sie die Lust am Buch bei Schülern mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen wieder wecken.
Was versteht man unter "Selbstsozialisation" beim Lesen?
Es beschreibt den Prozess, in dem Jugendliche durch positive Erlebnisse mit Literatur motiviert werden, eigenständig eine Lesekultur zu entwickeln.
Warum ist die Auswahl der Schullektüre so entscheidend?
Eine passende Lektüre kann als "positives Erlebnis" fungieren und Schüler dazu bringen, Vorurteile gegenüber dem Lesen abzubauen und ihre Lesekompetenz spielerisch zu verbessern.
- Quote paper
- Alexandra Meier (Author), 2004, Lektürewertung in Bezug auf die Lesesozialisation in der Hauptschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23007