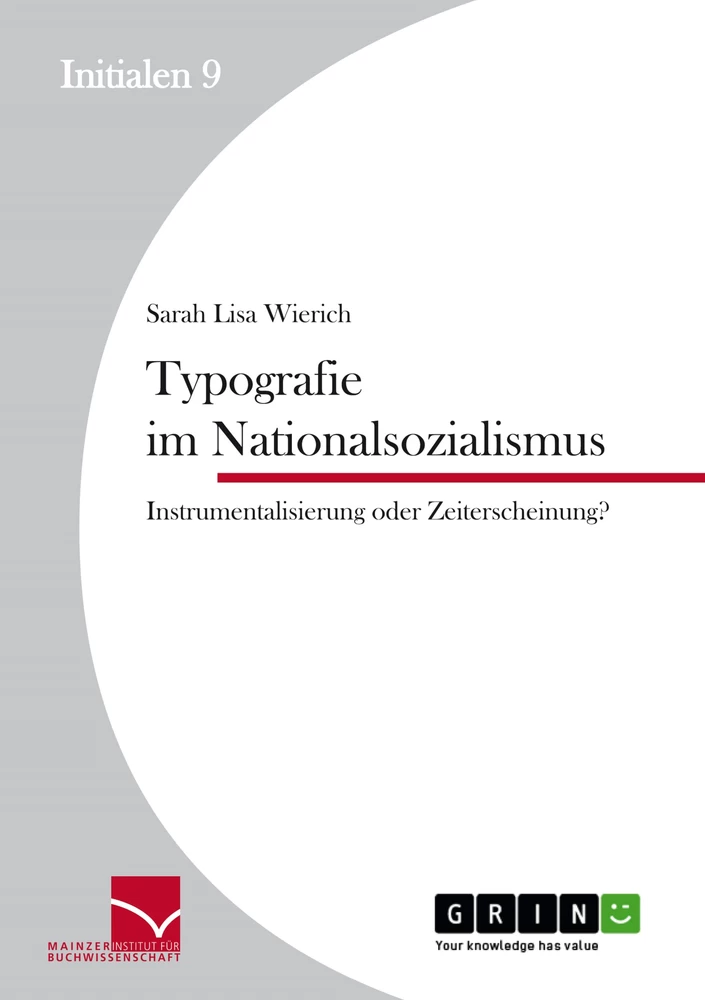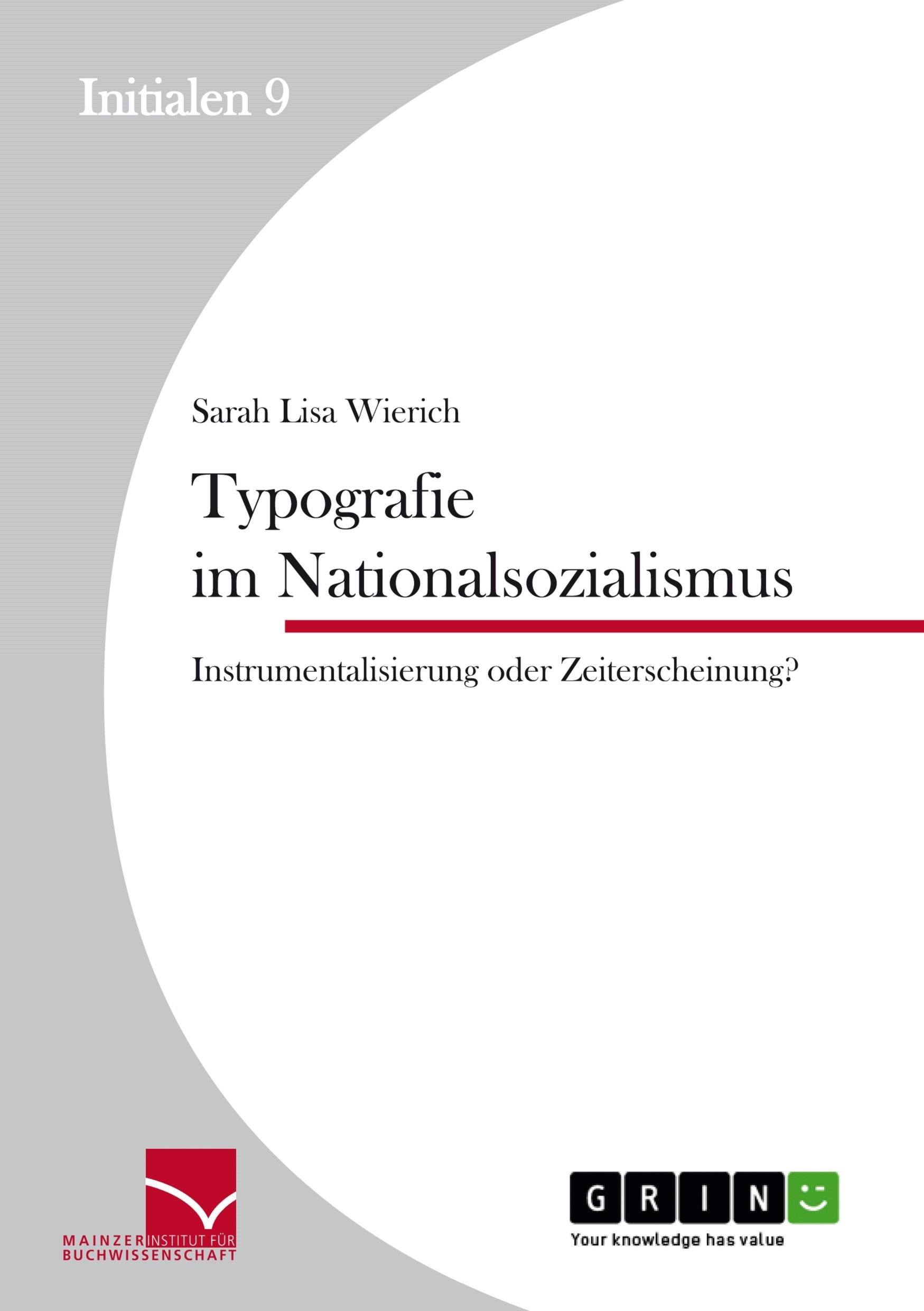Kaum ein anderes Zitat verdeutlicht besser die Erwartungshaltung, die sich im Kontext von typografischer Gestaltung und totalitärem System gemeinhin herausbilden wird: eine strenge Reglementierung und damit Instrumentalisierung der Typografie im Sinne der Herrschenden, eine Indienstnahme der Gestaltung durch das Politische. Folgerichtig überträgt sich diese Erwartungshaltung auf die Zeit des Nationalsozialismus, die als einer der klassischen Vertreter des Totalitarismus gilt. Bei oberflächlicher Betrachtung ergibt sich zunächst der erwartungsgemäße Eindruck, dass die Design- aber vor allem auch die Schriftpolitik im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie gesteuert sind, wobei sich schon hier mit dem Verbot der Fraktur 1941 ein merkwürdiger Bruch offenbart. In der intensiveren Auseinandersetzung kristallisiert sich eine bemerkenswerte Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit heraus, die weit über diesen einen »Bruch« hinausweist. So liegt es nahe, nicht nur nach der Instrumentalisierung typografischer Gestaltung im Nationalsozialismus zu fragen, sondern auch danach, ob und inwieweit bestimmte Phänomene Zeiterscheinungen sind, die in der Phase nach der Machtergreifung 1933 eine Fortsetzung erfuhren.
Ausgehend von eben jener Fragestellung nach Instrumentalisierung oder Zeiterscheinung ist es Ziel dieser Arbeit, »kaschierte Kontinuitäten« und Diskrepanzen zwischen offiziell propagierter Politik und tatsächlicher Umsetzung in der Praxis exemplarisch aufzuzeigen und innerhalb der Felder Instrumentalisierung oder Zeiterscheinung zu verorten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Typografische Gestaltung als Ausdrucksmittel
- Verortung und Wahrnehmung von Typografie
- Typografie als Machtausdruck
- Typografische Gestaltung im Kontext des totalitären Systems
- Totalitäres System und Propaganda
- Gestaltungspraxis im Nationalsozialismus
- Sonderfall nationalsozialistische Schriftpolitik
- Historie und Entwicklung des Schriftstreits
- Frakturgebot 1933
- Fraktur»verbot« 1941
- Das zerstörte Image der Fraktur
- Instrumentalisierung oder Zeiterscheinung? – Typografische Gestaltung im totalitären System des Nationalsozialismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Typografie im Nationalsozialismus. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit typografische Gestaltungsmittel gezielt instrumentalisiert wurden und ob es sich bei den beobachteten Gestaltungsmustern eher um eine bloße Zeiterscheinung handelt. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der nationalsozialistischen Propaganda und untersucht die Gestaltungspraxis dieser Zeit.
- Typografie als Ausdrucksmittel im Nationalsozialismus
- Die Instrumentalisierung typografischer Gestaltungselemente für Propagandazwecke
- Der Einfluss des totalitären Systems auf die Gestaltungspraxis
- Der Schriftstreit zwischen Fraktur und Antiqua
- Die Entwicklung und das Image der Frakturschrift im NS-Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach der Instrumentalisierung von Typografie im Nationalsozialismus. Sie umreißt den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit.
Typografische Gestaltung als Ausdrucksmittel: Dieses Kapitel untersucht die grundlegenden Aspekte typografischer Gestaltung und deren Wahrnehmung. Es beleuchtet den Einfluss von Typografie auf die visuelle Kommunikation und ihre potentielle Verwendung als Machtinstrument.
Typografische Gestaltung im Kontext des totalitären Systems: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Typografie und dem totalitären System des Nationalsozialismus. Es untersucht die Rolle von Propaganda und deren visuelle Umsetzung mittels typografischer Mittel. Es werden konkrete Beispiele der Gestaltungspraxis in der NS-Zeit aufgezeigt, um die Intentionen und Wirkungsweisen zu beleuchten.
Sonderfall nationalsozialistische Schriftpolitik: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit dem "Schriftstreit" im Nationalsozialismus, der Debatte um die Verwendung von Fraktur- und Antiqua-Schriftarten. Die Einführung des Frakturgebots 1933 und das spätere "Verbot" der Fraktur 1941 werden kritisch analysiert, sowie deren Auswirkungen auf das Image der Fraktur. Die komplexen Hintergründe und ideologischen Motivationen hinter diesen Maßnahmen werden erörtert.
Schlüsselwörter
Typografie, Nationalsozialismus, Propaganda, Schriftpolitik, Fraktur, Antiqua, Gestaltungspraxis, Machtausdruck, Totalitäres System, visuelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Typografische Gestaltung im Nationalsozialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Typografie im Nationalsozialismus. Sie analysiert, inwieweit typografische Gestaltungsmittel gezielt instrumentalisiert wurden und ob die beobachteten Gestaltungsmuster eher eine bloße Zeiterscheinung darstellen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Typografie als Ausdrucksmittel im Nationalsozialismus, die Instrumentalisierung typografischer Gestaltungselemente für Propagandazwecke, den Einfluss des totalitären Systems auf die Gestaltungspraxis, den Schriftstreit zwischen Fraktur und Antiqua sowie die Entwicklung und das Image der Frakturschrift im NS-Regime.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über typografische Gestaltung als Ausdrucksmittel, ein Kapitel über typografische Gestaltung im Kontext des totalitären Systems, einen Abschnitt zum Sonderfall der nationalsozialistischen Schriftpolitik und eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, skizziert die Forschungsfrage nach der Instrumentalisierung von Typografie im Nationalsozialismus, umreißt den methodischen Ansatz und die Struktur der Arbeit.
Worum geht es im Kapitel "Typografische Gestaltung als Ausdrucksmittel"?
Dieses Kapitel untersucht grundlegende Aspekte typografischer Gestaltung und deren Wahrnehmung. Es beleuchtet den Einfluss von Typografie auf die visuelle Kommunikation und deren potentielle Verwendung als Machtinstrument.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Typografische Gestaltung im Kontext des totalitären Systems"?
Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen Typografie und dem totalitären System des Nationalsozialismus. Es untersucht die Rolle der Propaganda und deren visuelle Umsetzung mittels typografischer Mittel und zeigt konkrete Beispiele der Gestaltungspraxis in der NS-Zeit.
Worauf konzentriert sich der Abschnitt "Sonderfall nationalsozialistische Schriftpolitik"?
Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit dem "Schriftstreit" im Nationalsozialismus, der Debatte um Fraktur und Antiqua. Das Frakturgebot 1933 und das "Verbot" der Fraktur 1941 werden kritisch analysiert, ebenso deren Auswirkungen auf das Image der Fraktur. Die ideologischen Motivationen hinter diesen Maßnahmen werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Typografie, Nationalsozialismus, Propaganda, Schriftpolitik, Fraktur, Antiqua, Gestaltungspraxis, Machtausdruck, Totalitäres System, visuelle Kommunikation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Typografie im Nationalsozialismus zu analysieren und zu untersuchen, inwieweit typografische Gestaltungsmittel instrumentalisiert wurden oder ob es sich um eine bloße Zeiterscheinung handelt.
- Quote paper
- Sarah Lisa Wierich (Author), 2013, Typografie im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230053