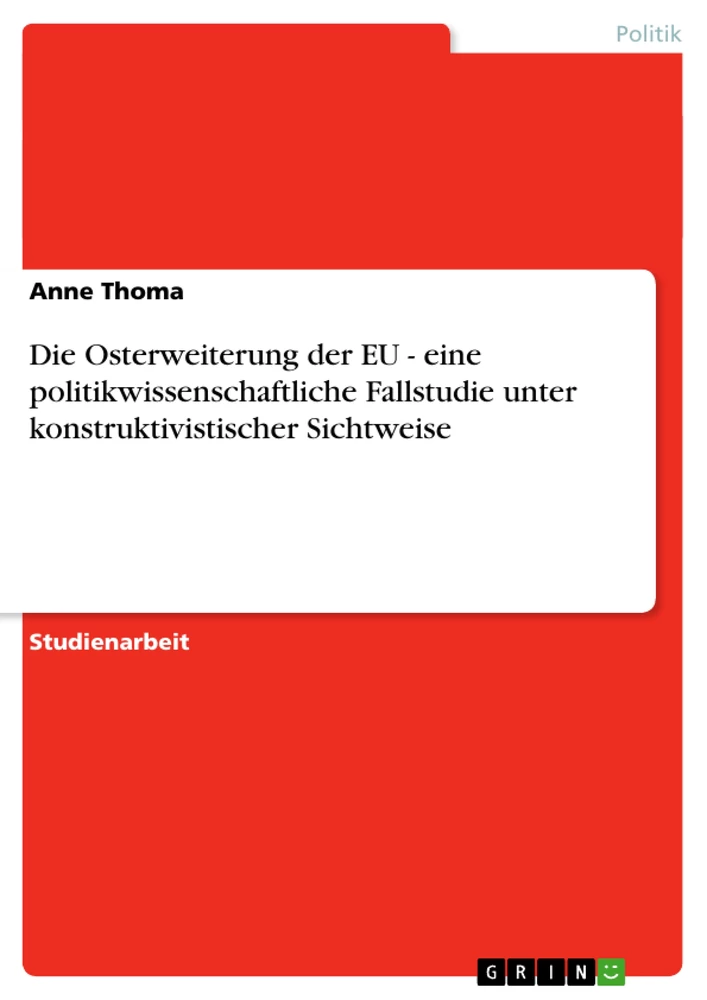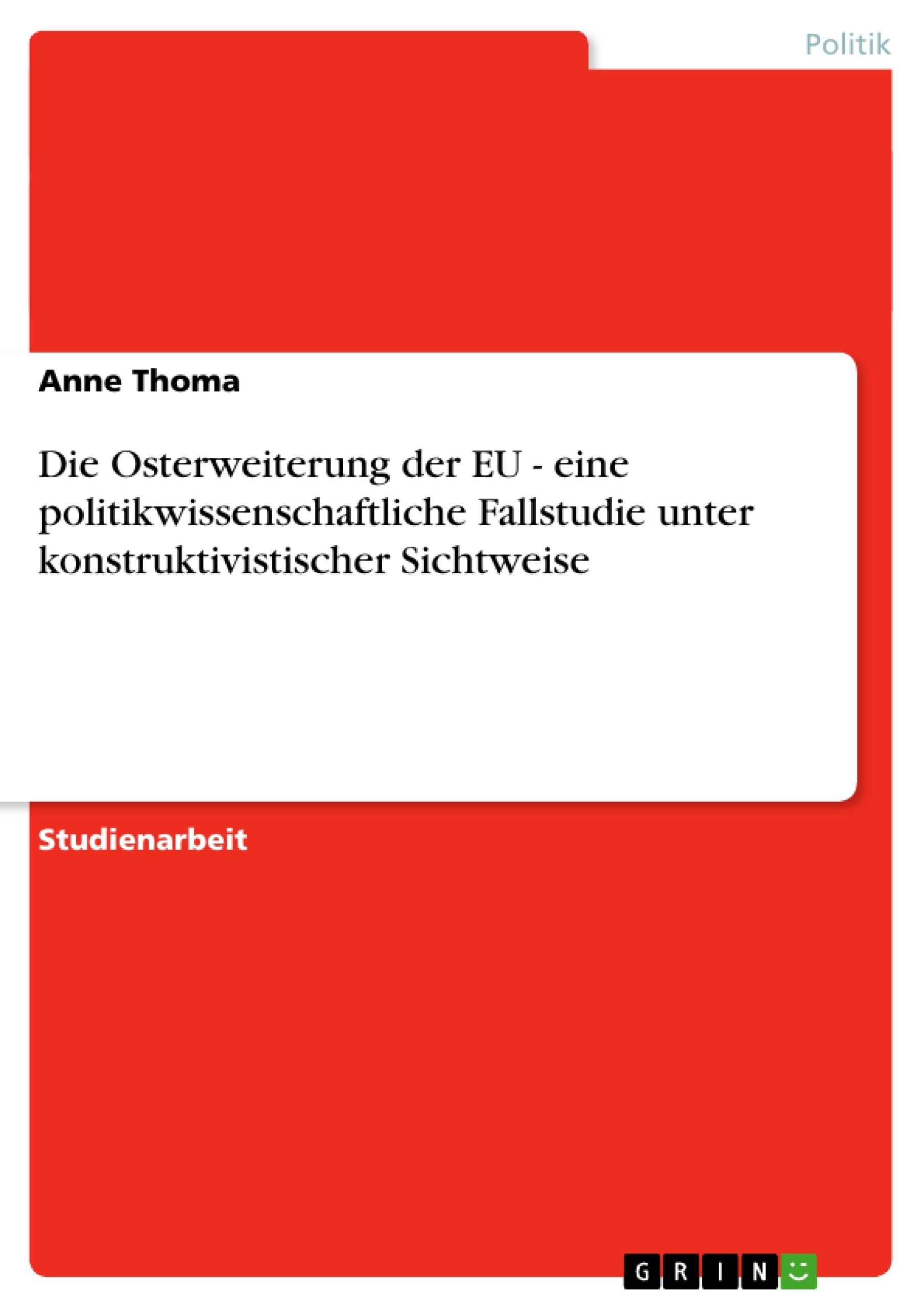Im April 2003 unterzeichneten in Athen zehn Länder die Urkunden für den Beitritt zur Europäischen Union: Zypern, Tschechien, Slowenien, Estland, Ungarn und Polen aus der ersten Verhandlungsrunde sowie Lettland, Litauen, Malta und die Slowakische Republik aus der zweiten. Zehn Jahre zuvor hatte sich die EU auf dem Kopenhagener Gipfel von 1993 erstmals öffentlich zu einer Erweiterung bereiterklärt, indem sie den MOEL (mittel- und osteuropäische Länder) ein politisches Beitrittsversprechen gab, wenngleich auch ein sehr schwammiges, was den Zeitrahmen und das Maß der politischen Beteiligung betraf (Lippert 2000, 115). Hatten sich die MOEL bis zu diesem Zeitpunkt noch mit Angeboten unterhalb der Mitgliedschaft zufrieden geben müssen, so konnten sie sich ab 1994 um den vollen Status bewerben.
Die endgültige Umsetzung des Beitritts war ein schleppender Prozess, weil er sich in Bezug auf drei Hauptbereiche für die EU als äußerst facettenreich darstellte. Diese sind die Finalitätsdebatte (wie soll das „Endprodukt EU“ aussehen?), die Machtverhältnisse innerhalb der Union (welche Folgen haben die notwendig werdenden institutionellen Reformen für die einzelnen Staaten?) und die Finanzen (wer wird von der Erweiterung profitieren, wer verlieren?). Ein Beispiel für Letzteres: Für Kohäsionsländer wie Spanien, Portugal, Griechenland und Irland, deren BSP unterhalb des EU-Durchschnitts liegt, wird der Gewinn minimal bleiben oder sie müssen mit Verlusten rechnen (Trautmann 1999, 58), denn „most of them [MOEL] would be entitled to money for their agriculture, and all of them would be net receivers of the structural, cohesion, and regional funds“ (Inotai 1998, 167). Deutschland hingegen darf bis zu einem Drittel des Gesamtgewinns der Erweiterung erwarten (Baldwin et al. 1997, 167). Dies mag eine Erklärung dafür sein, dass Teile der EU-Staaten als „breakmen“ auftraten und sich erst gegen die Integration der MOEL aussprachen, andere diesen Schritt jedoch stark befürworteten und als „drivers“ vorantrieben (Schimmelfennig 2001, 49). Aus diesem Sachverhalt ergibt sich dann die für diese Hausarbeit zentrale Fragestellung und zugleich das Explanandum: Warum kam es unter den alten EU-Staaten trotzdem zu einer Einigung, obwohl bis heute nicht geklärt ist, wie die institutionellen Reformen im Einzelnen aussehen werden (Sedelmeier 2001, 165)? Warum machten die potentiellen finanziellen Verlierer der Erweiterung nicht von ihrem Veto-Recht Gebrauch, um den Prozess scheitern zu lassen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallanalyse: Die Beweggründe der alten EU-Staaten für eine Osterweiterung
- Erweiterung als Ergebnis: Das Scheitern rationalistischer Ansätze
- Der Realismus
- Der Institutionalismus
- Der Liberalismus
- Erweiterung als Ergebnis: Die konstruktivistische Erklärung
- Erweiterung im Gesamtverlauf: Die Verkettung von Rationalismus und Konstruktivismus
- Erweiterung als Ergebnis: Das Scheitern rationalistischer Ansätze
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Osterweiterung der EU unter konstruktivistischer Perspektive und untersucht die Gründe für die Entscheidung der alten EU-Staaten, die Erweiterung zu unterstützen, trotz potenzieller finanzieller Verluste und ungeklärter institutioneller Reformen. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, warum rationalistische Ansätze das Ergebnis der Osterweiterung nicht erklären können und wie der Konstruktivismus alternative Erklärungen bietet.
- Das Scheitern rationalistischer Ansätze (Realismus, Institutionalismus, Liberalismus) bei der Erklärung der EU-Osterweiterung
- Die Bedeutung konstruktivistischer Faktoren (Ideen, Normen, Werte, Identitäten) für die Entscheidung der EU-Staaten
- Die Rolle von "rhetorical action" im Übergang von rationalistischen zu konstruktivistischen Argumenten
- Die Bedeutung von "we-feeling" und "kinship-based duty" für die Osterweiterung
- Die Analyse der "input" und "outcome" der Osterweiterung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Osterweiterung der EU im Jahr 2003 vor und skizziert die zentralen Herausforderungen und kontroversen Punkte, die mit dem Beitritt neuer Mitgliedsstaaten verbunden waren. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Perspektiven und Interessen der EU-Staaten, die zu einer komplexen und langwierigen Debatte über die Erweiterung führten.
Die Fallanalyse untersucht die Beweggründe der alten EU-Staaten für die Osterweiterung. In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass rationalistische Ansätze wie Realismus, Institutionalismus und Liberalismus nicht in der Lage sind, die Erweiterung allein zu erklären. Es wird argumentiert, dass die Erweiterung aus einer konstruktivistischen Perspektive besser zu verstehen ist, die die Bedeutung von Ideen, Normen und Werten betont.
Das Kapitel beleuchtet die Rolle des "we-feeling" und der "kinship-based duty" sowie den Einfluss von "rhetorical action" auf die Entscheidungen der EU-Staaten. Es zeigt auf, wie durch rhetorische Strategien und normative Argumente die Zustimmung zur Osterweiterung erzielt wurde und wie sich der Übergang von rationalistischen zu konstruktivistischen Argumenten vollzog.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Osterweiterung, Europäische Union, Konstruktivismus, Rationalismus, "we-feeling", "kinship-based duty", "rhetorical action", Ideen, Normen, Werte, Identitäten, Interessen, Macht, Sicherheit, Wohlfahrt.
- Quote paper
- Anne Thoma (Author), 2003, Die Osterweiterung der EU - eine politikwissenschaftliche Fallstudie unter konstruktivistischer Sichtweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22993