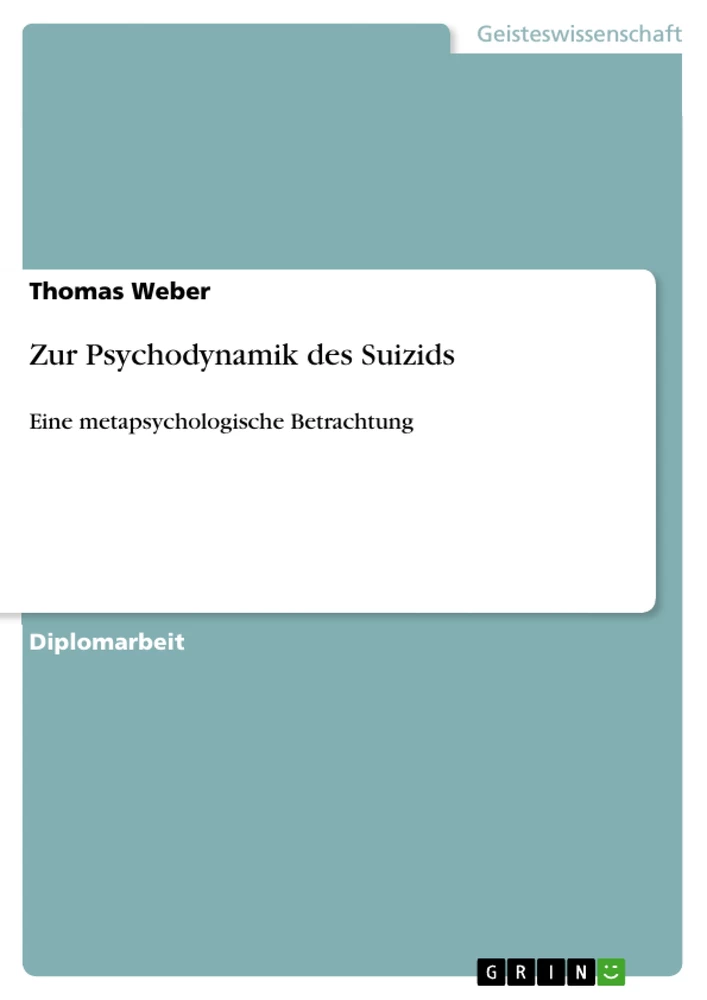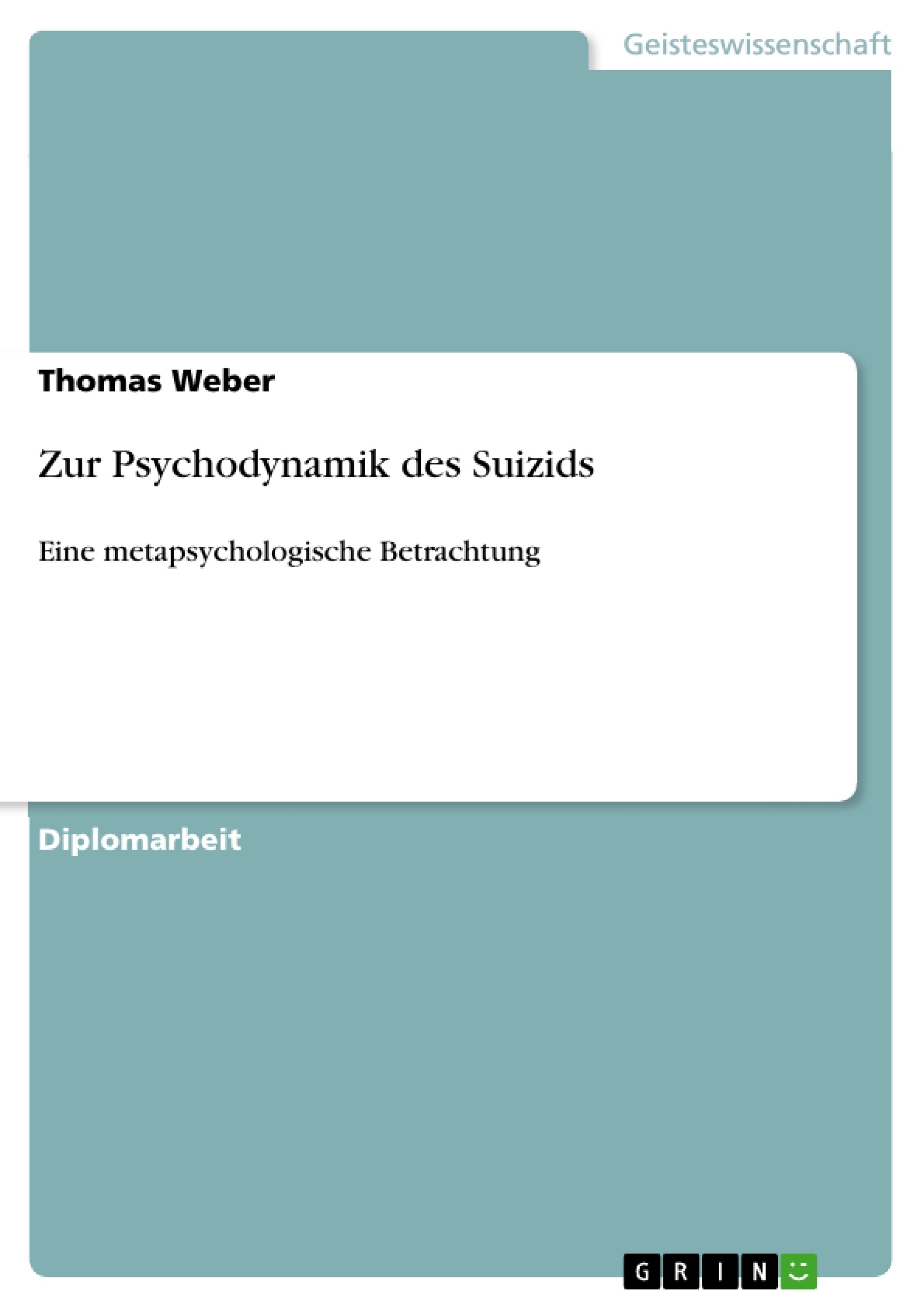Der Autor beschäftigt sich anhand ausgewählter psychoanalytischer Konzepte (Aggressionskonflikt, Ambivalenzkonflikt, Objektverlust, Objekbeziehungstheorie und Narzissmus) mit psychodynamisch fundierten Erklärungsversuchen für suizidales Handeln: Freud, Kernberg, Kohut, Henseler, Balint, etc.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychodynamik
- 2.1 Die fünf zum Suizid führenden Phantasien
- 2.2 Die Stadien des suizidalen Prozesses
- 3. Erste Ansätze bei Freud
- 4. Weitere Arbeiten zum Aggressionskonflikt und zur Feindseligkeit
- 4.1 Klinische Implikationen
- 5. Objektbeziehungstheorie
- 5.1 Fallbeispiel
- 6. Narzissmus und narzisstische Suizidalität
- 6.1 Die Motivstruktur suizidalen Handelns
- 7. Interaktionalität und Intersubjektivität
- 7.1 Exkurs: Die Vaterübertragung im präsuizidalen Zustand
- 8. Zusammenfassung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Psychodynamik des Suizids anhand ausgewählter psychoanalytischer Konzepte. Ziel ist es, die metapsychologischen Grundlagen der Es- und Ich-Psychologie im Kontext der Suizidalität zu erläutern und die Beiträge verschiedener theoretischer Ansätze zum Verständnis suizidaler Psychodynamik zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei die wissenschaftshistorischen Kontexte und veranschaulicht die Konzepte anhand von Fallbeispielen.
- Melancholiekonzept Sigmund Freuds
- Aggressionskonflikt und Feindseligkeit
- Objektbeziehungstheorie
- Narzissmus und narzisstische Suizidalität
- Interaktionalität und Intersubjektivität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Entstehungshintergrund der Arbeit, ausgehend von den Erfahrungen des Autors während seines Psychologie-Studiums. Sie führt in die Thematik der Psychodynamik und ihrer Relevanz für das Verständnis seelischer Erkrankungen, inklusive Suizidalität, ein. Die Arbeit wird als Beitrag zur Vorbereitung auf die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten positioniert, wobei der Fokus auf psychodynamischen Wirkmechanismen und metapsychologischen Aspekten liegt. Spezifische Aspekte des Suizids (z.B. Suizid im hohen Alter oder sozial erzwungene Suizidalität) werden explizit ausgeschlossen.
2. Psychodynamik: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Psychodynamik und ihre Relevanz für Suizidalität. Es wird ein kritischer Vergleich mit der rein symptomorientierten Perspektive gängiger Diagnosemanuale (ICD 10 und DSM IV) angestellt. Die Bedeutung von Symptomen als Ausdruck innerer Konflikte und mögliche stabilisierende Funktionen von Suizidalität werden diskutiert. Der Autor verwendet das Beispiel eines Morphinisten, der sich aus einem Versündigungswahn heraus umbringt, um die Komplexität psychodynamischer Prozesse im Kontext von Suizidalität zu veranschaulichen.
3. Erste Ansätze bei Freud: Dieses Kapitel behandelt Freuds grundlegende Arbeiten zur Suizidologie. Die Konzepte des Aggressionskonfliktes, des Ambivalenzkonfliktes und des Objektverlustes nach narzisstischer Objektwahl werden im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Verständnis von Melancholie und daraus resultierender Suizidalität diskutiert und im Kontext der wissenschaftlichen Diskussion der letzten 100 Jahre eingeordnet.
4. Weitere Arbeiten zum Aggressionskonflikt und zur Feindseligkeit: Dieses Kapitel erweitert die Betrachtung des Aggressionskonflikts und beleuchtet klinische Implikationen. Ein Fallbeispiel eines US-Amerikaners aus den 1930er Jahren, der einen Selbstmordversuch unternimmt und anschließend seine Tochter tötet, wird analysiert, um die komplexen Interaktionen zwischen Aggression, Selbstzerstörung und anderen Personen zu veranschaulichen.
5. Objektbeziehungstheorie: Dieses Kapitel skizziert die Objektbeziehungstheorie anhand eines Fallbeispiels einer Frau mit Borderline-Diagnose. Der Fokus liegt auf der Analyse der Beziehung der Patientin zu ihren Eltern und der Rolle dieser Beziehung in der Entwicklung ihrer psychischen Erkrankung. Das Beispiel veranschaulicht, wie frühkindliche Erfahrungen und gestörte Objektbeziehungen zur Entwicklung einer suizidalen Disposition beitragen können.
6. Narzissmus und narzisstische Suizidalität: In diesem Kapitel werden die klinischen Implikationen von nicht positiv integriertem Narzissmus (im Sinne Kernbergs) und der Unfähigkeit, ein grandioses Größenselbst (im Sinne Kohuts) zu betrauern, im Zusammenhang mit Berufswahl und Erwachsenwerden reflektiert. Es wird die Rolle des Narzissmus bei der Entstehung suizidaler Tendenzen beleuchtet.
7. Interaktionalität und Intersubjektivität: Dieses Kapitel befasst sich mit Aspekten der Interaktionalität und Intersubjektivität im Kontext von Triangulierung, System, Gruppe, Lebenssinn und Entfremdung. Es analysiert die Bedeutung von Beziehungen und sozialen Kontexten für das Verständnis und die Behandlung von Suizidalität und behandelt explizit die Vaterübertragung im präsuizidalen Zustand.
Schlüsselwörter
Psychodynamik, Suizid, Melancholie, Aggressionskonflikt, Objektbeziehungstheorie, Narzissmus, Interaktionalität, Intersubjektivität, Freud, Metapsychologie, klinische Implikationen, Fallbeispiele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Psychodynamik des Suizids
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Psychodynamik des Suizids anhand ausgewählter psychoanalytischer Konzepte. Sie beleuchtet die metapsychologischen Grundlagen der Es- und Ich-Psychologie im Kontext der Suizidalität und die Beiträge verschiedener theoretischer Ansätze zum Verständnis suizidaler Psychodynamik. Dabei werden wissenschaftshistorische Kontexte berücksichtigt und die Konzepte anhand von Fallbeispielen veranschaulicht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Melancholiekonzept Sigmund Freuds, den Aggressionskonflikt und die Feindseligkeit, die Objektbeziehungstheorie, den Narzissmus und narzisstische Suizidalität sowie Interaktionalität und Intersubjektivität im Kontext von Suizid.
Welche psychoanalytischen Konzepte werden untersucht?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene psychoanalytische Konzepte, darunter Freuds Theorien zu Melancholie, Aggressionskonflikt und Objektverlust, die Objektbeziehungstheorie, die Konzepte von Narzissmus (Kernberg und Kohut) und die Bedeutung von Interaktionalität und Intersubjektivität für das Verständnis suizidaler Tendenzen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Psychodynamik, Erste Ansätze bei Freud, Weitere Arbeiten zum Aggressionskonflikt und zur Feindseligkeit, Objektbeziehungstheorie, Narzissmus und narzisstische Suizidalität, Interaktionalität und Intersubjektivität und schließlich Zusammenfassung und Diskussion. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt und in einer Zusammenfassung der Kapitel nochmal kurz erläutert.
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Arbeit verwendet mehrere Fallbeispiele, um die theoretischen Konzepte zu veranschaulichen. Beispiele beinhalten einen Morphinisten, der sich aus einem Versündigungswahn heraus umbringt, einen US-Amerikaner aus den 1930er Jahren, der einen Selbstmordversuch unternimmt und anschließend seine Tochter tötet, und eine Frau mit Borderline-Diagnose.
Welche Aspekte des Suizids werden NICHT behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich explizit nicht auf spezifische Aspekte des Suizids wie Suizid im hohen Alter oder sozial erzwungene Suizidalität. Der Fokus liegt auf den psychodynamischen Aspekten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Psychodynamik, Suizid, Melancholie, Aggressionskonflikt, Objektbeziehungstheorie, Narzissmus, Interaktionalität, Intersubjektivität, Freud, Metapsychologie, klinische Implikationen, Fallbeispiele.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit ist als Beitrag zur Vorbereitung auf die Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten konzipiert und richtet sich an Personen, die sich mit psychodynamischen Wirkmechanismen und metapsychologischen Aspekten im Kontext von Suizidalität auseinandersetzen möchten.
Wie wird der Vergleich mit anderen Perspektiven, z.B. der ICD-10 und DSM-IV, dargestellt?
Die Arbeit stellt einen kritischen Vergleich mit der rein symptomorientierten Perspektive gängiger Diagnosemanuale (ICD 10 und DSM IV) an, um die Bedeutung von Symptomen als Ausdruck innerer Konflikte und mögliche stabilisierende Funktionen von Suizidalität zu diskutieren.
Welche Rolle spielt die Vaterübertragung?
Die Rolle der Vaterübertragung im präsuizidalen Zustand wird explizit im Kapitel über Interaktionalität und Intersubjektivität behandelt.
- Quote paper
- Thomas Weber (Author), 2013, Zur Psychodynamik des Suizids, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229890