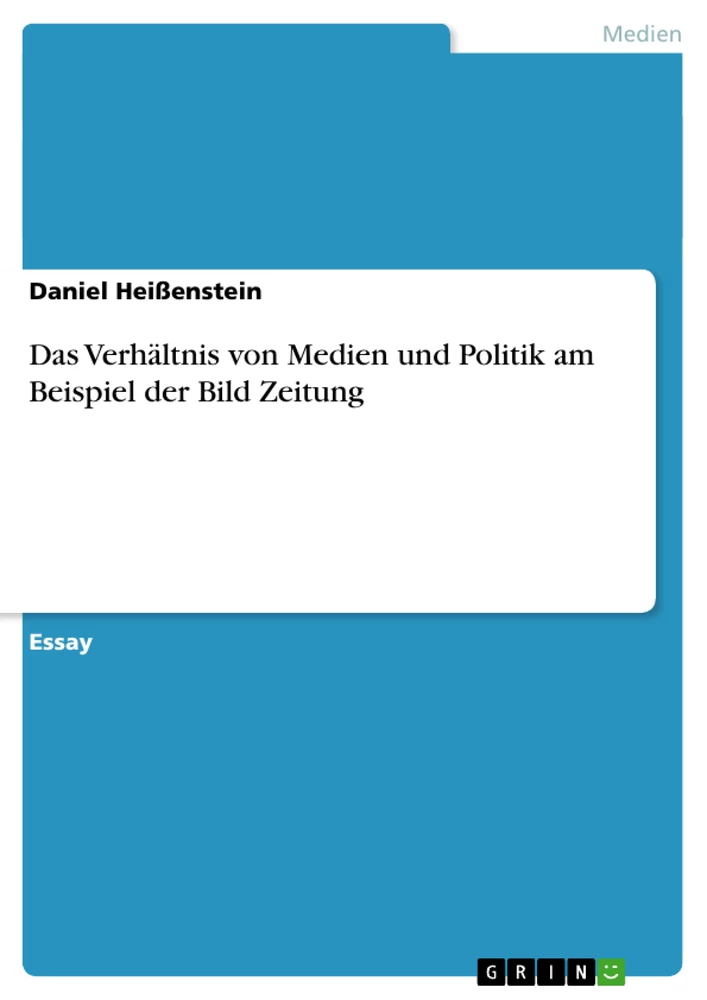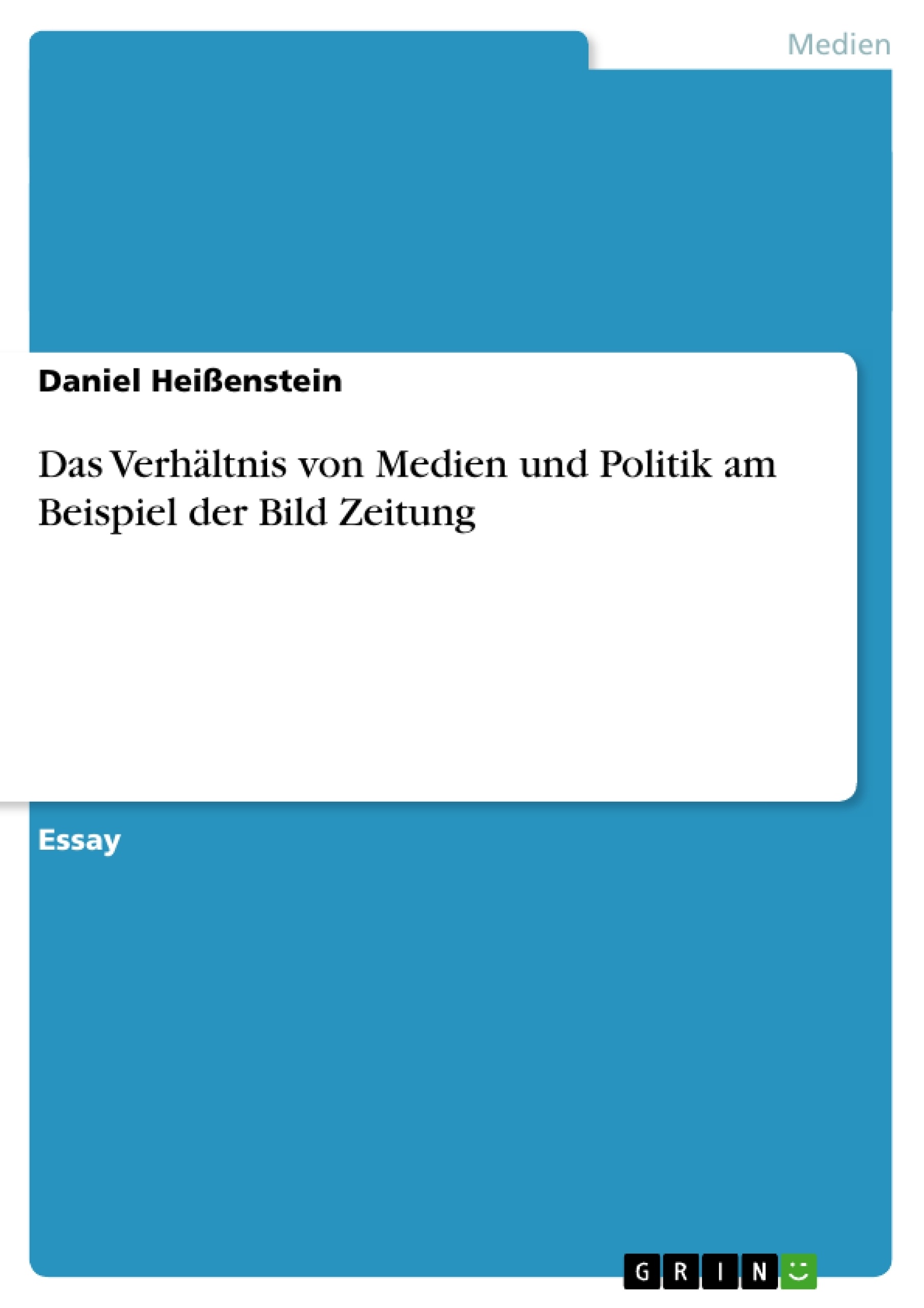Das Verhältnis von Medien und Politik am Beispiel der BILD-Zeitung
Die Medien gelten als vierte Säule des Staates, als vierte Gewalt. Diese These von Rousseau ist nicht neu, wird aber immer wieder aktuell. Momentan trägt die BILD-Zeitung ihren Teil dazu bei, indem sie teilweise eine fragwürdige Nähe oder Feindschaften zu Politikern pflegt. Dabei sind die Systeme Medien und Politik aufeinander angewiesen. Normalerweise besteht zwischen beiden Seiten daher eine professionelle, berufliche Beziehung. Im Falle der BILD-Zeitung werden die Verbindungen teilweise informell und persönlicher. Daher ist eine Erörterung der Konsequenzen einer dergestalt geänderten Beziehung zwischen Medien und Politik erforderlich und medienwissenschaftlich relevant.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Verhältnis von Medien und Politik am Beispiel der BILD-Zeitung
- 2. Die vier Kategorien von Politikern in der BILD-Zeitung
- 3. Die Konsequenzen der Berichterstattung der BILD-Zeitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis zwischen Medien und Politik anhand der Berichterstattung der BILD-Zeitung. Sie analysiert die Strategien der Zeitung und deren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Politikern. Die Arbeit beleuchtet die Konsequenzen dieser Berichterstattung für den Journalismus und die Demokratie.
- Die unterschiedlichen Beziehungen zwischen der BILD-Zeitung und verschiedenen Politikern
- Die journalistischen Standards und deren Einhaltung (oder Verletzung) durch die BILD-Zeitung
- Der Einfluss der BILD-Zeitung auf die öffentliche Meinung und die politische Landschaft
- Die Folgen von parteiischer und manipulativer Berichterstattung
- Die Rolle der BILD-Zeitung als "vierte Gewalt"
Zusammenfassung der Kapitel
1. Das Verhältnis von Medien und Politik am Beispiel der BILD-Zeitung: Dieses Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen Medien und Politik, insbesondere die oft fragwürdige Nähe der BILD-Zeitung zu Politikern. Es stellt die These auf, dass die BILD-Zeitung nicht immer die journalistischen Prinzipien der Objektivität und Wahrheitsfindung einhält, stattdessen emotionale Polarisierung und Provokation bevorzugt. Das Kapitel veranschaulicht dies durch Beispiele wie die Berichterstattung über Karl-Theodor zu Guttenberg, welche als beispiellose Symbiose zwischen Politiker und Medium dargestellt wird, geprägt von positiven Schlagzeilen und Exklusivität im Austausch gegen positive PR für Guttenberg. Die Grenzwertigkeit dieser Zusammenarbeit wird deutlich, besonders in Bezug auf Guttenbergs Ankündigung, Anzeigen für die Bundeswehr in der BILD zu schalten, was die Nähe zur Vetternwirtschaft aufzeigt. Der Höhepunkt dieser positiven Berichterstattung zeigt sich während der Plagiatsaffäre, wo die BILD-Zeitung jegliche journalistischen Prinzipien aufgab, um Guttenberg zu schützen, sogar Umfragen manipulierend.
2. Die vier Kategorien von Politikern in der BILD-Zeitung: Dieses Kapitel beschreibt die vier Kategorien, in die die BILD-Zeitung Politiker einteilt: BILD-Freunde, BILD-Feinde, BILD-Neutrale und BILD-Aufzugfahrer. Die Kategorisierung basiert auf der Kooperationsbereitschaft des Politikers mit der Zeitung und dem vorhandenen Skandalpotential. BILD-Freunde erhalten positive Berichterstattung im Austausch für Exklusivität und Zugang zu Informationen, während BILD-Feinde negativ und oft unfair dargestellt werden. BILD-Neutrale werden eher neutral behandelt, während BILD-Aufzugfahrer zunächst positiv, später bei Bedarf negativ dargestellt werden, um die Auflage zu steigern, wie im Beispiel Christian Wulff. Dieses Kapitel unterstreicht, wie die BILD-Zeitung die Objektivität im Journalismus zugunsten der Auflagenmaximierung vernachlässigt und somit die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung in Frage stellt.
3. Die Konsequenzen der Berichterstattung der BILD-Zeitung: Das Kapitel fasst die Konsequenzen der parteiischen und manipulativen Berichterstattung der BILD-Zeitung zusammen. Es argumentiert, dass diese Berichterstattung den Journalismus als Institution beschädigt und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien untergräbt. Die Gier nach hohen Auflagenzahlen steht im Vordergrund, während ethische und verantwortungsvolle Berichterstattung vernachlässigt werden. Die Arbeit endet mit der Feststellung, dass die BILD-Zeitung die Rolle der "vierten Gewalt" missbraucht und ihren Auftrag der unabhängigen und objektiven Information der Öffentlichkeit nicht erfüllt. Die dargestellten Beispiele von Manipulation und bewusster Falschdarstellung von Politikern unterstreichen die gravierenden Folgen dieser Berichterstattung für das demokratische System.
Schlüsselwörter
BILD-Zeitung, Medien und Politik, Journalismus, Objektivität, Manipulation, Parteilichkeit, Karl-Theodor zu Guttenberg, Jürgen Trittin, Christian Wulff, Auflagenmaximierung, vierte Gewalt, Pressekodex, politische Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der BILD-Zeitung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Verhältnis zwischen Medien und Politik anhand der Berichterstattung der BILD-Zeitung. Sie untersucht die Strategien der Zeitung, ihren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung von Politikern und die Konsequenzen dieser Berichterstattung für den Journalismus und die Demokratie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Beziehungen zwischen der BILD-Zeitung und verschiedenen Politikern, die Einhaltung (oder Verletzung) journalistischer Standards, den Einfluss der BILD-Zeitung auf die öffentliche Meinung und die politische Landschaft, die Folgen parteiischer und manipulativer Berichterstattung und die Rolle der BILD-Zeitung als "vierte Gewalt".
Wie gliedert sich die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Kapitel 1 untersucht das Verhältnis von Medien und Politik am Beispiel der BILD-Zeitung und deren oft fragwürdige Nähe zu Politikern. Kapitel 2 beschreibt vier Kategorien von Politikern in der BILD-Zeitung (BILD-Freunde, BILD-Feinde, BILD-Neutrale und BILD-Aufzugfahrer) basierend auf der Kooperationsbereitschaft und dem Skandalpotential. Kapitel 3 fasst die Konsequenzen der parteiischen und manipulativen Berichterstattung zusammen, einschließlich der Schädigung des Journalismus und des Vertrauensverlustes der Öffentlichkeit.
Welche Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet mehrere Beispiele, um ihre Argumente zu veranschaulichen. Besonders hervorgehoben wird die Berichterstattung über Karl-Theodor zu Guttenberg, die als symbiotische Beziehung zwischen Politiker und Medium dargestellt wird. Weitere Beispiele sind die Behandlung von Jürgen Trittin und Christian Wulff, um die unterschiedlichen Kategorien von Politikern in der BILD-Zeitung zu veranschaulichen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die BILD-Zeitung die Rolle der "vierten Gewalt" missbraucht und ihren Auftrag der unabhängigen und objektiven Information der Öffentlichkeit nicht erfüllt. Die Gier nach hohen Auflagenzahlen geht zu Lasten ethischer und verantwortungsvoller Berichterstattung, was gravierende Folgen für das demokratische System hat.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: BILD-Zeitung, Medien und Politik, Journalismus, Objektivität, Manipulation, Parteilichkeit, Karl-Theodor zu Guttenberg, Jürgen Trittin, Christian Wulff, Auflagenmaximierung, vierte Gewalt, Pressekodex, politische Berichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit.
- Citation du texte
- Daniel Heißenstein (Auteur), 2012, Das Verhältnis von Medien und Politik am Beispiel der Bild Zeitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229862