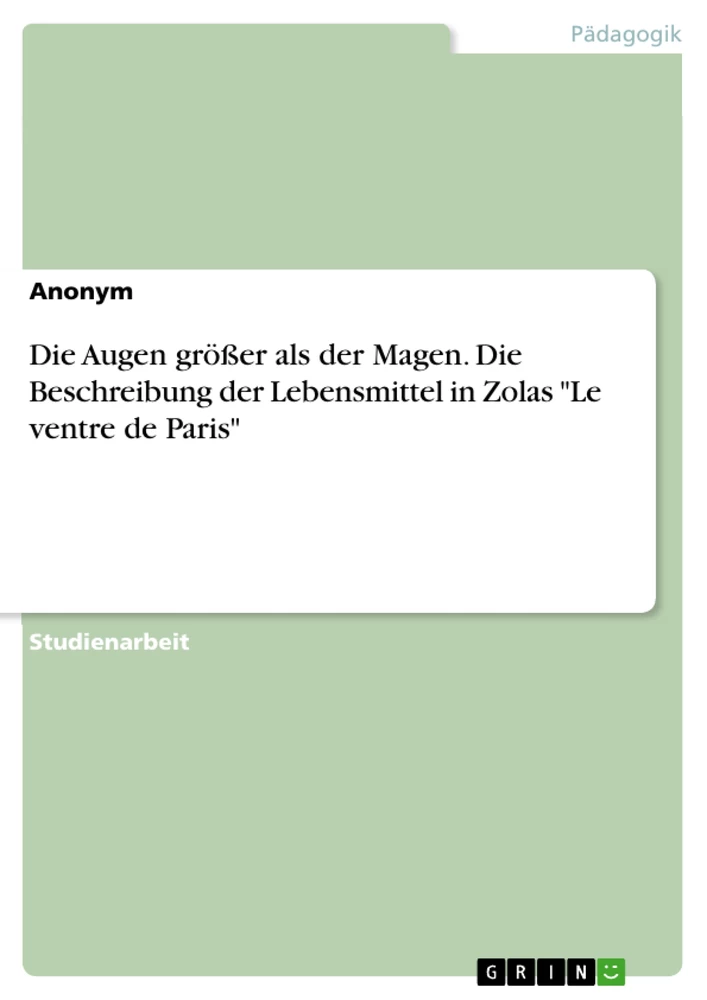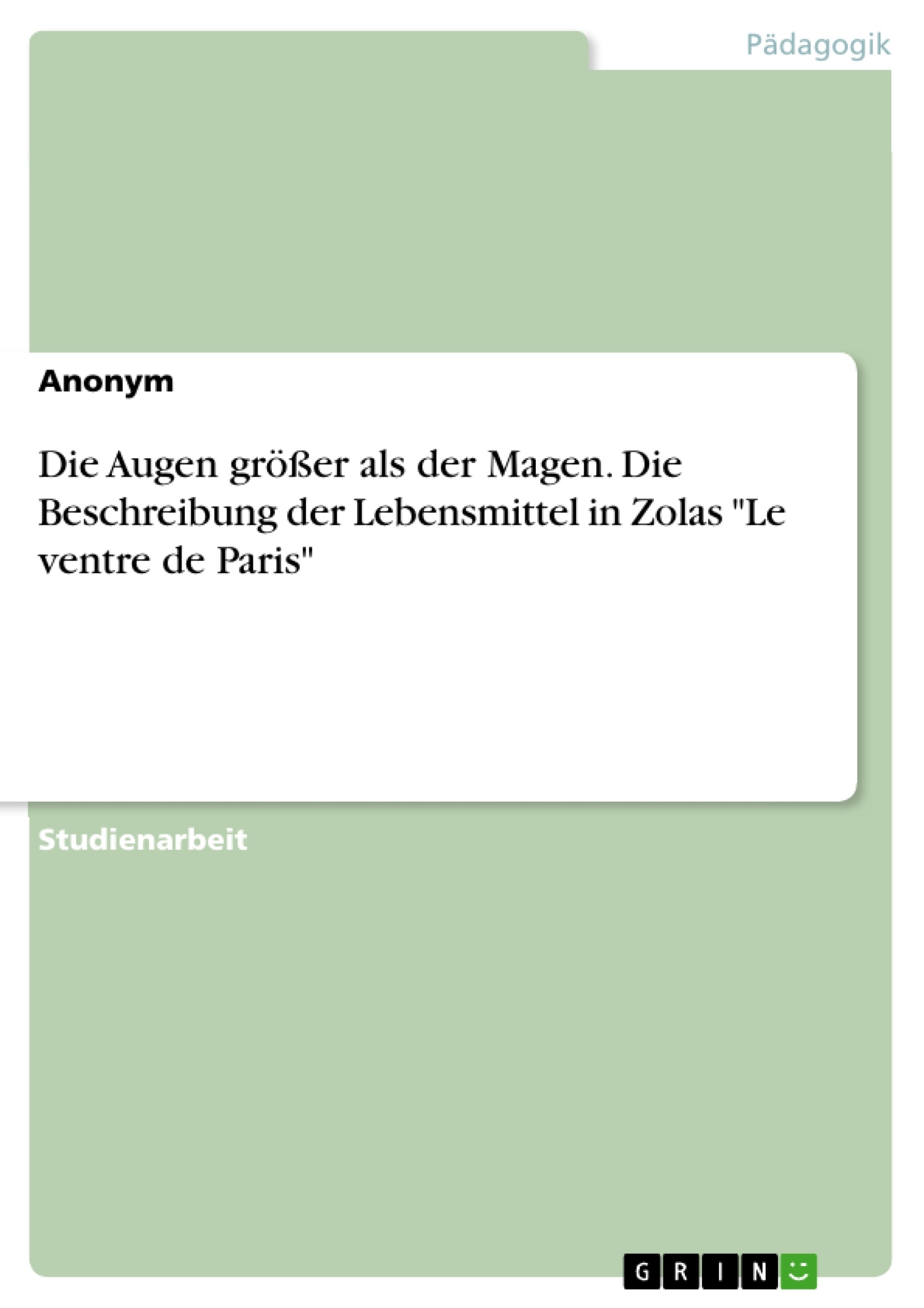Ein scheinbar von Geisterhand vorbeiziehender Gemüsezug, der sich in Richtung der Markthallen von Paris bewegt, Berge von Kohl, Rüben und Erbsen; bereits das Incipit des Romans Le Ventre de Paris von Émile Zola, dem dritten Roman im Zyklus der Rougon-Macquart, konfrontiert den Leser mit dessen Besonderheit: seitenlange Beschreibungen von Lebensmitteln in für damalige Verhältnisse unbekanntem Ausmaß.
Besonders auffällig ist hier, dass der Fokus dieser Deskription von den menschlichen Aktanten auf die an sich leblosen Details des Hintergrundes verschoben ist. Die verschiedenen Gemüsesorten, die „tombereau de choux“, „tombereau de pois“ und die Wagen voll „navets et carottes“, diese fast schon verselbstständigte „nourriture qui passait“, lässt die Menschen in den Hintergrund treten, sodass deren Aktantenstatus auf die Lebensmittel überzugehen scheint. Nun sind es gerade solche Beschreibungen des Umfeldes, die in der Literatur des Realismus und Naturalismus, in einer als „écriture à la poursuite du réel“ charakterisierten Schreibweise, verstärkt an Bedeutung gewinnen und bei der Analyse der Romane Émile Zolas, einem der größten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, besondere Beachtung verdienen. Wie Hamon, einer der wichtigsten Theoretiker auf dem Gebiet der Ästhetik des realistischen Romans und besonders der Deskription, passend anmerkt, sind es aber die oft seitenlangen und als überladen oder schwerfällig empfundenen beschreibenden Passagen „qui se saute[nt]“ . In der vorliegenden Arbeit nun sollen eben diese Beschreibungen nicht übersprungen, sondern genauer unter die Lupe genommen werden. Dabei sollen basierend auf einer kurzen Ausführung zur Theorie der Deskription und zur Ästhetik Zolas die Systematik der Beschreibung der Lebensmittel im Ventre de Paris herausgearbeitet sowie anhand ausgewählter Textstellen vor allem ihre Funktion für die Charakterisierung der Figuren und das narrative Handlungsgeschehen untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Deskription
- Zola und die Deskription
- Die Beschreibung der Lebensmittel im Ventre de Paris
- ,,Die Augen größer als der Magen“: die Ästhetik Zolas
- Lebensmittel und Milieu: „Du bist, was du verkaufst“
- Lisa, die fleischgewordene Metzgersfrau
- Louise, weder Fleisch noch Fisch
- La Sarriette, das Mädchen mit den Kirschohrringen
- Metaphorisierung der Lebensmittel: Die Poesie des Essens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die detaillierten Beschreibungen von Lebensmitteln in Émile Zolas Roman "Le Ventre de Paris". Ziel ist es, die Funktion dieser Beschreibungen für die Charakterisierung der Figuren und das narrative Handlungsgeschehen zu analysieren. Dabei wird die Systematik der Beschreibungen im Kontext der Theorie der Deskription und der Ästhetik Zolas betrachtet.
- Die Theorie der Deskription im Realismus und Naturalismus
- Zolas Schreibstil und seine Verwendung von Beschreibungen
- Die Funktion von Lebensmittelbeschreibungen in der Charakterisierung
- Die Rolle der Lebensmittelbeschreibungen für das narrative Geschehen
- Die Ästhetik der Lebensmittelbeschreibungen bei Zola
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Analyse der ausführlichen Lebensmittelbeschreibungen in Zolas "Le Ventre de Paris". Sie hebt die Besonderheit des Romans hervor, der sich durch seitenlange, detailreiche Schilderungen von Lebensmitteln auszeichnet, die im Kontext des Realismus und Naturalismus besondere Beachtung verdienen. Der Fokus der Einleitung liegt auf der Verschiebung der Aufmerksamkeit von menschlichen Akteuren hin zu den beschriebenen Objekten, was durch Beispiele aus dem Roman verdeutlicht wird. Die Einleitung umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf einer kurzen Ausführung zur Theorie der Deskription und der Ästhetik Zolas basiert.
Die Deskription: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Grundlage für die Analyse der Beschreibungen in Zolas Roman. Es definiert den Begriff der Deskription und erläutert ihre Funktion, dem Leser ein detailliertes Bild der erzählten Welt zu vermitteln und ihn in diese einzutauchen. Es werden verschiedene Aspekte der Deskription behandelt, wie die Verwendung von Sinnesbeschreibungen, der Wechsel des Erzähltempos, spezifisches Vokabular und rhetorische Figuren. Das Kapitel betont die Rolle des Beobachters in der Deskription und wie dieser die Wahrnehmung der beschriebenen Objekte beeinflusst. Es dient als methodische Grundlage für die anschließende Analyse der Lebensmittelbeschreibungen in "Le Ventre de Paris".
Zola und die Deskription: Dieses Kapitel widmet sich der spezifischen Verwendung von Beschreibungen in Zolas Werk. Es hebt Zolas Vorliebe für detailreiche und umfassende Beschreibungen hervor, die als charakteristisches Merkmal seines naturalistischen Stils gelten. Der Fokus liegt auf der Analyse von Zolas Schreibweise und der Funktion seiner Beschreibungen für die Gestaltung seiner Romane. Das Kapitel verbindet die theoretischen Grundlagen aus dem vorhergehenden Kapitel mit der spezifischen Praxis Zolas und bereitet den Weg für die detaillierte Analyse der Lebensmittelbeschreibungen im "Ventre de Paris".
Schlüsselwörter
Émile Zola, Le Ventre de Paris, Naturalismus, Realismus, Deskription, Lebensmittelbeschreibungen, Charakterisierung, Erzähltechnik, Ästhetik, Milieu, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zu "Le Ventre de Paris": Eine Analyse der Lebensmittelbeschreibungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die detaillierten Beschreibungen von Lebensmitteln in Émile Zolas Roman "Le Ventre de Paris". Im Mittelpunkt steht die Funktion dieser Beschreibungen für die Charakterisierung der Figuren und das narrative Handlungsgeschehen im Kontext der Theorie der Deskription und Zolas Ästhetik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Theorie der Deskription im Realismus und Naturalismus, Zolas Schreibstil und seine Verwendung von Beschreibungen, die Funktion von Lebensmittelbeschreibungen in der Charakterisierung, die Rolle der Lebensmittelbeschreibungen für das narrative Geschehen und die Ästhetik der Lebensmittelbeschreibungen bei Zola. Konkret werden die Beschreibungen von Lebensmitteln in Bezug auf ihre ästhetische Wirkung, ihre Rolle bei der Charakterisierung der Figuren und ihren Beitrag zur Handlung analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie der Deskription, ein Kapitel zu Zola und seiner Verwendung von Beschreibungen, ein Kapitel zur detaillierten Analyse der Lebensmittelbeschreibungen in "Le Ventre de Paris" (unterteilt in Unterkapitel zu Zolas Ästhetik, Lebensmittel und Milieu sowie der Metaphorisierung von Lebensmitteln) und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die ausführlichen und detailreichen Schilderungen von Lebensmitteln in "Le Ventre de Paris". Es werden spezifische Beispiele aus dem Roman herangezogen, um die Funktion und Wirkung dieser Beschreibungen zu veranschaulichen. Es werden auch Figuren wie Lisa (die Metzgersfrau), Louise und La Sarriette im Kontext der Lebensmittelbeschreibungen betrachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Theorie der Deskription im Realismus und Naturalismus. Sie analysiert Zolas Schreibstil und seine ästhetischen Prinzipien, um die Funktion und Bedeutung der Lebensmittelbeschreibungen zu verstehen. Die Analyse bezieht verschiedene Aspekte der Deskription mit ein, wie die Verwendung von Sinnesbeschreibungen, das Erzähltempo, das Vokabular und rhetorische Figuren.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Analyse der ausführlichen Lebensmittelbeschreibungen in Zolas "Le Vendre de Paris" und deren Funktion für die Charakterisierung der Figuren und das narrative Handlungsgeschehen. Die Arbeit untersucht, wie diese Beschreibungen zum Verständnis des Romans beitragen und welche Rolle sie im Kontext des Realismus und Naturalismus spielen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Émile Zola, Le Ventre de Paris, Naturalismus, Realismus, Deskription, Lebensmittelbeschreibungen, Charakterisierung, Erzähltechnik, Ästhetik, Milieu, Metapher.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Die Augen größer als der Magen. Die Beschreibung der Lebensmittel in Zolas "Le ventre de Paris", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229848