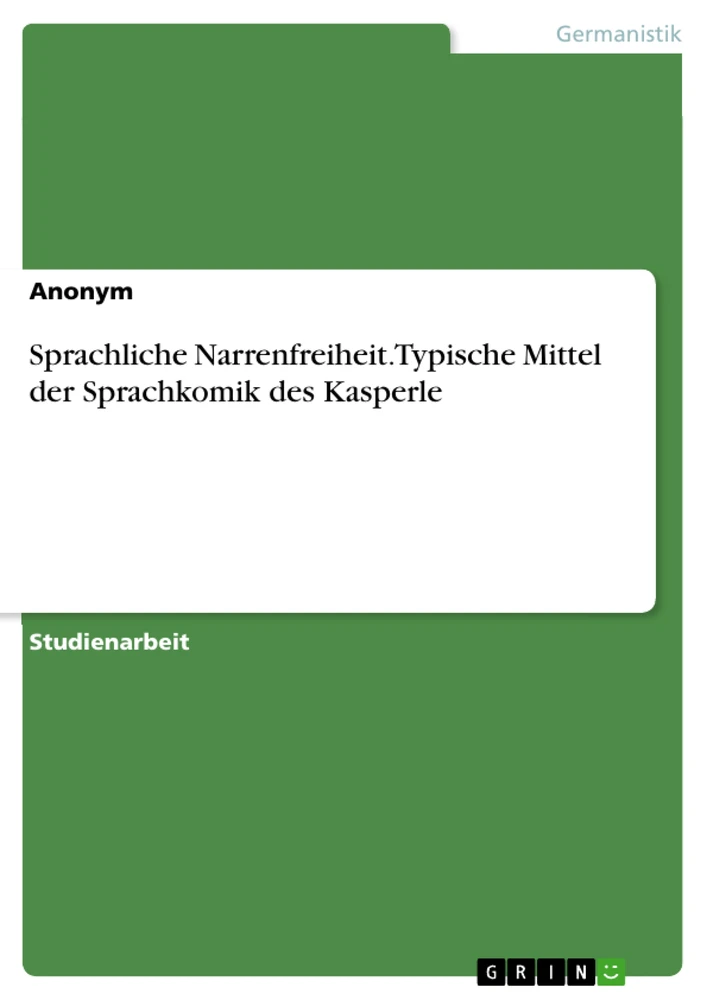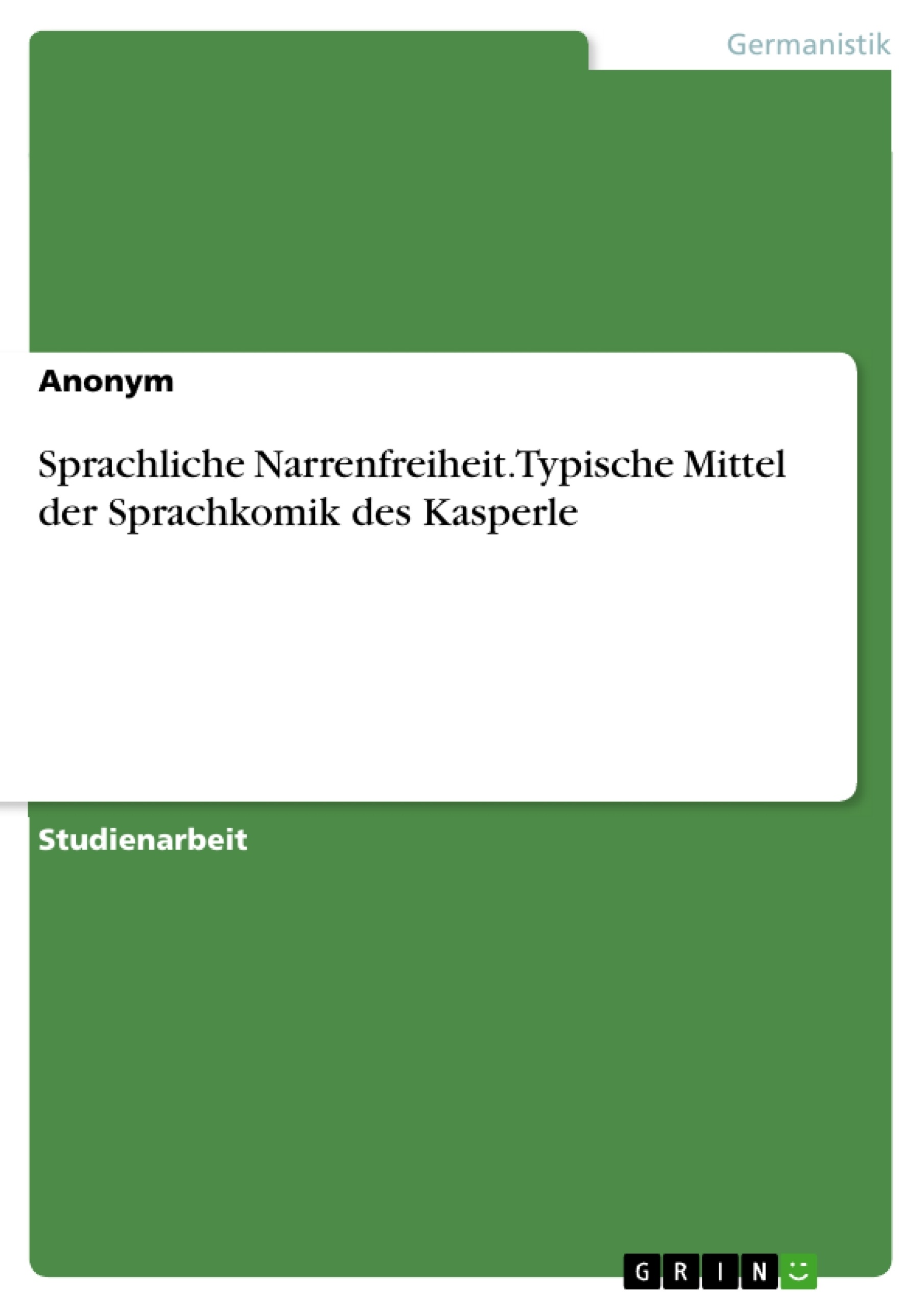Die komische Figur des Hanswurst und sein gezähmter Nachfahre Kasper sind allseits bekannte und beliebte Typen der deutschen Komödie, speziell der Hanswurstiaden oder des Kaspertheaters, auch in Form des Puppenspiels. Dabei übernehmen sie die Rolle des Narren, der das Publikum, ob groß oder klein, auf vielfältige Weise zum Lachen bringt. Neben seinem Kostüm, komischen Verhaltensweisen und teils illusionsbrechenden Eingriffen in das Theatergeschehen ist auch die Sprache von Hanswurst und ihm verwandter Gestalten Quelle von Komik und Garant für die Unterhaltung des breit gefächerten Publikums. Besonders im Zusammenhang mit der Zähmung des durchaus für seine Grobheiten und derben Späße bekannten Hanswurst, der fortan als „harmloserer“ Kasper auftritt, gewinnt die Sprachkomik zusehends an Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich genau auf diesen letztgenannten Aspekt, die Sprache der komischen Person also, und setzt sich die Analyse der typischsten Realisierungsformen der Sprachkomik des Kasper als gebändigtem Nachfahre des Hanswurst zum Ziel.
Dabei handelt es sich nicht um eine linguistische Untersuchung, es sollen vielmehr anhand zahlreicher Beispiele aus Kasperlestücken verschiedener Autoren typische Muster der Sprachkomik herausgefiltert und ihre komische Wirkung und Funktion beschrieben werden, um so einen Beitrag zum Portrait dieses Typus zu leisten.
Als theoretische Basis der Untersuchung sollen in einem ersten Schritt eine kurze Charaktersierung des „Protagonisten“ der vorliegenden Arbeit vorgenommen und in einem zweiten Schritt ein Überblick über ausgewählte Ansätze zur Erfassung des Komischen gegeben werden. Es handelt sich dabei, wie sich zeigen wird, um einen überaus vielschichtigen Themenkomplex, der im Rahmen der vorliegenden Arbeit und für die Zwecke ihrer Untersuchung vorrangig im Hinblick auf die Sprachkomik ausgeführt werden soll.
Im Anschluss daran soll das Hauptaugenmerk auf ausgewählte Varianten der Sprachkomik des Kasperle gerichtet werden, die anhand aussagekräftiger Beispiele belegt werden sollen. Dabei wird stets auf die Frage nach ihrer Wirkung auf das jeweilige Publikum eingegangen werden, wobei besonders die psychoanalytische Analyse des Witzes von Freud eine Rolle spielen wird. Wieso lachen Erwachsene über die Sprachkomik des Kasperle und wieso tun Kinder dies? Was verrät uns die Sprachkomik über unseren Narren? Steckt hinter manchen Versprechern eventuell mehr als ein Versehen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kasper- Hanswursts gezähmter Nachfahre
- Komik
- Das Komische
- Sprachkomik
- Typische Mittel der Sprachkomik des Kasperle
- Im wahrsten Sinne des Wortes: Das Wörtlich-Nehmen
- Alle Klarheiten beseitigt: Missverständnisse und Wortspiele
- Verhören, Versprechen, Verdrehen – Die sprachliche Narrenfreiheit des Kasperle
- Sprachliche Masken- Parodien und Verballhornungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Sprachkomik des Kasperle, der gezähmten Nachfolgefigur des Hanswurst. Ziel ist die Analyse der typischen Realisierungsformen der Sprachkomik anhand zahlreicher Beispiele aus Kasperlestücken, um so einen Beitrag zum Portrait dieses Typus zu leisten.
- Charakterisierung des Kasperle als Nachfahre des Hanswurst
- Überblick über Ansätze zur Erfassung des Komischen
- Analyse typischer Mittel der Sprachkomik des Kasperle
- Untersuchung der Wirkung der Sprachkomik auf das Publikum
- Analyse der psychoanalytischen Aspekte des Witzes im Kontext der Sprachkomik des Kasperle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Einführung in die Thematik und Vorstellung der Zielsetzung der Arbeit.
- Der Kasper- Hanswursts gezähmter Nachfahre: Herleitung des Kasperle aus der Figur des Hanswurst, die Geschichte und Entwicklung des Typus.
- Komik: Kurzer Überblick über die Problematik der Definition des Komischen, Erläuterung der Subjektivität des komischen Empfindens.
- Typische Mittel der Sprachkomik des Kasperle: Analyse von vier zentralen Bereichen der Sprachkomik des Kasperle anhand konkreter Beispiele.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Sprachkomik des Kasperle und beleuchtet typische Mittel wie Wörtlich-Nehmen, Missverständnisse, Verhören, Versprechen und Verballhornungen. Die Untersuchung analysiert die komische Wirkung dieser Mittel auf das Publikum und untersucht die psychoanalytischen Aspekte des Witzes im Kontext der Sprachkomik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Sprachliche Narrenfreiheit. Typische Mittel der Sprachkomik des Kasperle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229841