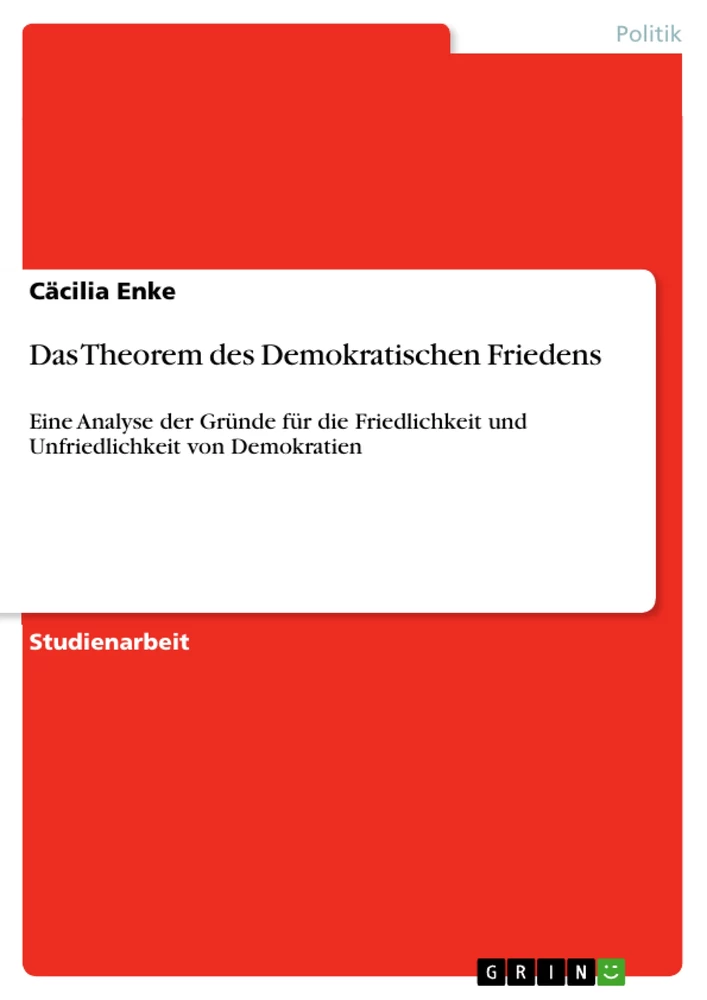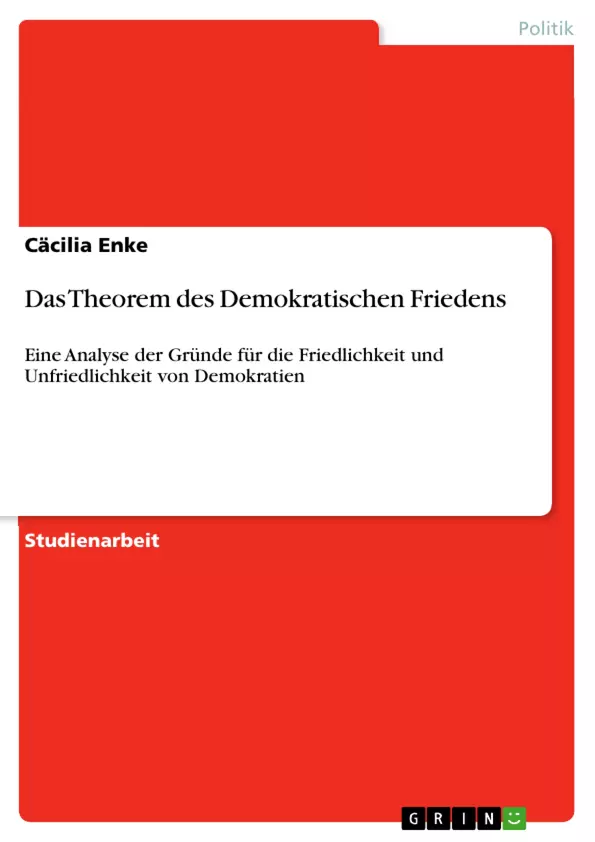Schon Philosophen wie Kant oder Machiavelli beschäftigten sich mit dem Zusammen-hang zwischen Demokratie und Frieden (Czempiel 1986: 117, zitiert nach: Rauch 2005: 19). Kant verfasste daraufhin seine Schrift „Zum ewigen Frieden“, die auch heute noch als Grundlage zur Theorie des demokratischen Friedens Verwendung findet (Rauch 2005: 19-20).
Die aktuelle politische Stabilität der westlichen Demokratien lässt die Annahme zu, dass sich das Theorem der Friedlichkeit, basierend auf Grundlage demokratischer Staatstrukturen, erfüllt hat.
„ […] Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. And there is no doubt that his aggressive regional ambitions will lead him into future confrontations with his neighbors -- confrontations that will involve both the weapons he has today, and the ones he will continue to develop with his oil wealth […]”( Dick Cheney 2002)
Dieses Teilzitat vom damaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney steht stellvertretend für die offizielle Rechtfertigung der USA für den Angriff auf den Irak 2003. Gleichzei-tig verdeutlicht es einen der ältesten Konflikte der zwischenmenschlichen Beziehungen, das Misstrauen. Das Misstrauen zeigt sich auch auf staatlicher Ebene in einem realisti-schen Konstrukt, dem „Sicherheitsdilemma“ (siehe Waltz: 1979). Das Sicherheitsdi-lemma stellt eine Ursache für die Entstehung gewaltsamer Konflikte dar. Schon Kant erkannte dies und sah in dieser Konstellation eine Bedrohung des von ihm konzipierten „ewigen Frieden“ (Czempiel 1996: 85). Es wäre einfach jeden Krieg mit Beteiligung eines demokratischen Staates durch das Sicherheitsdilemma zu erklären. Nach dem ak-tuellen Stand der Forschung und unter Verwendung liberaler Erklärungsansätze und Antinomien, lassen sich weitere Gründe für das unfriedliche Verhalten von Demokra-tien finden. Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über die Gründe für die Friedlich-keit, sowie die Unfriedlichkeit von Demokratien zu finden und zu analysieren
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die theoretischen Grundannahmen des demokratischen Friedens nach Kant
- 3. Der empirische Doppelbefund
- 4. Die klassischen liberalen Erklärungsansätze
- 4.1. Der strukturell-institutionalistische Ansatz
- 4.1.1. Die monadische Analyseebene
- 4.1.2. Die dyadische Analyseebene
- 4.2. Der normativ-kulturelle Ansatz
- 4.2.1. Die monadische Analyseebene
- 4.2.2. Die dyadische Analyseebene
- 4.1. Der strukturell-institutionalistische Ansatz
- 5. Gründe für die Unfriedlichkeit von Demokratien
- 5.1. Institutionelle Gründe
- 5.2. Normative Gründe
- 5.3. Politische Gründe
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gründe für die Friedlichkeit und Unfriedlichkeit von Demokratien. Sie analysiert das Theorem des demokratischen Friedens, indem sie die klassischen liberalen Erklärungsansätze (strukturell-institutionalistisch und normativ-kulturell) auf monadischer und dyadischer Ebene beleuchtet. Ein weiterer Fokus liegt auf der Erforschung der Gründe, die zu gewaltsamen Konflikten unter Demokratien führen.
- Das Theorem des demokratischen Friedens nach Kant
- Der empirische Doppelbefund und das damit verbundene Erklärungsproblem
- Strukturell-institutionalistische und normativ-kulturelle Erklärungsansätze
- Institutionelle, normative und politische Gründe für unfriedliches Verhalten von Demokratien
- Das Sicherheitsdilemma als Konfliktursache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des demokratischen Friedens ein und verweist auf frühe Überlegungen von Philosophen wie Kant und Machiavelli. Sie skizziert die aktuelle politische Situation westlicher Demokratien und stellt die These auf, dass das Theorem des demokratischen Friedens sich darin erfüllt haben könnte. Als zentralen Punkt nennt die Einleitung das Sicherheitsdilemma als Konfliktursache und benennt das Ziel der Arbeit: einen Überblick über die Gründe für die Friedlichkeit und Unfriedlichkeit von Demokratien zu geben und diese zu analysieren. Der Fokus liegt auf der Analyse der liberalen Erklärungsansätze und der Gründe für das unfriedliche Verhalten von Demokratien.
2. Die theoretischen Grundannahmen des demokratischen Friedens nach Kant: Dieses Kapitel untersucht Kants Konzeption von Frieden und Demokratie in seinem Werk „Zum ewigen Frieden“. Es konzentriert sich auf die beiden ersten Definitivartikel, die die Grundlage für Kants Theorie des ewigen Friedens bilden. Der erste Artikel postuliert eine republikanische Staatsform, die durch die Beteiligung der Bürger an wichtigen staatlichen Entscheidungen Kriege unwahrscheinlicher macht. Der zweite Artikel fordert einen Friedensbund freier Staaten, der das Sicherheitsdilemma verhindert. Das Kapitel leitet aus Kants Annahmen zwei Thesen ab: einen Zusammenhang zwischen Partizipation und dem Sinken gewaltsamer Konflikte sowie die geringere Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Konflikte zwischen Staaten in einem organisierten Verbund.
3. Der empirische Doppelbefund: Dieses Kapitel (nur kurz erwähnt in der Einleitung) befasst sich mit dem empirischen Befund, der sowohl die relative Friedlichkeit zwischen Demokratien als auch die Möglichkeit von Konflikten unter ihnen aufzeigt. Es erklärt das daraus resultierende Erklärungsproblem, welches die Arbeit im weiteren Verlauf aufgreift und mit Hilfe liberaler Erklärungsansätze zu lösen versucht. Da der Fokus auf den folgenden Kapiteln liegt, wird der empirische Doppelbefund hier nur kurz angerissen.
4. Die klassischen liberalen Erklärungsansätze: Kapitel 4 stellt die beiden klassischen liberalen Erklärungsansätze vor: den strukturell-institutionalistischen und den normativ-kulturellen Ansatz. Beide Ansätze werden auf monadischer und dyadischer Ebene analysiert. Der strukturell-institutionalistische Ansatz konzentriert sich auf die institutionellen Strukturen von Demokratien, die zu friedlicherem Verhalten führen, während der normativ-kulturelle Ansatz die Rolle von Normen und Werten in der Konfliktlösung betont. Die Kapitel 4.1 und 4.2 liefern detaillierte Beschreibungen und Analysen dieser jeweiligen Ansätze auf den beiden beschriebenen Ebenen.
5. Gründe für die Unfriedlichkeit von Demokratien: Kapitel 5 untersucht die Gründe für das Auftreten von Konflikten zwischen Demokratien. Es analysiert institutionelle, normative und politische Faktoren, die zu kriegerischem Verhalten führen können, trotz demokratischer Strukturen. Es wird dabei auf die bereits in Kapitel 4 vorgestellten liberalen Erklärungsansätze zurückgegriffen und deren Relevanz für das Verständnis von Konflikten unter Demokratien beleuchtet. Dieses Kapitel stellt im Wesentlichen eine Gegenüberstellung zum vorherigen Kapitel dar, indem es die Grenzen des demokratischen Friedenstheorems aufzeigt.
Schlüsselwörter
Demokratischer Frieden, Kant, Sicherheitsdilemma, liberale Erklärungsansätze, strukturell-institutionalistischer Ansatz, normativ-kultureller Ansatz, monadische Analyseebene, dyadische Analyseebene, Friedlichkeit, Unfriedlichkeit, Demokratien, Partizipation, Friedensbund.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Analyse der Friedlichkeit und Unfriedlichkeit von Demokratien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gründe für die Friedlichkeit und Unfriedlichkeit von Demokratien. Sie untersucht das Theorem des demokratischen Friedens und beleuchtet dabei die klassischen liberalen Erklärungsansätze (strukturell-institutionalistisch und normativ-kulturell) auf monadischer und dyadischer Ebene. Ein besonderer Fokus liegt auf der Erforschung der Gründe für gewaltsame Konflikte zwischen Demokratien.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit basiert auf Kants Konzeption des demokratischen Friedens aus seinem Werk „Zum ewigen Frieden“, insbesondere auf den ersten beiden Definitivartikeln. Sie untersucht die Annahme eines Zusammenhangs zwischen Partizipation und dem Sinken gewaltsamer Konflikte sowie die geringere Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Konflikte zwischen Staaten in einem organisierten Verbund.
Welche empirischen Befunde werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht den empirischen Doppelbefund mit ein: die relative Friedlichkeit zwischen Demokratien und die gleichzeitige Möglichkeit von Konflikten unter ihnen. Dieser Befund wird als Erklärungsproblem dargestellt, das mit Hilfe liberaler Erklärungsansätze gelöst werden soll.
Welche Erklärungsansätze werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die klassischen liberalen Erklärungsansätze zum demokratischen Frieden: den strukturell-institutionalistischen und den normativ-kulturellen Ansatz. Beide Ansätze werden auf monadischer (einzelstaatlicher) und dyadischer (zwischenstaatlicher) Ebene untersucht.
Wie werden die strukturell-institutionalistischen und normativ-kulturellen Ansätze differenziert?
Der strukturell-institutionalistische Ansatz konzentriert sich auf die institutionellen Strukturen von Demokratien, die zu friedlicherem Verhalten führen. Der normativ-kulturelle Ansatz betont hingegen die Rolle von Normen und Werten in der Konfliktlösung.
Welche Gründe für Unfriedlichkeit zwischen Demokratien werden untersucht?
Die Arbeit untersucht institutionelle, normative und politische Faktoren, die zu Konflikten zwischen Demokratien führen können, trotz demokratischer Strukturen. Sie beleuchtet die Grenzen des demokratischen Friedenstheorems und setzt diese in Relation zu den in vorherigen Kapiteln vorgestellten liberalen Erklärungsansätzen.
Welche Rolle spielt das Sicherheitsdilemma?
Das Sicherheitsdilemma wird als zentrale Konfliktursache identifiziert und in der Analyse des demokratischen Friedens berücksichtigt. Kants Konzept eines Friedensbundes wird in diesem Zusammenhang diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Demokratischer Frieden, Kant, Sicherheitsdilemma, liberale Erklärungsansätze, strukturell-institutionalistischer Ansatz, normativ-kultureller Ansatz, monadische Analyseebene, dyadische Analyseebene, Friedlichkeit, Unfriedlichkeit, Demokratien, Partizipation, Friedensbund.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Theorie des demokratischen Friedens nach Kant, zum empirischen Doppelbefund, zu den liberalen Erklärungsansätzen, zu den Gründen für Unfriedlichkeit von Demokratien und ein Fazit. Die Kapitel enthalten detaillierte Analysen der jeweiligen Themenbereiche.
- Citation du texte
- Cäcilia Enke (Auteur), 2012, Das Theorem des Demokratischen Friedens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229830