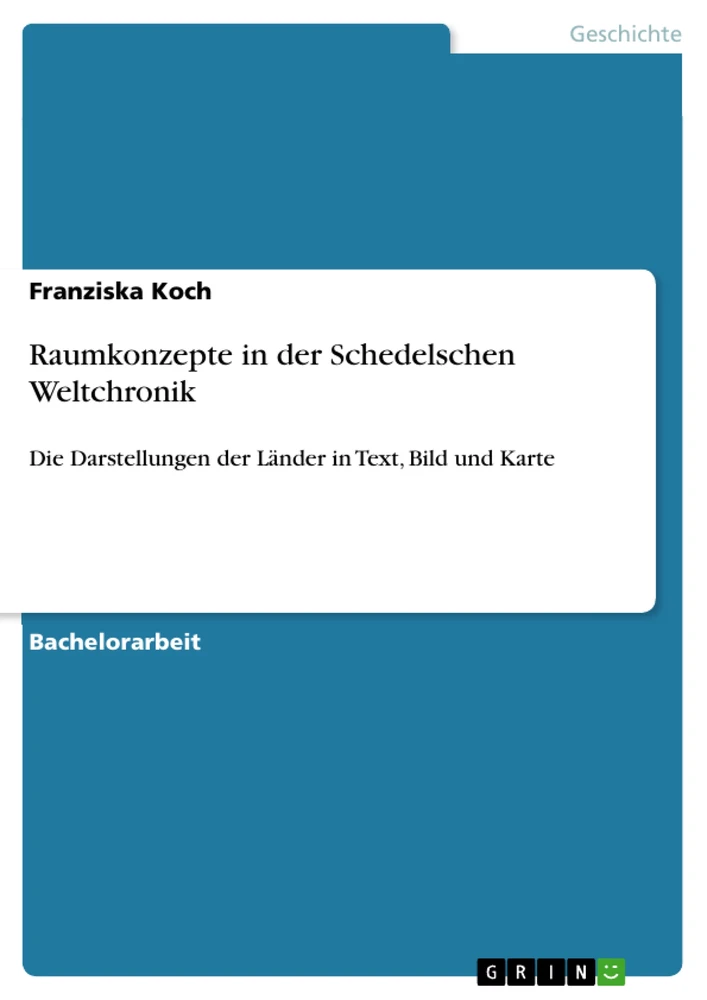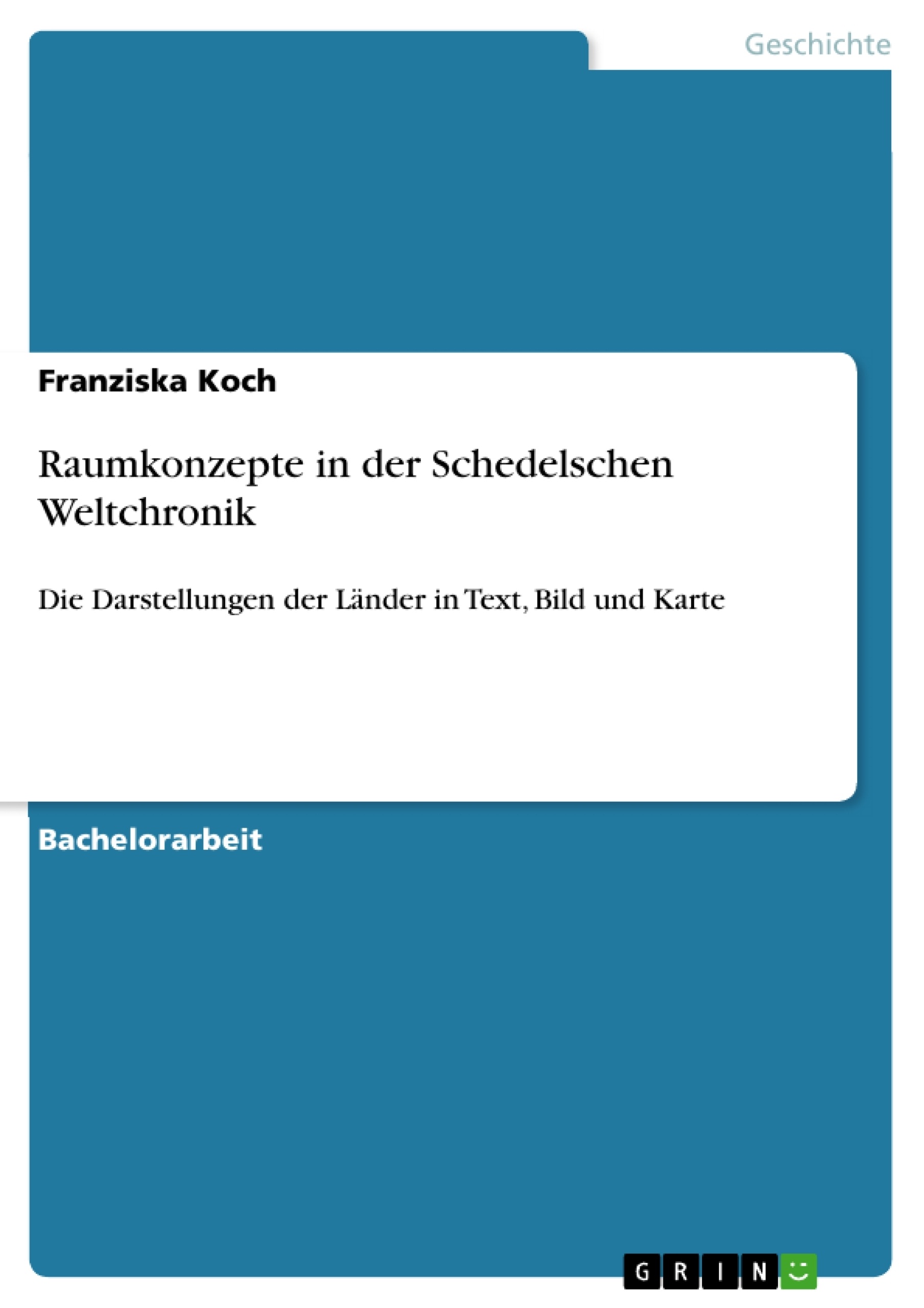1493 wird in Nürnberg ein bilderreiches, großes Buch gedruckt: die Schedelsche Weltchronik. Die Chronik ist eine Manifestation des mittelalterlichen - frühneuzeitlichen Wissens. Eine Kompilation aus biblischen, sagenhaften und zeitgeschichtlichen Ereignissen und geographischen Angaben. Sie birgt umfangreiche Städte- und Länderbeschreibungen und liefert für mehrere mittelalterliche Städte erste, der Realität einigermaßen entsprechende, Abbildungen, an denen unter anderen Albrecht Dürer mitgewirkt hatte.
Das mittelalterliche Verständnis von Geographie ist unserem heutigen weit entfernt. Geographisches Wissen beruhte meist auf Topoi und diente vor allem als Untermalung von Geschichten. Mit den neuen Entdeckungen und der Vergrößerung der bekannten Welt stieg das Interesse und es häufen sich neue erdkundliche Erkenntnisse und Erfindungen. Die Schedelsche Weltchronik steht ganz zu Beginn dieser neuen Entwicklung und zeigt ein großes Interesse an landeskundlichem Wissen. Doch inwieweit ist die Darstellung noch dem Mittelalter verhaftet? Zeigen sich tatsächlich schon Spuren eines neuen geographischen Ansatzes? Diese Arbeit beleuchtet die Raumkonzepte im späten Mittelalter und die Schedelsche Weltchronik wird hinsichtlich ihrer geographischen Ansätze untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Raumkonzepte und geographisches Wissen im späten Mittelalter
- Die Schedelsche Weltchronik – Ein Buchunternehmen am Ende des 15. Jahrhunderts
- Die Länderbeschreibungen
- Die Auswahl der Länder im Allgemeinen
- lant, gegent, volck oder reich – Die Namen der Länder
- Lageangaben und Grenzziehungen
- Landschaftsmerkmale
- Natürliche Ressourcen
- Die Landschaftsbilder
- Aufbau und Verwendung der Bilder innerhalb der Chronik
- Beschreibung der Bilder und ihre topographischen Faktoren
- Die „Deutschlandkarte“
- Karten im späten Mittelalter
- Beschreibung der „Deutschlandkarte“ und ihre topographischen Faktoren
- Die Raumkonzepte im Vergleich von Text, Bild und Karte
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Raumkonzepte in der Schedelschen Weltchronik, einem bilderreichen Buch aus dem Jahr 1493, das eine umfassende Darstellung der Weltgeschichte bietet. Ziel ist es, die Elemente zu identifizieren, die bei der Charakterisierung eines Landes in der Chronik relevant waren, und zu analysieren, ob diese Elemente dem mittelalterlichen oder dem frühneuzeitlichen Denken entspringen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Darstellung von Ländern in Text, Bild und Karte und untersucht, ob alle drei Darstellungsarten auf dem gleichen Denkmuster beruhen.
- Die Darstellung von Länderkonzepten im späten Mittelalter und Frühhumanismus
- Die Bedeutung der Schedelschen Weltchronik als Kompilation mittelalterlichen und frühhumanistischen Wissens
- Die Rolle von Topoi und individuellen Beschreibungen in der Charakterisierung von Ländern
- Die Verwendung von Bildern als Symbole für geographische Begriffe
- Der Vergleich von Text, Bild und Karte als unterschiedliche Raumkonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich der Einleitung, die den Kontext der Schedelschen Weltchronik im Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit beleuchtet. Es wird auf die Bedeutung des Buches als Manifestation mittelalterlichen und frühhumanistischen Wissens hingewiesen und die Frage aufgeworfen, inwieweit die Darstellung von Raum bereits Spuren eines neuen geographischen Ansatzes zeigt.
In Kapitel zwei wird die Forschungsgeschichte des spatial turn und die Rolle der Geographie im Mittelalter behandelt. Es werden die antiken Grundlagen der Geographie und deren Rezeption im Mittelalter sowie die Rolle der Geographie im alltäglichen Leben und in der Religionsgeschichte betrachtet. Die mappae mundi als Ausdruck einer konstruierten räumlichen Ordnung werden ebenso diskutiert.
Kapitel drei stellt die Schedelsche Weltchronik und ihre Erschaffer vor. Es werden die wichtigsten beteiligten Personen, ihre jeweiligen Funktionen und ihre Rolle im Nürnberger Humanismus beleuchtet. Das Buch als Kompilation aus verschiedenen Quellen und als Ausdruck der damaligen Wissenskultur wird analysiert.
Die Länderbeschreibungen der Chronik stehen im Zentrum des Kapitels vier. Die Auswahl der Länder, die Benennungen (z.B. "lant", "gegent", "volck" oder "reich"), die Lageangaben, Grenzziehungen, Landschaftsmerkmale und natürlichen Ressourcen werden im Detail untersucht. Hierbei werden die unterschiedlichen Beschreibungsformen und die Verwendung von Topoi im Vergleich zu individuellen Beschreibungen analysiert.
Kapitel fünf widmet sich den Landschaftsbildern der Chronik. Es werden die Funktion und Verwendung der Bilder als Zeichen für geographische Begriffe sowie die spezifischen Merkmale von vier ausgewählten Landschaftsbildern betrachtet. Die Analyse der Bildelemente soll Aufschluss über die mittelalterliche Vorstellung von Landschaft geben.
Kapitel sechs befasst sich mit der "Deutschlandkarte" der Chronik. Nach einer kurzen Einführung in die Karten im späten Mittelalter werden die Besonderheiten des Cusanus-Typs der Karte und die Darstellung des deutschen Raums in der Schedelschen Weltchronik analysiert. Der Vergleich von Karte und Text hinsichtlich der topographischen Angaben soll die Genauigkeit der Kartographie im späten Mittelalter beleuchten.
In Kapitel sieben werden die Ergebnisse der Einzelbetrachtungen zusammengeführt und die Raumkonzepte der Schedelschen Weltchronik im Vergleich von Text, Bild und Karte analysiert. Es wird untersucht, ob den drei Darstellungsarten das gleiche Denkmuster zu Grunde liegt und welche Unterschiede in der Darstellung von Raumkonzepten im Mittelalter und Frühhumanismus erkennbar sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Raumkonzepte, Geographie, Mittelalter, Frühhumanismus, Schedelsche Weltchronik, Länderbeschreibung, Landschaftsbild, Karte, Topoi, Landeslob, Germania Magna, Cusanus-Typ.
- Arbeit zitieren
- Franziska Koch (Autor:in), 2010, Raumkonzepte in der Schedelschen Weltchronik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229581