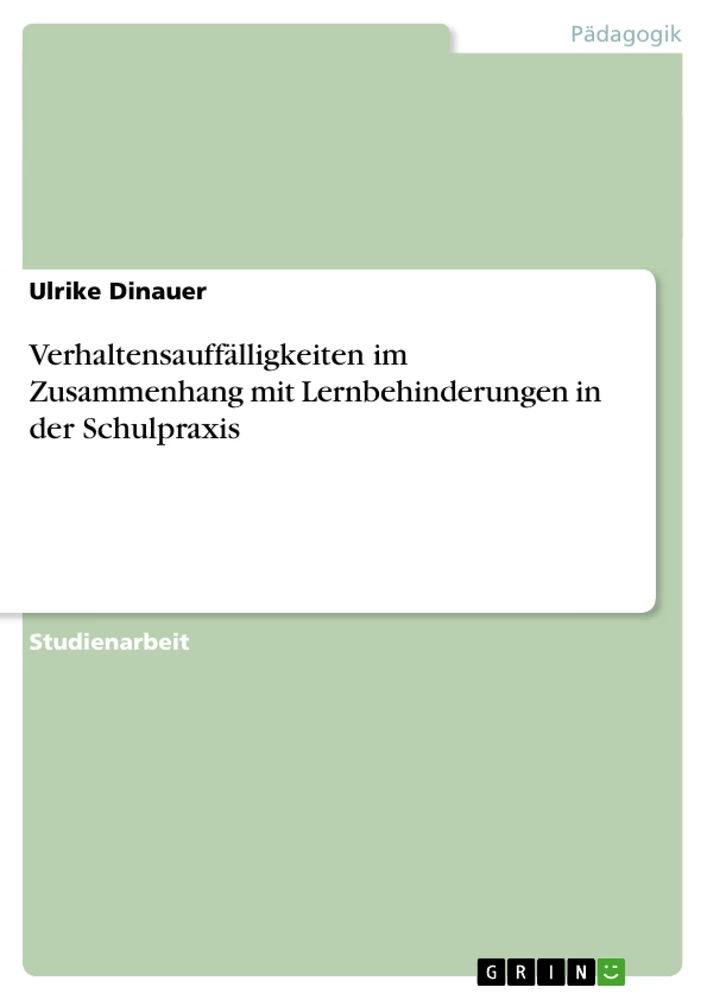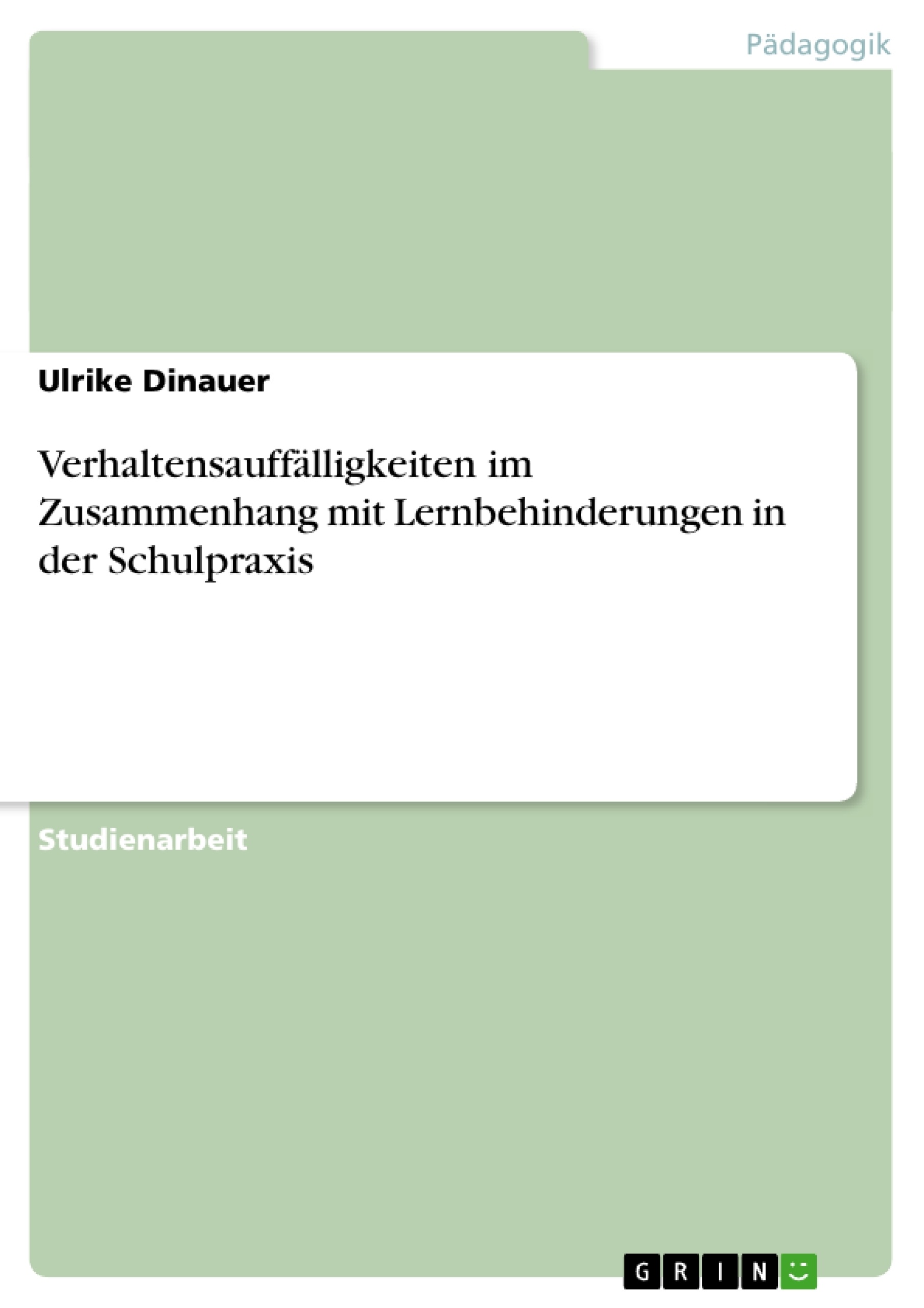Wir alle kennen sie: die unangepassten Störenfriede, die Regeln missachtenden Provozierer, die unruhigen Zappelphilipps und die realitätsfernen Träumerlein – in anderen Worten: verhaltensauffällige Kinder. Seit vielen Jahren bevölkern sie zunehmend unsere Schulklassen. Aus verhaltensauffälligen Kindern werden verhaltensauffällige Jugendliche, aus verhaltensauffälligen Jugendlichen werden Erwachsene mit teils massiven psychosozialen Problemen.
Ein Ende dieses Trends, des rasanten Zunehmens der Zahl junger Menschen, die unter derartigen Problemen leiden, ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: die devianten Verhaltensformen von Schülern sind zunehmend von Gewalt geprägt. Kindergruppen verprügeln einzelne Außenseiter und dokumentieren diese Heldentaten mit ihren Handy-Kameras. Auch jugendliche Amokläufer sind heute keine Ausnahme mehr.
Gewisse Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen sind offensichtlich. Sie bedingen einander, schaukeln einander hoch und machen es dem jungen Menschen zunehmend schwer bis unmöglich, sich ohne Hilfe aus diesem Netz je wieder zu befreien. Orientierungslosigkeit, Chancenlosigkeit, Zukunftsängste… es gibt viele Zutaten, die aus dieser Suppe früher oder später Flüssigsprengstoff machen.
Die Entstehungsfaktoren für eine derartige Entwicklung sind vielfältiger Natur. Nur wenn wir das gesamte Netzwerk möglicher Faktoren in seiner Komplexität betrachten, können wir einigermaßen adäquat darauf reagieren, Gefahrenmomente entschärfen und unser Bestes dazu tun, um jenen Kindern und Jugendlichen zu helfen und besonders drastischen Entartungen schon im Vorfeld vorzubeugen bzw. entgegenzusteuern.
Das Modell der Transaktionsanalyse mitsamt seinen zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten bietet hervorragende Techniken an, um individuellen Ursachen für einzelne problematische Verhaltenweisen sowohl behutsam auf den Grund zu gehen als auch – in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen – konstruktive Kommunikations- und Handlungsalternativen zu suchen, zu erforschen und zu erproben. Als kreative Ergänzung allgemeiner pädagogischer Maßnahmen ist die Transaktionsanalyse ein viel versprechender Lösungsansatz, der den oft sehr belastenden und entmutigenden Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zu einer neuen pädagogischen Herausforderung machen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Zum Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“
- 1.1 Begriffe und Definitionen
- 1.1.1 Verhalten und Verhaltensauffälligkeit
- 1.1.2 Verwandte Begriffe
- 1.2 Beispiele und Kategorien
- 1.3 Häufigkeiten
- 1.4 Kritiken am Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“, an Schule und Gesellschaft
- 1.4.1 Kritiken verschiedener Autoren
- 1.4.2 Eigene Stellungnahme
- 1.5 Verhaltensauffällige im Erwachsenenalter
- 2. Zum Begriff der „Lernbehinderung“
- 2.1 Begriffe und Definitionen
- 2.1.1 Behinderung, Lernen, Lernbehinderung
- 2.1.2 Verwandte Begriffe
- 2.2 Kriterien, Abgrenzungen
- 2.2.1 „Geistig behinderte“ bzw. „normale“ Kinder
- 2.2.2 Mehrfachbehinderungen
- 2.2.3 Teilleistungsschwächen
- 2.3 Diagnose
- 2.3.1 Diagnose von Teilleistungsschwächen
- 2.4 Lernbehinderte im Erwachsenenalter
- 3. Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen
- 3.1 „Verhaltensgestörte“ als Untergruppe der „Lernbehinderten“
- 3.2 Der Begriff der „Schulschwäche“
- 3.3 Zahlenmäßige Vergleiche
- 4. Ursachen für Verhaltens- und Lernprobleme
- 4.1 Wie entsteht Behinderung? - vier Paradigmata
- 4.1.1 Individualtheoretisches Paradigma
- 4.1.2 Interaktionstheoretisches Paradigma
- 4.1.3 Systemtheoretisches Paradigma
- 4.1.4 Gesellschaftstheoretisches Paradigma
- 4.1.5 Die „richtige“ Betrachtungsweise?
- 4.2 Ursachen im Kind selbst
- 4.2.1 Organische Ursachen
- 4.2.2 Psychische Konstitution
- 4.3 Umweltbedingte Ursachen
- 4.3.1 Nervöse Belastung
- 4.3.1.1 Das „nervöse“ Kind
- 4.3.1.2 Belastende Lernbedingungen
- 4.3.1.3 Außerschulische Stressoren
- 4.3.2 Ursachen im sozialen Gefüge
- 4.3.2.1 Der familiäre Hintergrund
- 4.3.2.2 Die Schule
- 4.3.2.3 Spiele
- 4.3.2.4 Sich selbst erfüllende Prophezeiungen
- 4.3.2.4.1 Konzepte, die sich durch den Selbsterfüllungsansatz erklären lassen
- 4.3.2.4.2 SFPs im Bereich des Lernens und der Erziehung
- 4.4 Untersuchung und Ursachenergründung
- 5. Pädagogische und therapeutische Konsequenzen
- 5.1 Allgemeine pädagogische Konsequenzen
- 5.1.1 Präventive Maßnahmen
- 5.1.2 Unmittelbare Maßnahmen
- 5.1.3 Längerfristige systematische Maßnahmen
- 5.1.4 Schulorganisatorische Maßnahmen
- 5.1.5 Längerfristige Maßnahmen unter Einbeziehung von schulexternen Personen
- 5.2 Nervöse, motorische und unterrichtlich-kognitive Anregung
- 5.2.1 Theoretische Basis
- 5.2.2 Nervöse Anregung
- 5.2.3 Motorische Anregung
- 5.2.4 Unterrichtlich-kognitive Anregung
- 5.2.4.1 Das subjektive Erleben von Aufgabenschwierigkeiten
- 5.3 Offenes Lernen mit verhaltensauffälligen Schülern
- 5.3.1 Was ist „Offenes Lernen“?
- 5.3.2 Offenes Lernen und einzelne Verhaltensauffälligkeiten
- 5.3.2.1 Aggressivität
- 5.3.2.2 Hyperaktive
- 5.3.2.3 Kontaktstörungen
- 5.3.2.4 Lernunlust
- 5.4 Verhaltenstherapie und Verhaltensmodifikation
- 5.4.1 Die Technik
- 5.4.2 Kritiken
- 5.4.2.1 Kritiken verschiedener Autoren
- 5.4.2.2 Eigene Stellungnahme
- 5.5 Die Transaktionsanalyse
- 5.5.1 Grundlagen und Begriffe
- 5.5.1.1 Die drei Ich-Zustände
- 5.5.1.1.1 Das Eltern-Ich
- 5.5.1.1.2 Das Kindheits-Ich
- 5.5.1.1.3 Das Erwachsenen-Ich
- 5.5.1.2 Arten von Transaktionen
- 5.5.1.2.1 Die Komplementär-Transaktion
- 5.5.1.2.2 Die Überkreuz-Transaktion
- 5.5.1.2.3 Verdeckte Transaktionen
- 5.5.2 TA und Schulprobleme
- 6. Fazit
- Anstelle eines Nachwortes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Lernbehinderungen bei Kindern im schulischen Kontext. Ziel ist es, die relevanten Begriffe zu definieren, Zusammenhänge aufzuzeigen und verschiedene Ursachen zu beleuchten. Schließlich werden pädagogische und therapeutische Konsequenzen diskutiert.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Lernbehinderung“
- Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen
- Ursachenforschung: Individuelle, interaktive, systemische und gesellschaftliche Faktoren
- Pädagogische und therapeutische Interventionen
- Bewertung verschiedener pädagogischer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Begriff der „Verhaltensauffälligkeit“: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Verhaltensauffälligkeit“, unterscheidet ihn von verwandten Begriffen und beleuchtet verschiedene Kritikpunkte an seiner Verwendung in Schule und Gesellschaft. Es werden Kategorien und Häufigkeiten von Verhaltensauffälligkeiten dargestellt, und es wird ein Blick auf das Leben verhaltensauffälliger Menschen im Erwachsenenalter geworfen. Die Diskussion der Kritikpunkte an dem Begriff unterstreicht die Komplexität und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
2. Zum Begriff der „Lernbehinderung“: Ähnlich wie im ersten Kapitel wird hier der Begriff „Lernbehinderung“ genau definiert und von verwandten Konzepten abgegrenzt. Es werden Kriterien und diagnostische Verfahren erläutert, inklusive der Diagnose von Teilleistungsschwächen. Das Kapitel betont die Wichtigkeit einer differenzierten Diagnostik und beleuchtet die Situation von lernbehinderten Erwachsenen. Die Ausführungen zu den Kriterien und Abgrenzungen betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung des individuellen Lernprozesses.
3. Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen: Dieses Kapitel analysiert die oft komplexen Beziehungen zwischen Lern- und Verhaltensproblemen. Es diskutiert die Möglichkeit, „Verhaltensgestörte“ als Untergruppe der „Lernbehinderten“ zu betrachten und beleuchtet den Begriff der „Schulschwäche“. Zahlenmäßige Vergleiche verdeutlichen die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und unterstreichen den Bedarf an ganzheitlichen pädagogischen Ansätzen. Die Analyse der verschiedenen Begrifflichkeiten und die quantitativen Vergleiche schaffen eine wichtige Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit Ursachen und Interventionen.
4. Ursachen für Verhaltens- und Lernprobleme: Hier werden verschiedene Ursachen für Verhaltens- und Lernprobleme aus vier Paradigmen beleuchtet: individualtheoretisch, interaktionstheoretisch, systemtheoretisch und gesellschaftstheoretisch. Der Abschnitt differenziert zwischen Ursachen beim Kind selbst (organisch und psychisch) und umweltbedingten Ursachen, wie nervöse Belastungen, belastende Lernbedingungen, außerschulische Stressoren und Faktoren im sozialen Gefüge (Familie, Schule, Peergroup). Die Darstellung der verschiedenen Paradigmen und Ursachen zeigt die Komplexität der Problematik und den Bedarf an multiperspektivischen Lösungsansätzen. Der Fokus auf „sich selbst erfüllende Prophezeiungen“ verdeutlicht die Dynamik zwischen Erwartungshaltung und Realität.
5. Pädagogische und therapeutische Konsequenzen: Dieses Kapitel beschreibt präventive, unmittelbare und längerfristige Maßnahmen im Umgang mit Verhaltens- und Lernproblemen. Es werden verschiedene pädagogische Ansätze wie offenes Lernen und spezifische Interventionen (Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse) detailliert erläutert und kritisch bewertet. Die Darstellung der verschiedenen Interventionen verdeutlicht den Bedarf an individualisierten Ansätzen und einem multiprofessionellen Vorgehen. Die kritische Auseinandersetzung mit den einzelnen Methoden fördert ein differenziertes Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen.
Schlüsselwörter
Verhaltensauffälligkeit, Lernbehinderung, Teilleistungsschwäche, Schulschwäche, Ursachenforschung, pädagogische Intervention, Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse, individuelle Förderung, systemischer Ansatz, Prävention, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text untersucht umfassend den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Lernbehinderungen bei Kindern im schulischen Kontext. Er definiert die relevanten Begriffe, zeigt Zusammenhänge auf, beleuchtet verschiedene Ursachen und diskutiert schließlich pädagogische und therapeutische Konsequenzen. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Wie werden die Begriffe „Verhaltensauffälligkeit“ und „Lernbehinderung“ definiert?
Der Text liefert detaillierte Definitionen beider Begriffe, grenzt sie von verwandten Konzepten ab und diskutiert kritische Punkte ihrer Verwendung in Schule und Gesellschaft. Es werden verschiedene Kategorien und Häufigkeiten von Verhaltensauffälligkeiten dargestellt, und die Kapitel beleuchten auch die Situation betroffener Personen im Erwachsenenalter. Die Definitionen betonen die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
Welche Zusammenhänge zwischen Lern- und Verhaltensproblemen werden beschrieben?
Der Text analysiert die komplexen Beziehungen zwischen Lern- und Verhaltensproblemen. Es wird die Möglichkeit diskutiert, „Verhaltensgestörte“ als Untergruppe der „Lernbehinderten“ zu betrachten, und der Begriff „Schulschwäche“ wird beleuchtet. Zahlenmäßige Vergleiche verdeutlichen die häufige Koinzidenz von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und unterstreichen den Bedarf an ganzheitlichen pädagogischen Ansätzen.
Welche Ursachen für Verhaltens- und Lernprobleme werden untersucht?
Der Text betrachtet Ursachen aus vier Paradigmen: individualtheoretisch, interaktionstheoretisch, systemtheoretisch und gesellschaftstheoretisch. Er differenziert zwischen Ursachen beim Kind selbst (organisch und psychisch) und umweltbedingten Faktoren wie nervöse Belastungen, belastende Lernbedingungen, außerschulische Stressoren und Faktoren im sozialen Umfeld (Familie, Schule, Peergroup). Der Einfluss von „sich selbst erfüllenden Prophezeiungen“ wird besonders hervorgehoben.
Welche pädagogischen und therapeutischen Konsequenzen werden vorgeschlagen?
Der Text beschreibt präventive, unmittelbare und längerfristige Maßnahmen im Umgang mit Verhaltens- und Lernproblemen. Verschiedene pädagogische Ansätze wie offenes Lernen und Interventionen (Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse) werden detailliert erläutert und kritisch bewertet. Der Text betont die Notwendigkeit individualisierter Ansätze und eines multiprofessionellen Vorgehens.
Welche pädagogischen Ansätze werden im Detail beschrieben?
Der Text beschreibt detailliert „Offenes Lernen“ und seine Anwendung bei verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität, Hyperaktivität, Kontaktstörungen, Lernunlust). Weiterhin werden die Verhaltenstherapie, inklusive Kritikpunkten, und die Transaktionsanalyse (TA) mit ihren Grundlagen (Ich-Zustände, Transaktionstypen) im Kontext von Schulproblemen erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Text relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Verhaltensauffälligkeit, Lernbehinderung, Teilleistungsschwäche, Schulschwäche, Ursachenforschung, pädagogische Intervention, Verhaltenstherapie, Transaktionsanalyse, individuelle Förderung, systemischer Ansatz, Prävention und Integration.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an ein akademisches Publikum, welches sich mit den Zusammenhängen zwischen Lern- und Verhaltensproblemen bei Kindern auseinandersetzt. Er ist relevant für Pädagogen, Therapeuten, Psychologen und Studenten der entsprechenden Fachrichtungen.
- Citar trabajo
- Ulrike Dinauer (Autor), 1995, Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit Lernbehinderungen in der Schulpraxis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22712