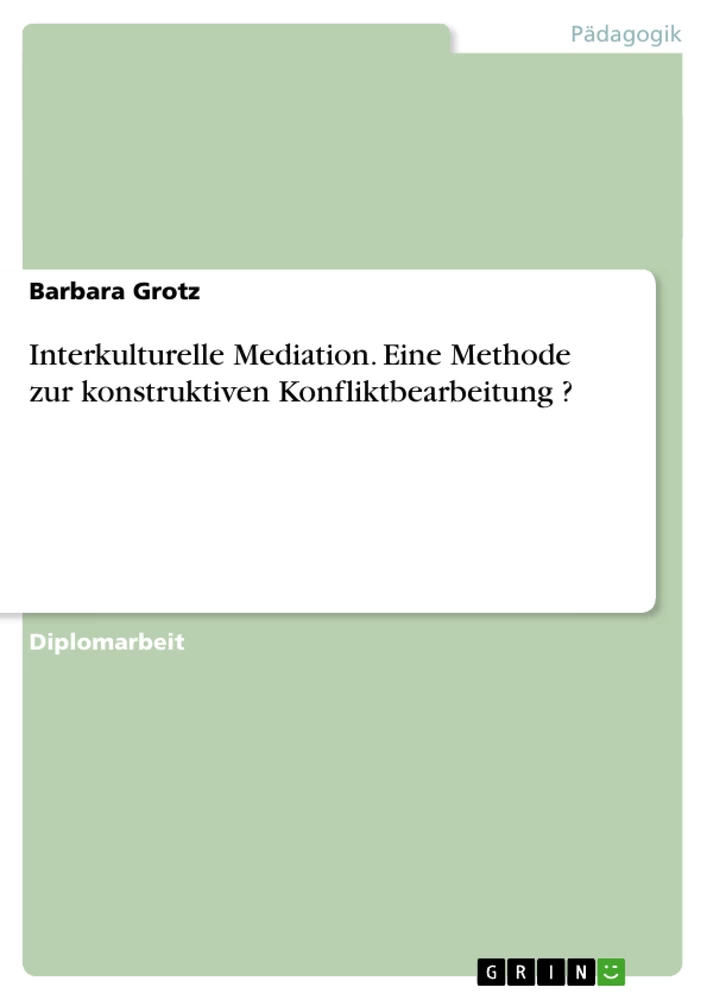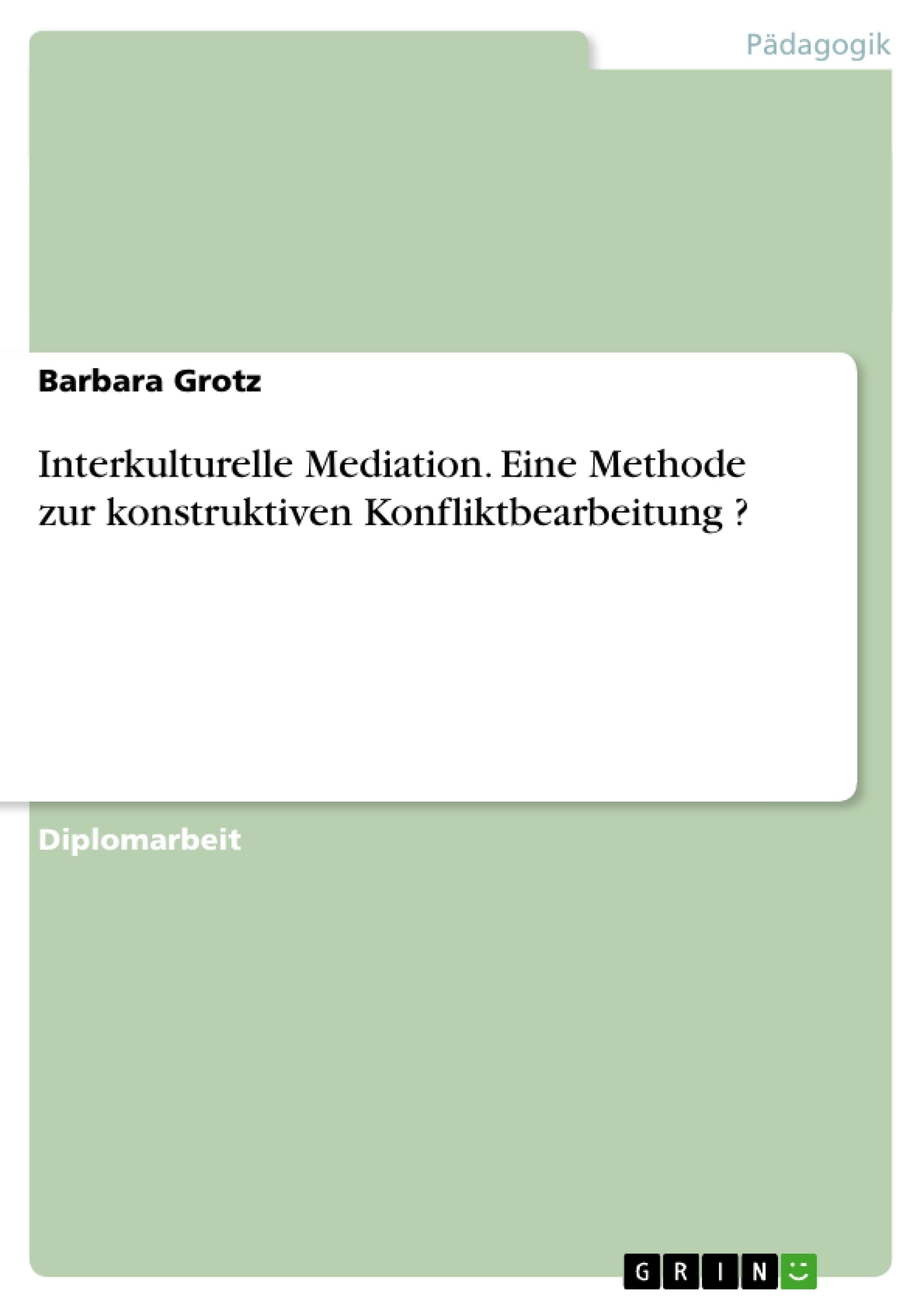In dieser Arbeit soll also untersucht werden, ob Mediation eine geeignete Methode zur Bearbeitung interkultureller Konflikte in Deutschland ist. Das persönliche Interesse der Autorin an dieser Frage entstand während mehrer Aufenthalte in Bosnien und Kroatien sowie während eines halbjährigen Praktikums bei einer Mediationsstelle in Oldenburg.
In Kapitel eins sollen soziale Konflikte erklärt und definiert werden (1.1). Es soll zudem dargestellt werden, wie diese Konflikte entstehen (1.2) und eskalieren können (1.3). Daran schließt sich eine Darstellung der Tragweite (1.4.1), der Reichweite (1.4.2) und der Austragungsformen eines sozialen Konfliktes (1.4.3) an, dabei beziehen sich diese Ausführungen auf die Hinleitung zum Mediationskonzept und stellen daher die in der Literatur zum Thema Mediation am häufigsten genannten Ursachenerklärungen und Klassifikationsmodelle sozialer Konflikte dar. Um die Entstehung und Grundlagen des Mediationskonzeptes in Kapitel 2 darzustellen, folgt dann eine Übersicht über die kommunikationstheoretischen Erklärungsmodelle zur Entstehung sozialer Konflikte von Watzlawick und Schulz von Thun in Kapitel 2.1 und die daraus resultierenden Folgerungen für das Konzept der Mediation. Dann folgt ein kurzer Überblick über die Entwicklung des Mediationskonzeptes in Kapitel 2.2, ehe die sich daraus ergebenden theoretischen Grundlagen der Methode und die Aufgaben des Mediators während der Mediation in Kapitel 2.3 und 2.4 dargestellt werden. Daran schließt sich die Darstellung der Mediationsphasen in Kapitel 3 an, unter besonderer Berücksichtigung der Funktion des Mediators an, da dieser für das Gelingen einer konstruktiven Mediation von großer Bedeutung ist. Abschließend sollen die methodischen Schwächen dieser Methode dargestellt werden (3.5), um einen ersten kritischen Überblick über Merkmale und Inhalte des Mediationskonzeptes zu ermöglichen.
Um den Einfluss kultureller Differenzen zwischen den Konfliktparteien darzustellen, folgt dann eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff (4.1) und den in der Mediationsliteratur am häufigsten genannten Konzepten zur Bedeutung kultureller Unterschiede (4.2 bis 4.4.3). In diesem Zusammenhang wird auch kurz auf die Bedeutung unterschiedlicher Sprachen im Mediationsprozess eingegangen, da Kommunikation in der Mediation von großer Bedeutung ist und sich kulturelle Unterschiede auch in der Sprache manifestieren können (4.6). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Klassifikation sozialer Konflikte
- Definition eines sozialen Konfliktes
- Entstehungsbereiche sozialer Konflikte
- Das Konflikteskalationsmodell von F. Glasl
- Analysedimensionen eines sozialen Konfliktes
- Die drei Dimensionen eines sozialen Konfliktes
- Die Tragweite des Konfliktes
- Austragungsformen eines sozialen Konfliktes
- Entwicklung und Grundlagen des Mediationskonzeptes
- Kommunikationstheoretische Konzepte zur Entstehung von Konflikten als Grundlage für die Entwicklung des Mediationskonzeptes
- Zur Genese des Mediationskonzeptes
- Theoretische Ausgangsüberlegungen des Mediationskonzeptes
- Die Aufgaben des Mediators während der Mediation
- Ablaufphasen der Mediation
- Vorbereitungsphase
- Der Verhandlungsort und die Sitzordnung
- Die Aufgaben des Mediators in der Vorphase
- Einleitungsphase in die Mediation
- Die Regeln der Mediation und ihr Anwendungsrahmen
- Die Vorstellung der Mediationsregeln durch den Mediator
- Hauptphase der Mediation
- Schilderung der individuellen Konfliktwahrnehmung durch die Konfliktparteien
- Darstellung der gemeinsamen und widersprüchlichen Interessen
- Lösungssuche und Abschluss der Mediation
- Sammlung von Lösungsideen
- Überprüfung der Lösungsvorschläge
- Annahme der schriftlichen Vereinbarung durch die Konfliktparteien und formeller Ausklang
- Methodische Schwachstellen, die während der Mediation relevant werden können
- Die Bedeutung des kulturellen Hintergrunds in der Mediation
- Definition des Kulturbegriffes
- Universalistische oder kulturrelativistische Bewertung interkultureller Konflikte
- Gesellschaftliche Gemeinschaftsorientierung oder individualistische Orientierung als Einflussfaktoren auf Konfliktwahrnehmung und Bearbeitung
- Hofstedes Modell der vier Dimensionen von Gesellschaft und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche und persönliche Konfliktkultur
- Machtverteilung
- Ambiguitätstoleranz
- Maskulines Verhalten als erwünschtes Verhalten
- Manifestationen der individuellen Konfliktkultur am Beispiel des Begriffs ,,idiocosm"
- Kommunikation
- Taktischer Einsatz von Kultur
- Kulturelle Unterschiede als Konfliktpotential
- Fazit: Die Bedeutung der kulturellen Identität für die Handlungs- und Interaktionsmuster der Gesellschaftsmitglieder
- Ein handlungsorientierter Ansatz zur Wahrnehmung kultureller Unterschiede
- Die gesellschaftliche Relevanz interkultureller Konflikte
- Darstellung des erhöhten gesellschaftlichen Spaltungspotentials interkultureller Konflikte
- Strukturelle Diskriminierung von Arbeitsmigranten, Fluchtmigranten und Spätaussiedlern als Konfliktpotential
- Rechtliche Lage der Arbeitsmigranten
- Rechtliche Lage der Fluchtmigranten
- Rechtliche Lage der Aussiedler und Spätaussiedler
- Arbeitsmarktlage der Arbeitsmigranten
- Die Arbeitsmarktsituation der Fluchtmigranten
- Die berufliche Lage der Aussiedler und Spätaussiedler
- Wohnsituation der Arbeitsmigranten
- Wohnsituation der Fluchtmigranten
- Wohnsituation der Aussiedler und Spätaussiedler
- Bildungs- und Ausbildungssituation der Arbeitsmigranten
- Die Schul- und Ausbildungssituation der Fluchtmigranten
- Schul- und Ausbildungssituation der Aussiedler und Spätaussiedler
- Fazit: Konfliktpotential der strukturellen Diskriminierung
- Ethnisierung als Verbindung kultureller und struktureller Merkmale und ihre Funktion für die gesellschaftliche Ordnung
- Die Auswirkungen der gesellschaftlichen Ungleichheit auf das Verhalten der Konfliktparteien vor und während dem Konflikt am Beispiel der Habitus- Theorie Bourdieus
- Einschränkende Merkmale des Mediationsverfahrens
- Schwachstellen des Verfahrens im Bezug auf seine implizierten kulturellen Vorannahmen
- Einschränkungen aufgrund der unterschiedlichen gesellschaftlichen Position der Konfliktparteien
- Die Unterstützung der strukturell schwächeren Teilenehmerseite während der Mediation
- Empirisches Vorgehen: Das problemzentrierte Interview
- Die Analysemethode
- Projektdarstellung
- Auswertung des Interviews
- Motivation für die Entwicklung des Projekts und Einbeziehung der Mediations- Methode sowie zur Teilnahme am Projekt
- Lerninhalte und Durchführungsweise
- Anwendungsgebiete und Modifikation von Mediation im Projekt
- Lernprozesse der Befragten während der Projektteilnahme
- Probleme beim Einsatz der Mediatoren und Ansätze für ein Folgeprojekt
- Fazit: Der innovative Ansatz des Qantara- Projektes
- Zusammenfassung: Vorrausetzungen für den produktiven Verlauf interkultureller Mediation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Mediation eine geeignete Methode zur Bearbeitung interkultureller Konflikte in Deutschland ist. Sie untersucht die Relevanz kultureller Unterschiede im Kontext der Mediation und analysiert die Auswirkungen struktureller Diskriminierung auf Konfliktverhalten und die Anwendung von Mediation in interkulturellen Kontexten.
- Kulturelle Unterschiede und ihre Bedeutung in der Mediation
- Die Auswirkungen von Macht- und Statusungleichheit auf interkulturelle Konflikte
- Strukturelle Diskriminierung als Konfliktfaktor
- Die Möglichkeiten und Grenzen des Mediationsverfahrens in interkulturellen Kontexten
- Der Einsatz von Mediation in einem konkreten Projekt zur Förderung interkultureller Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in das Thema soziale Konflikte. Es werden verschiedene Definitionen und Klassifikationen von Konflikten vorgestellt, sowie die Entstehungsbereiche und das Eskalationsmodell von Glasl erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung und die theoretischen Grundlagen des Mediationskonzeptes, inklusive der Aufgaben des Mediators. Kapitel 3 beschreibt die verschiedenen Phasen der Mediation, von der Vorbereitung bis zur Lösungssuche und dem Abschluss. Kapitel 4 diskutiert die Bedeutung des kulturellen Hintergrunds in der Mediation. Es beleuchtet die Rolle von Kultur in Konfliktwahrnehmung und -bearbeitung und analysiert verschiedene Modelle, die den Einfluss von Kultur auf Konfliktdynamiken aufzeigen. Kapitel 5 präsentiert einen handlungsorientierten Ansatz zur Wahrnehmung kultureller Unterschiede. Kapitel 6 beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Relevanz interkultureller Konflikte und untersucht strukturelle Diskriminierung von Migranten als Konfliktpotential. Kapitel 7 beleuchtet das Phänomen der Ethnisierung. Kapitel 8 analysiert die Auswirkungen gesellschaftlicher Ungleichheit auf das Verhalten der Konfliktparteien im Kontext der Habitus-Theorie Bourdieus. Kapitel 9 untersucht die Einschränkungen des Mediationsverfahrens in Bezug auf kulturelle Vorannahmen und unterschiedliche gesellschaftliche Positionen der Konfliktparteien. Kapitel 10 befasst sich mit dem empirischen Vorgehen des problemzentrierten Interviews und analysiert ein konkretes Projekt zur interkulturellen Mediation.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Mediation, Konfliktbearbeitung, Konfliktkultur, kulturelle Unterschiede, strukturelle Diskriminierung, Migranten, Ethnisierung, Habitus, gesellschaftliche Ungleichheit, problemzentriertes Interview, Qantara-Projekt.
- Quote paper
- Barbara Grotz (Author), 2002, Interkulturelle Mediation. Eine Methode zur konstruktiven Konfliktbearbeitung ?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22686