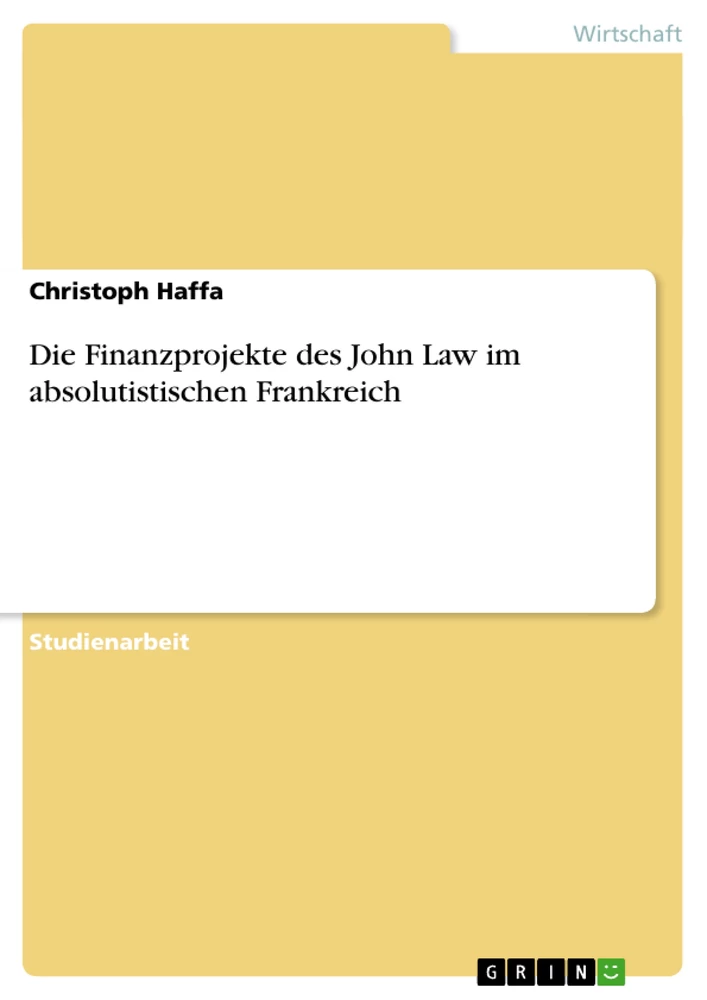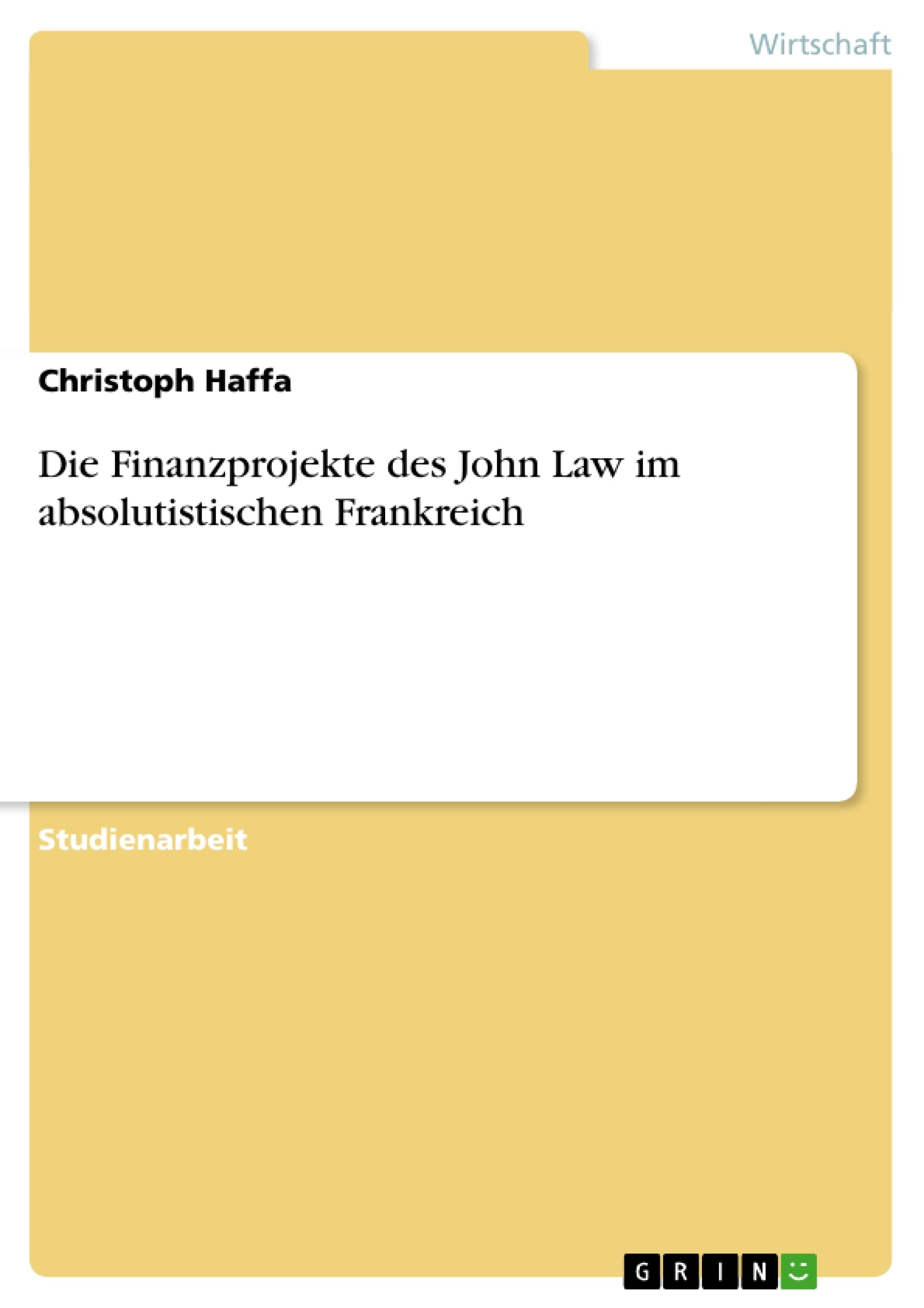[...] Die Regentschaft übernahm sein Neffe
Philipp von Orleans. Er sah sich mit einer Schuldenlast von mehr als 2 Milliarden
Livre konfrontiert sowie einer jährlichen Zinsbelastung von 90 Millionen Livre. Die
Nettosteuereinnahmen betrugen 69 Millionen Livre, denen Ausgaben von 146 Mio.
Livre gegenüberstanden1. Frankreich war chronisch pleite. Der Fiskus konnte seine
Schulden nicht mehr bezahlen und dessen Gläubiger hatten kein Geld, um ihre
Lieferanten zu befriedigen.
In dieser Situation fand John Law mit seinen Ideen Gehör beim Regenten und durfte
die erste Bank in Frankreich gründen. John Law kam 1671 in Schottland zur Welt. Seine brillanten mathematischen
Fähigkeiten nutzte er in seiner Jugend in Spielsalons aus und kam so zu Reichtum.
1694 entkam er durch eine Flucht aus dem Gefängnis nur knapp dem Tod, zu
welchem er nach einem Duell verurteilt wurde. Sein finanzwirtschaftliches Geschick
hatte er sich bei seinen Aufenthalten in den europäischen Finanzmetropolen
angeeignet. Von 1716 – 1720 prägte er massiv das französische Finanzwesen. Er
war kurzfristig der reichste Mann der Welt. Er löste den ersten Aktienboom aber auch
den ersten Börsencrash der Geschichte aus.
John Law war fasziniert von der Idee einer Bodenkreditbank, die Grundbesitz
erwerben und Papiergeld als Kredit ausgeben sollte. Die Sicherung des Kredites
sollte durch Grund und Boden erfolgen, da Land einen weniger unsicheren
Vermögenswert darstellt als Münzgeld2. Er plante die Noten jedem Grundeigentümer
auszuhändigen, der dafür eine Hypothek auf seinen Grundbesitz errichten ließ oder
der bereit war, diesen Grundbesitz an eine zu diesem Zweck geschaffene öffentliche
Anstalt abzutreten. Zunächst werde ich auf die theoretischen Grundlagen des Papiergeldes näher
eingehen und seine Vorzüge gegenüber dem Münzgeld darstellen sowie die
Situation in Frankreich beleuchten, bevor John Law in die französischen
Finanzmärkte eintritt. Im nächsten Kapitel zeige ich die Entwicklung des
Papiergeldes in Frankreich auf und wie John Law seinen auf Boden gestützten
Papiergeldplan immer mehr aus den Augen verliert was schließlich zum Platzen der
Aktienblase führt. Darüber hinaus möchte ich die Konsequenzen seiner Finanzpolitik
für die französische Wirtschaft darstellen. Es stellt sich die Frage, wie John Law es
geschafft hat, Vertrauen für eine neue Währung zu gewinnen und warum sein
Finanzprojekt letztendlich gescheitert ist.
1 Vgl. Murphy, S.169.
2 Vgl. Galbraith, S.27.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Papiergeldsystem im 18. Jahrhundert
- Aufbau eines Bankwesens
- Gründe für Papiergeld
- Situation in Frankreich
- Papiergeld in Frankreich
- Verknüpfung Papiergeld mit Aktien
- Verknüpfung Papiergeld mit Handelsgesellschaft
- Entwicklung der Aktienblase
- Auswirkungen der Wirtschaftspolitik
- Gründe des Scheiterns
- Ökonomische Gründe
- Sonstige Gründe
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Finanzprojekte von John Law im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Sie beleuchtet Laws Einführung eines Papiergeldsystems, die damit verbundene Aktienblase und den letztendlich erfolgten Zusammenbruch. Die Arbeit analysiert die ökonomischen und politischen Faktoren, die zu diesem Erfolg und Scheitern beigetragen haben.
- Einführung und Funktionsweise des Papiergeldsystems im 18. Jahrhundert
- Die Rolle von John Law in der französischen Finanzpolitik
- Die Entstehung und der Zusammenbruch der Aktienblase
- Ökonomische Ursachen des Scheiterns von Laws Finanzprojekten
- Politische und gesellschaftliche Folgen des Finanzcrashs
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die desolate Finanzlage Frankreichs nach dem Tod Ludwigs XIV. und die daraus resultierende Notwendigkeit von Finanzreformen. Sie stellt John Law und seine Ideen vor und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit, die sich mit den theoretischen Grundlagen des Papiergelds, dessen Entwicklung in Frankreich unter Law, den Ursachen des Scheiterns und den daraus resultierenden Konsequenzen befasst.
Papiergeldsystem im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktionsweise von Münz- und Papiergeldsystemen, insbesondere den Unterschied zwischen edelmetallgestützten und kreditgestützten Papiergeldsystemen. Es werden die Vorteile von Papiergeld gegenüber Münzgeld herausgestellt, wie z.B. geringere Herstellungskosten, einfacherer Transport und die Möglichkeit, die Geldmenge an den Bedarf anzupassen. Laws Präferenz für ein kreditgestütztes System wird im Kontext der damaligen Wirtschaftslage erläutert und seine Überzeugung, dass eine Vermehrung des Zahlungsmittels die Kaufkraft steigern und die Wirtschaft ankurbeln würde, wird detailliert dargestellt.
Papiergeld in Frankreich: Dieser Abschnitt analysiert Laws Implementierung des Papiergeldsystems in Frankreich. Er beschreibt die Verknüpfung des Papiergeldes mit Aktien und Handelsgesellschaften, den daraus resultierenden Aktienboom und die schlussendliche Entwicklung der Spekulationsblase. Die detaillierte Darstellung des Aufstiegs und Falls der Aktienkurse verdeutlicht, wie Laws anfängliche Erfolge in ein katastrophales Scheitern umschlugen. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Abkehr Laws von seinem ursprünglichen, bodenbasierten Modell und den damit einhergehenden Risiken. Die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik Laws auf die französische Wirtschaft werden ebenfalls beleuchtet.
Gründe des Scheiterns: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen für das Scheitern von Laws Finanzprojekten. Es werden sowohl ökonomische Faktoren, wie z.B. die Überbewertung von Aktien und die mangelnde Deckung des Papiergeldes, als auch politische und gesellschaftliche Aspekte, wie z.B. die politische Instabilität und das fehlende Vertrauen in die Regierung, analysiert. Die Zusammenfassung betont die Komplexität der Ursachen und die Wechselwirkung verschiedener Faktoren, die zum Zusammenbruch des Systems beigetragen haben. Die Diskussion der ökonomischen und sonstigen Gründe zeigt auf, wie ein scheinbar vielversprechendes System durch eine Kombination von Fehlentscheidungen und ungünstigen Umständen letztendlich zusammenbrechen konnte.
Schlüsselwörter
John Law, Papiergeld, Aktienblase, Frankreich, 18. Jahrhundert, Finanzkrise, Wirtschaftspolitik, Münzsystem, Kreditwesen, Spekulation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Finanzprojekte John Laws im Frankreich des 18. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Finanzprojekte von John Law im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Einführung eines Papiergeldsystems, der damit verbundenen Aktienblase und dem letztendlich erfolgten Zusammenbruch. Analysiert werden die ökonomischen und politischen Faktoren, die zu diesem Erfolg und Scheitern beigetragen haben.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einführung und Funktionsweise des Papiergeldsystems im 18. Jahrhundert, die Rolle John Laws in der französischen Finanzpolitik, die Entstehung und den Zusammenbruch der Aktienblase, die ökonomischen Ursachen des Scheiterns von Laws Finanzprojekten sowie die politischen und gesellschaftlichen Folgen des Finanzcrashs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Papiergeldsystem im 18. Jahrhundert, zum Papiergeld in Frankreich, zu den Gründen des Scheiterns und ein Resümee. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse der jeweiligen Aspekte.
Welche Aspekte des Papiergeldsystems im 18. Jahrhundert werden beleuchtet?
Das Kapitel zum Papiergeldsystem im 18. Jahrhundert beleuchtet die Funktionsweise von Münz- und Papiergeldsystemen, den Unterschied zwischen edelmetallgestützten und kreditgestützten Systemen, die Vorteile von Papiergeld und Laws Präferenz für ein kreditgestütztes System im Kontext der damaligen Wirtschaftslage.
Wie beschreibt die Arbeit die Implementierung des Papiergeldsystems in Frankreich?
Die Arbeit analysiert Laws Implementierung des Papiergeldsystems in Frankreich, die Verknüpfung des Papiergeldes mit Aktien und Handelsgesellschaften, den daraus resultierenden Aktienboom und die Entwicklung der Spekulationsblase. Der Aufstieg und Fall der Aktienkurse und die Abkehr Laws von seinem ursprünglichen Modell werden detailliert dargestellt.
Welche Gründe für das Scheitern der Finanzprojekte werden genannt?
Die Arbeit untersucht ökonomische Faktoren wie die Überbewertung von Aktien und die mangelnde Deckung des Papiergeldes sowie politische und gesellschaftliche Aspekte wie politische Instabilität und fehlendes Vertrauen in die Regierung als Ursachen für das Scheitern. Die Komplexität der Ursachen und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren werden hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: John Law, Papiergeld, Aktienblase, Frankreich, 18. Jahrhundert, Finanzkrise, Wirtschaftspolitik, Münzsystem, Kreditwesen, Spekulation.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für alle gedacht, die sich für die Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts, die Rolle John Laws und die Entstehung und den Zusammenbruch von Finanzblasen interessieren. Sie eignet sich besonders für akademische Zwecke und die Analyse von Wirtschaftsthemen.
- Quote paper
- Christoph Haffa (Author), 2003, Die Finanzprojekte des John Law im absolutistischen Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22559