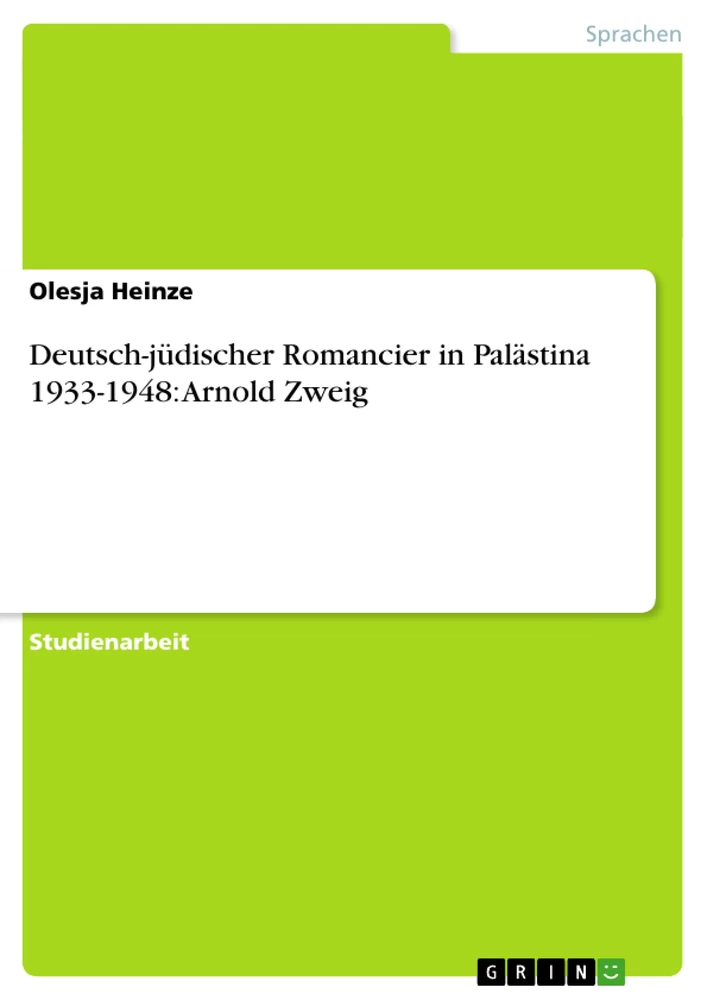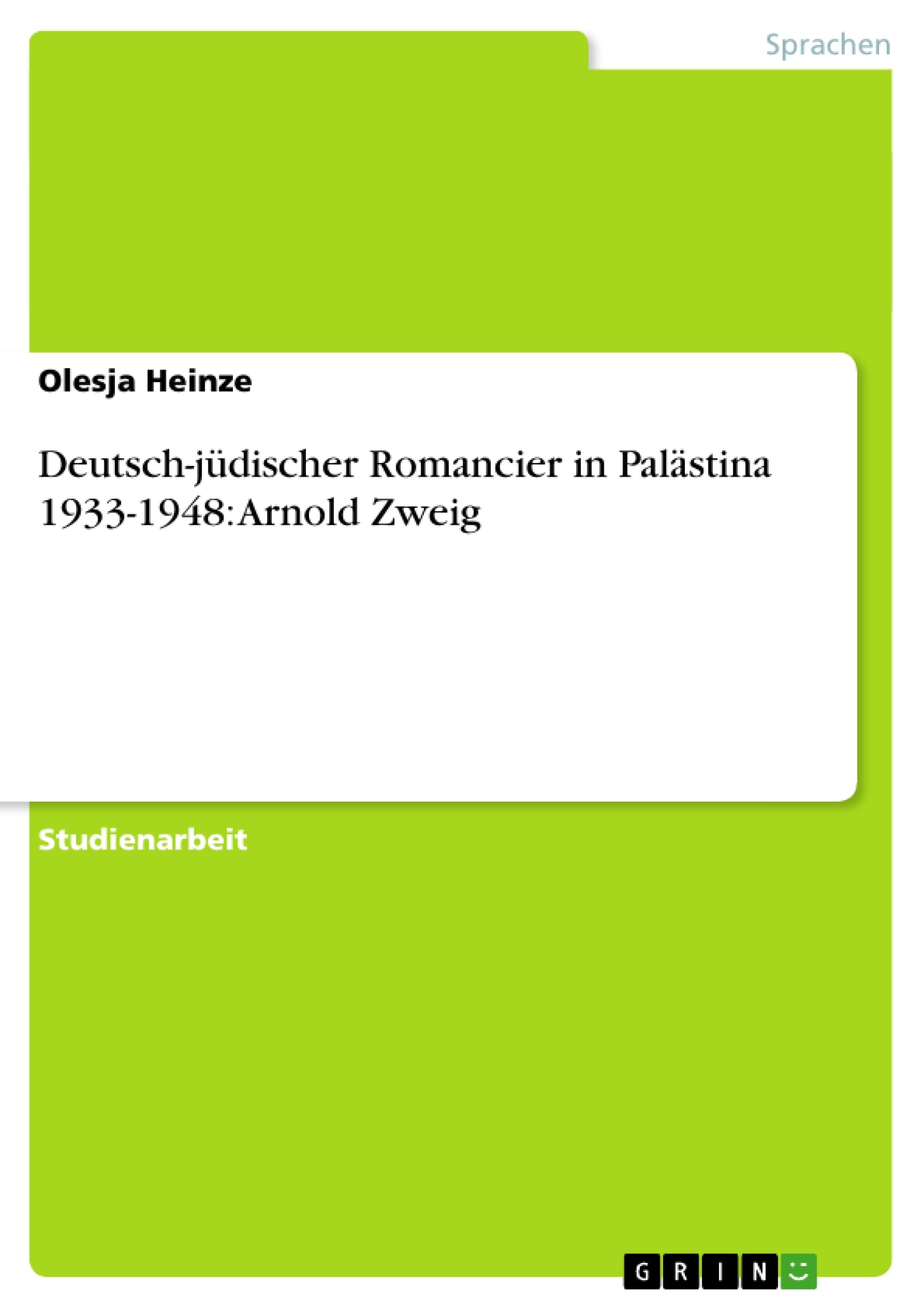Arnold Zweig ist am 10. November 1887 in der niederschlesischen Stadt Glogau (heute
Glogów; Polen) als Sohn des Sattlermeisters und späteren Spediteurs Adolf Zweig und seiner
Frau Bianca (geb. Spandow) zur Welt gekommen. Das Ehepaar Zweig brachte neben Arnold
noch zwei weitere Kinder zur Welt: Hans Rudolf und Ruth. Zehn Jahre nach Arnolds Geburt
musste der Familienvater aufgrund eines Erlasses des preußischen Kriegsministeriums, der
den Festungskommandanten Einkäufe bei jüdischen Kaufleuten untersagte, sein Geschäft
aufgeben. Familie Zweig verließ Glogau und zog nach Kattowitz (heute Katowice; Polen), die
oberschlesische Industriestadt, wo Zweigs Vater seinen ursprünglichen Beruf, den eines
Sattlers, wiederaufgenommen hatte.
An seine ersten Schuljahre in der Glogauer Schule erinnerte sich Arnold als an „das
grauenhafte, stumpfsinnige und sadistische Qualhaus“. 1 Von seiner Zeit in der Krattowittzer
Realschule und späteren Oberrealschule dagegen hatte er stets nur Gutes zu berichten. Seinem
Schuldirektor Jakob Hacks rühmte er nach: „Wenn aus mir etwas geworden ist oder noch
werden sollte, ihm danke ich davon ein gerüttelt Maß“. 2 Obwohl von Natur aus gesellig,
fühlte sich der kleine Arnold oft einsam und zog die Lektüre von Büchern dem Spielen mit
anderen Kindern vor. Zu dieser Außenseitereinsamkeit trug u.a. auch seine jüdische Herkunft
bei. Der junge Zweig blieb von den antisemitischen Sprüchen seiner Klassenkameraden nicht
verschont. Aufgrund dieser Jugenderlebnisse meldete sich in ihm das Leitmotiv, das er später
zum 11. Gebot erklärte: “Du sollst dich nicht erniedrigen lassen“. In seinem zum Teil
autobiographischen Buch Aufzeichnungen über die Familie Klopfer spiegeln sich diese
bitteren Erfahrungen wieder. Hinter der Hauptfigur, dem Schüler Peter Klopfer, verbirgt sich
niemand anders als Arnold Zweig selbst: „ ... Dann erfährst du, dass du ein kleiner Judenjunge
bist und was es bedeutet, einer zu sein; die Jungen rufen es dir auf der Straße nach, dass sich
dir das Herz umdreht vor Zorn“. 3 [...]
1 WOLF, Arie: Größe und Tragik Arnold Zweigs: ein jüdisch - deutscher Dichterschicksal in jüdischer Sicht,
London 1991, S.79
2 WOLF, 1991, S. 80
3 WIZNITZER, Manuel: Arnold Zweig: das Leben eines deutsch - jüdischen Schriftstellers,
Athenäum 1983, S.17
Inhaltsverzeichnis
- Der Weg zum Schriftsteller (1987 - 1918)
- Das Studentenleben und die ersten literarischen Versuche
- Erste Kontakte mit dem Zionismus
- Ein kriegsbegeisterter Schriftsteller und seine Desillusionierung
- Begegnung mit osteuropäischen Juden
- Arnold Zweig als Zionist und Pazifist (1918 – 1933)
- Nachkriegswirren und Antisemitismus
- Grischa und Caliban
- Junge Frau von 1914
- De Vriendt kehrt heim
- Familie Zweig verlässt Deutschland
- Arnold Zweig in Palästina (1933 – 1948)
- Die Zionistische Bewegung
- Schwierigkeiten eines Neueinwanderers
- Erziehung vor Verdun
- Der arabische Aufstand
- Einsetzung eines Königs
- Die Europareisen
- Zweigs Einstellung zum Sowjetrussland und zum Kommunismus
- Das Beil von Wandsbek
- Arnold Zweig in der DDR (1948 – 1968)
- Der herzliche Empfang
- Traum ist teuer
- Die letzten Jahre des Autors
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet das Leben und Werk des deutsch-jüdischen Schriftstellers Arnold Zweig, insbesondere seine Erfahrungen im 20. Jahrhundert. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung seiner schriftstellerischen Karriere, seine politische Haltung und seine Auseinandersetzung mit dem Zionismus und dem Antisemitismus zu analysieren.
- Zweigs literarisches Werk und dessen Entwicklung
- Zweigs Engagement im Zionismus und seine Sicht auf die jüdische Frage
- Zweigs Erfahrungen mit Antisemitismus und seine Reaktion auf diese Problematik
- Zweigs politische Haltung im Kontext der historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts
- Zweigs Leben in Palästina und sein Einfluss auf seine literarische Produktion
Zusammenfassung der Kapitel
Der Weg zum Schriftsteller (1987 - 1918)
Dieses Kapitel beleuchtet Zweigs Kindheit und Jugend, seine frühen literarischen Versuche und seine ersten Begegnungen mit dem Zionismus. Es beschreibt die antisemitischen Erfahrungen, die Zweigs Weltbild prägten, und seine Motivation, als Schriftsteller gegen Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Das Kapitel endet mit dem Beginn seiner schriftstellerischen Karriere und dem Erfolg seiner frühen Werke.
Arnold Zweig als Zionist und Pazifist (1918 – 1933)
Dieses Kapitel schildert Zweigs Engagement im Zionismus und seine Pazifismus während der Weimarer Republik. Es beschreibt seine literarische Produktion in dieser Zeit, die sich mit den Themen Krieg, Antisemitismus und der Suche nach einer neuen Heimat beschäftigt. Das Kapitel beleuchtet Zweigs wachsende Kritik an der deutschen Gesellschaft und seinen Entschluss, Deutschland zu verlassen.
Arnold Zweig in Palästina (1933 – 1948)
Dieses Kapitel beschreibt Zweigs Emigration nach Palästina und seine Erfahrungen als Einwanderer. Es schildert seine Auseinandersetzung mit der zionistischen Bewegung, seine Wahrnehmung des arabisch-jüdischen Konflikts und seine politische Haltung im Kontext der sich entwickelnden israelischen Nation.
Schlüsselwörter
Arnold Zweig, deutsch-jüdischer Romancier, Zionismus, Antisemitismus, Exil, Palästina, Literatur, 20. Jahrhundert, Krieg, Frieden, Identität, Jüdische Frage, deutschsprachige Literatur, deutsche Geschichte, literarische Gesellschaft PAN, Simplicissimus, Martin Buber, die Krähe, Episode, Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer, Novellen um Claudia.
- Quote paper
- Olesja Heinze (Author), 2001, Deutsch-jüdischer Romancier in Palästina 1933-1948: Arnold Zweig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22527