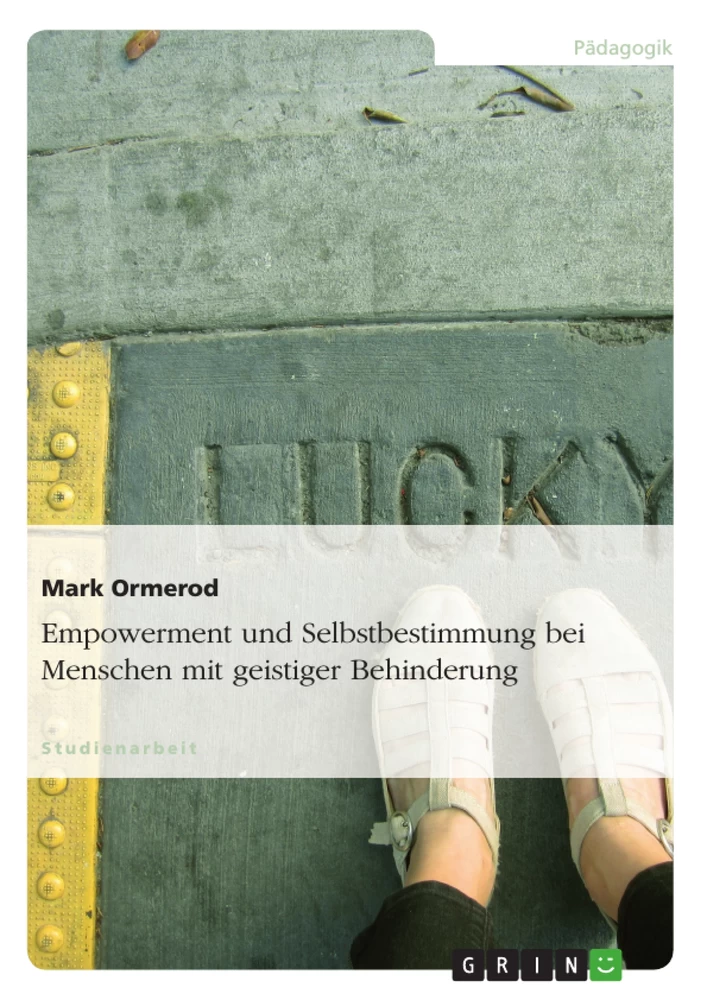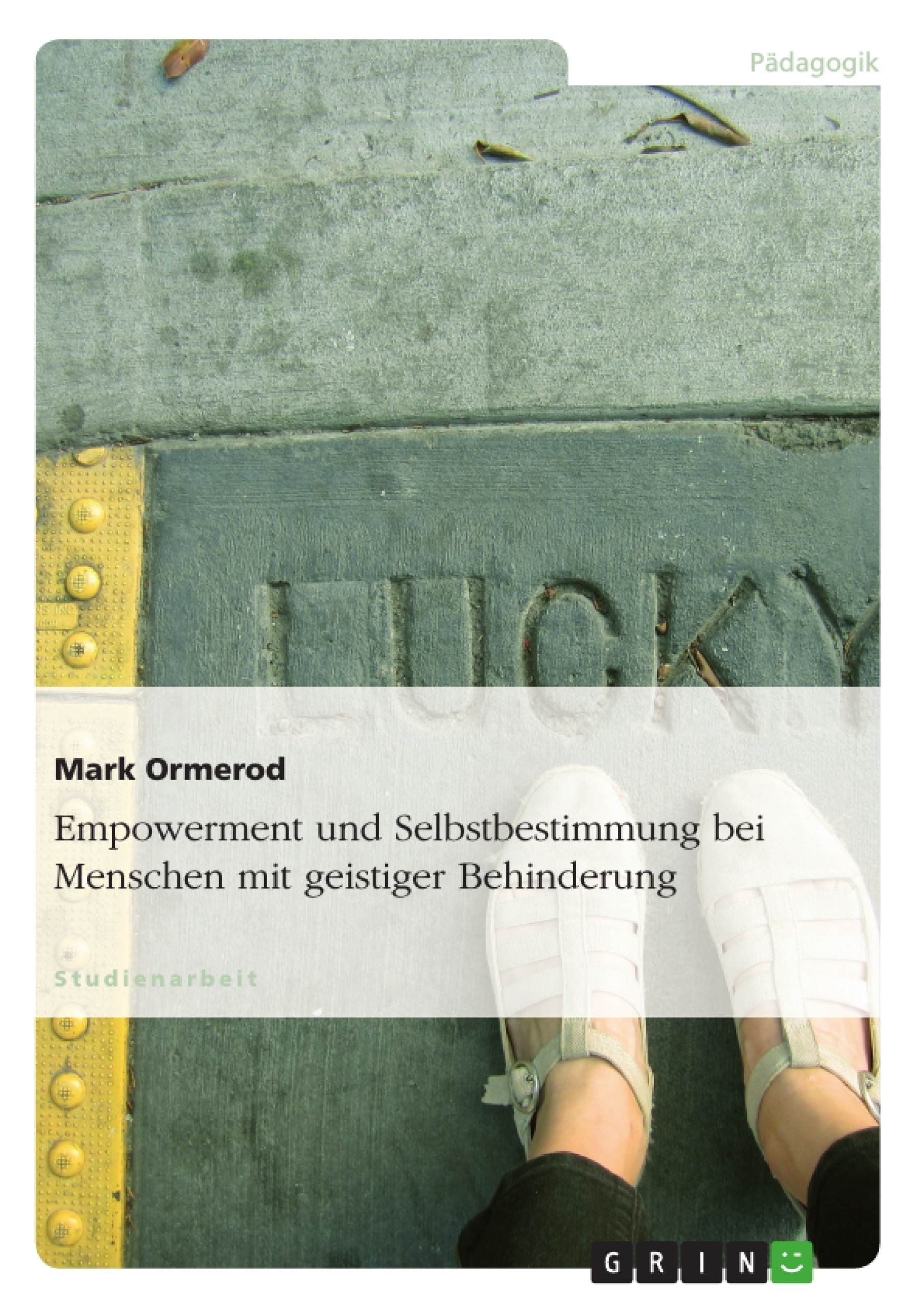Das erkenntnisleitende Interesse, mich im Rahmen dieser Arbeit mit den Themen Empowerment und Selbstbestimmung auseinander zusetzen, resultiert aus meinen beruflichen und persönlichen Erfahrungen als Mitarbeiter in einem Ferienprojekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit geistiger Behinderung. Die ca. 15 Teilnehmer sind zwischen 10 und 25 Jahre alt; die diagnostizierten Behinderungen reichen von Trisomie-21 über Autismus bis hin zu unfallbedingten und/oder schwerst-mehrfachen Behinderungen. Ich habe oft Situationen erlebt, in denen die jungen Menschen aus meiner Sicht heraus in ihren Rechten und Selbstbestimmungsmöglichkeiten eingeschränkt und in denen ihre Bedürfnisse durch Mitarbeiter missachtet wurden. Kann ein junger Mann mit 20 Jahren nicht selbst entscheiden, ob er abends lange wach bleibt oder morgens länger schläft? Und muss ein Kind mit in den Zoo, wenn es lieber mit der anderen Gruppe zum Schwimmen fahren möchte? Empowerment und Selbstbestimmung sind zurzeit die dominierenden Themen der Sonder- und Heilpädagogik. Die Entwicklungen werden als wegweisend für die Behindertenhilfe betrachtet und gründen auf ein Menschenbild, dass den Menschen mit Behinderung als Experten in eigenen Angelegenheiten ausweist und zentral die Annahmen beinhaltet, dass die Betroffenen selbst in der Lage sind, ihre Stärken und Ressourcen zu mobilisieren, dass sie wie andere Men-schen auch nach Unabhängigkeit und Entfaltung streben und sich selbst verwirklichen möchten und können. Im Sinne eines Gesamtkonzeptes spielen auch länger bekannte Paradigmen wie Enthospitalisierung, Normalisierung und Integration eine wesentliche Rolle und verlieren durch die jüngeren Ansätze keineswegs an Bedeutung. Selbstbestimmt-Leben kann ich mir bei Menschen mit körperlichen Behinderungen und innerhalb einer Infrastruktur, welche die erforderlichen Hilfsangebote bereitstellt, zwar durchaus vorstellen, aber können die damit verbundenen Forderungen und Ziele ohne weiteres auch auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden? Was bedeutet Selbstbestimmung genau? Soll jeder alles selbst bestimmen oder gibt es Ausnahmen? Und wie muss ich als Helfer befähigt bzw. professionalisiert sein, um adäquat auf die Betroffenen eingehen zu können?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- Das Empowerment-Konzept
- Begriffsbestimmung
- Historische Skizzen
- Zentrale Aspekte
- Ebenen und Bezugwerte
- Individuelle Ebene - Autonomie und Selbstbestimmung
- Gruppen- und Organisationsebene - Partizipation
- Strukturebene - Verteilungsgerechtigkeit
- Widersprüche, Handlungsparadoxien und Machtverhältnisse
- II. Menschen mit geistiger Behinderung und Selbstbestimmung
- Geistige Behinderung
- Definitionsansätze und Beschreibungsversuche
- Geschichte der Behindertenarbeit und Enthospitalisierung
- Von der Normalisierung zur Selbstbestimmung – Leitbilder in der Arbeit mit (geistig) behinderten Menschen
- Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung?
- Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung
- Alltagsbezogene Selbstbestimmung durch tagesstrukturierende Aufgaben
- Wohnen, Arbeit und Freizeit -Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen
- Perspektiven / Beispiel eines Handlungsmodells aus der Praxis (Werkstatthaus Hamburg – Wohnen und arbeiten in der Stadt)
- III. Konsequenzen für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit
- Werte, Einstellungen und Bereitschaft der Mitarbeiter
- Zur Rolle der professionellen Helfer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Empowerment-Konzept und seine Relevanz für die Förderung von Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Sie untersucht die historische Entwicklung des Empowerment-Konzeptes, seine zentralen Aspekte und seine Umsetzung in der Praxis. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Förderung von Selbstbestimmung in verschiedenen Lebensbereichen, wie Wohnen, Arbeit und Freizeit, gelegt.
- Das Empowerment-Konzept und seine Bedeutung für die Förderung von Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Herausforderungen und Chancen der Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Rolle von professionellen Helfern in der Förderung von Selbstbestimmung
- Die Bedeutung von Teilhabe und Inklusion für Menschen mit geistiger Behinderung
- Die Notwendigkeit einer systemischen Perspektive auf die Förderung von Selbstbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den Ausgangspunkt der Untersuchung dar. Sie beschreibt das erkenntnisleitende Interesse des Autors und die Motivation zur Beschäftigung mit dem Thema Empowerment und Selbstbestimmung. Es wird auf die eigenen Erfahrungen des Autors in einem Ferienprojekt für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung eingegangen. Im Anschluss wird das Empowerment-Konzept in seiner Komplexität und Bedeutung für die Förderung von Selbstbestimmung erläutert.
Kapitel II beschäftigt sich mit dem Begriff der geistigen Behinderung. Es werden Definitionsansätze und Beschreibungsversuche sowie die historische Entwicklung der Behindertenarbeit beleuchtet. Die Arbeit untersucht, wie die Konzepte der Normalisierung und Integration in den letzten Jahren durch das Selbstbestimmungsparadigma ergänzt und weiterentwickelt wurden.
Kapitel III geht der Frage nach, wie das Selbstbestimmungsparadigma auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden kann. Es werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt, die zeigen, wie sich Selbstbestimmung in verschiedenen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit und Freizeit verwirklichen lässt. Der Fokus liegt dabei auf der Schaffung von Bedingungen, die eine größtmögliche Selbstständigkeit und Teilhabe ermöglichen.
Kapitel IV behandelt die Konsequenzen für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit. Es wird die Bedeutung von Werten, Einstellungen und Bereitschaft der Mitarbeiter in der Förderung von Selbstbestimmung betont. Die Arbeit reflektiert die Rolle von professionellen Helfern und stellt die Notwendigkeit einer neuen Kultur des Helfens in den Vordergrund.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Empowerment, Selbstbestimmung, geistige Behinderung, Teilhabe, Inklusion, Normalisierung, Integration, professionelle Hilfe, Lebensqualität, Autonomie, Partizipation und Menschenrechte. Die Arbeit analysiert die Verbindung zwischen Empowerment und Selbstbestimmung und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Umsetzung dieser Konzepte für Menschen mit geistiger Behinderung einhergehen.
- Quote paper
- Mark Ormerod (Author), 2004, Empowerment und Selbstbestimmung bei Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22403