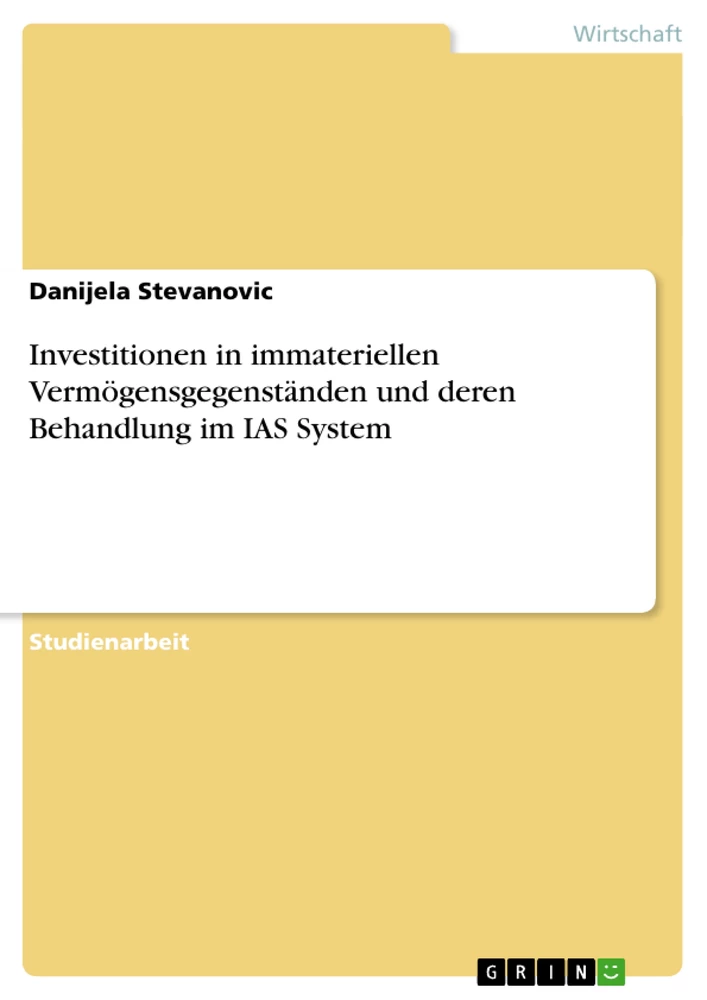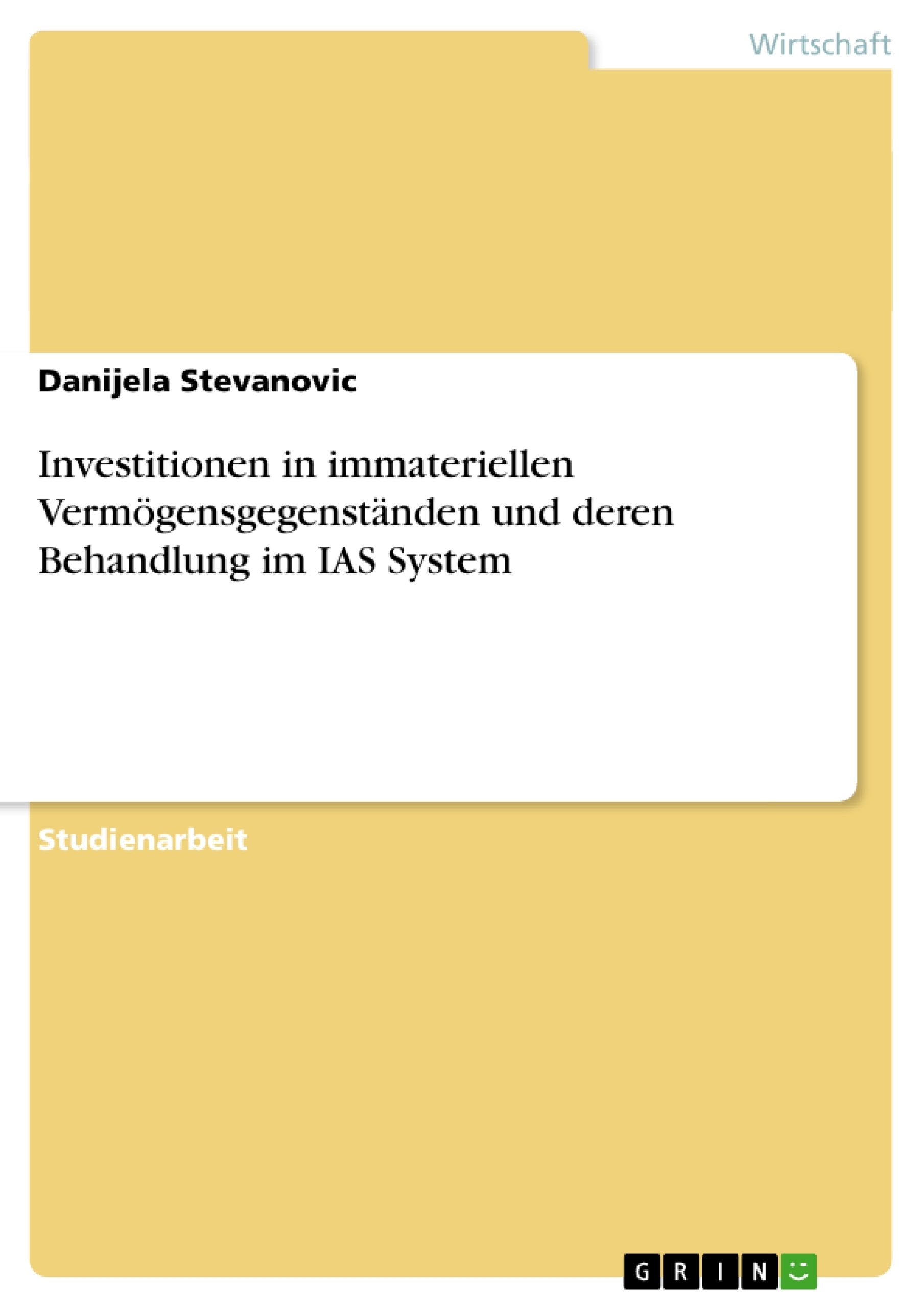Die bereits aus dem Jahre 1979 stammende Aussage, dass immaterielle
Güter die „ewigen Sorgenkinder des Bilanzrechts“1 sind, besitzt nach
wie vor Gültigkeit. Diese Aussage ist heute sogar auf die internationale
Rechnungslegung auszudehnen. So stellt der Ansatz von immateriellen
Gütern eines der bedeutendsten und zugleich umstrittensten
Bilanzierungs-probleme bei der internationalen Harmonisierung der
Rechnungslegung dar.
Mit der vorliegenden Arbeit werden die Ansatzgrundsätze und
Ansatzvorschriften von immateriellen Gütern in Deutschland und nach
IASC rechtsvergleichend analysiert.
Nimmt man einen Vergleich der Rechnungslegung vor, ist es durchaus
möglich, 150 – 200 aber auch mehr Unterschiede zwischen der
Rechnungslegung nach IAS einerseits und nach dem HGB andererseits zu
zeigen. Ohne eine gleichzeitige ausführliche Darstellung der
Rechnungslegung nach IAS und HGB hat es wenig Sinn, detailliert die
Unterschiede aufzuzeigen. Deshalb beschränkt sich diese Arbeit auf die
wesentlichen Unterschiede.
In einem ersten Schritt werden die Definitionen und Klassifikationen der
Investitionen in immateriellen Vermögensgegenstände aufgezeigt.
Dann im nächsten Schritt werden jeweils getrennt für die zwei betrachteten
Rechnungslegungssysteme die Ansatzgrundsätze und Ansatzvorschriften
für immaterielle Güter untersucht. Da sich die Rechnungslegungssysteme
grundlegend voneinander unterscheiden, wird dann eine
Zusammenfassung der Unterschiede dargestellt.
Am Ende dieser Arbeit wird aus den ermittelten Unterschieden eine
Zusammenfassung und ein Ausblick abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- B. Investitionen in immateriellen Vermögensgegenständen
- I. Begriff der Investition
- II. Arten der Investition
- 1. Objektbezogene Investitionen
- 2. Wirkungsbezogene Investitionen
- 3. Sonstige Investitionen
- III. Investitionen in immateriellen Vermögensgegenständen
- C. Immaterielle Güter in der internationalen Rechnungsauslegung
- I. Internationaler Kapitalmarkt und internationale Rechnungsauslegung
- 1. Systeme internationaler Rechnungslegung
- 2. Unterschiedliche Philosophien von deutscher und internationaler Rechnungslegung
- II. Immaterielle Vermögensgegenstände im IAS
- 1. Einführung
- 2. Entwicklung
- 3. Begriff
- 4. Ansatz
- 5. Bewertung im Zugangsjahr
- 6. Bewertung in den Folgejahren
- a) Bevorzugte Methode (benchmark treatment)
- b) Zulässige Alternative (allowed alternative treatment)
- 7. Abschreibungen
- 8. Zuschreibungen
- a) Bevorzugte Methode
- b) Zulässige Methode
- 9. Abgänge
- 10. Angaben
- III. Immaterielle Vermögensgegenstände im HGB
- 1. Begriff
- 2. Ausweis
- 3. Ansatz und Bewertung
- 4. Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände
- 5. Geschäfts- oder Firmenwert
- 6. Sonderposten: Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
- 7. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals
- 8. Sonstiges
- 9. Angaben
- IV. Zusammenfassung
- D. Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Ansatzgrundsätze und Ansatzvorschriften von immateriellen Gütern in Deutschland und nach IASC rechtsvergleichend zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Unterschiede in der Rechnungslegung für immaterielle Vermögensgegenstände im deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IAS).
- Unterschiede in der Rechnungslegung für immaterielle Vermögensgegenstände zwischen HGB und IAS
- Ansatz und Bewertung immaterieller Vermögensgegenstände
- Bedeutung von immateriellen Gütern in der modernen Wirtschaft
- Herausforderungen bei der Bewertung und Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
- Harmonisierung der Rechnungslegungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik immaterieller Vermögensgegenstände und erläutert die Bedeutung dieser Güter in der heutigen Wirtschaft. Es werden verschiedene Arten von Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände vorgestellt und die Schwierigkeiten bei der Bilanzierung dieser Vermögensgegenstände herausgestellt.
In den folgenden Kapiteln wird zunächst der Begriff der Investition im Allgemeinen betrachtet. Die Arbeit geht dann auf die unterschiedlichen Arten von Investitionen ein, wobei ein besonderer Fokus auf Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände liegt. Hierbei wird die Definition und Klassifikation dieser Investitionen erörtert.
Im nächsten Schritt werden die Ansatzgrundsätze und Ansatzvorschriften von immateriellen Vermögensgegenständen im deutschen HGB und im internationalen IAS-System im Detail betrachtet. Die Arbeit zeigt dabei die wesentlichen Unterschiede in der Rechnungslegung für immaterielle Vermögensgegenstände zwischen den beiden Systemen auf.
Die Arbeit beinhaltet ebenfalls eine Untersuchung des Ausweises von immateriellen Vermögensgegenständen im HGB und im IAS. Die verschiedenen Methoden der Bewertung und Abschreibung werden im Detail erläutert. Darüber hinaus werden die spezifischen Regeln für die Behandlung von selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen, Geschäfts- oder Firmenwerten und anderen Sonderposten in beiden Systemen betrachtet.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögensgegenstände, Rechnungslegung, HGB, IAS, Bilanzierung, Investition, Ansatzgrundsätze, Bewertung, Abschreibung, Harmonisierung, Rechtsvergleichung
- Citar trabajo
- Danijela Stevanovic (Autor), 2003, Investitionen in immateriellen Vermögensgegenständen und deren Behandlung im IAS System, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22399