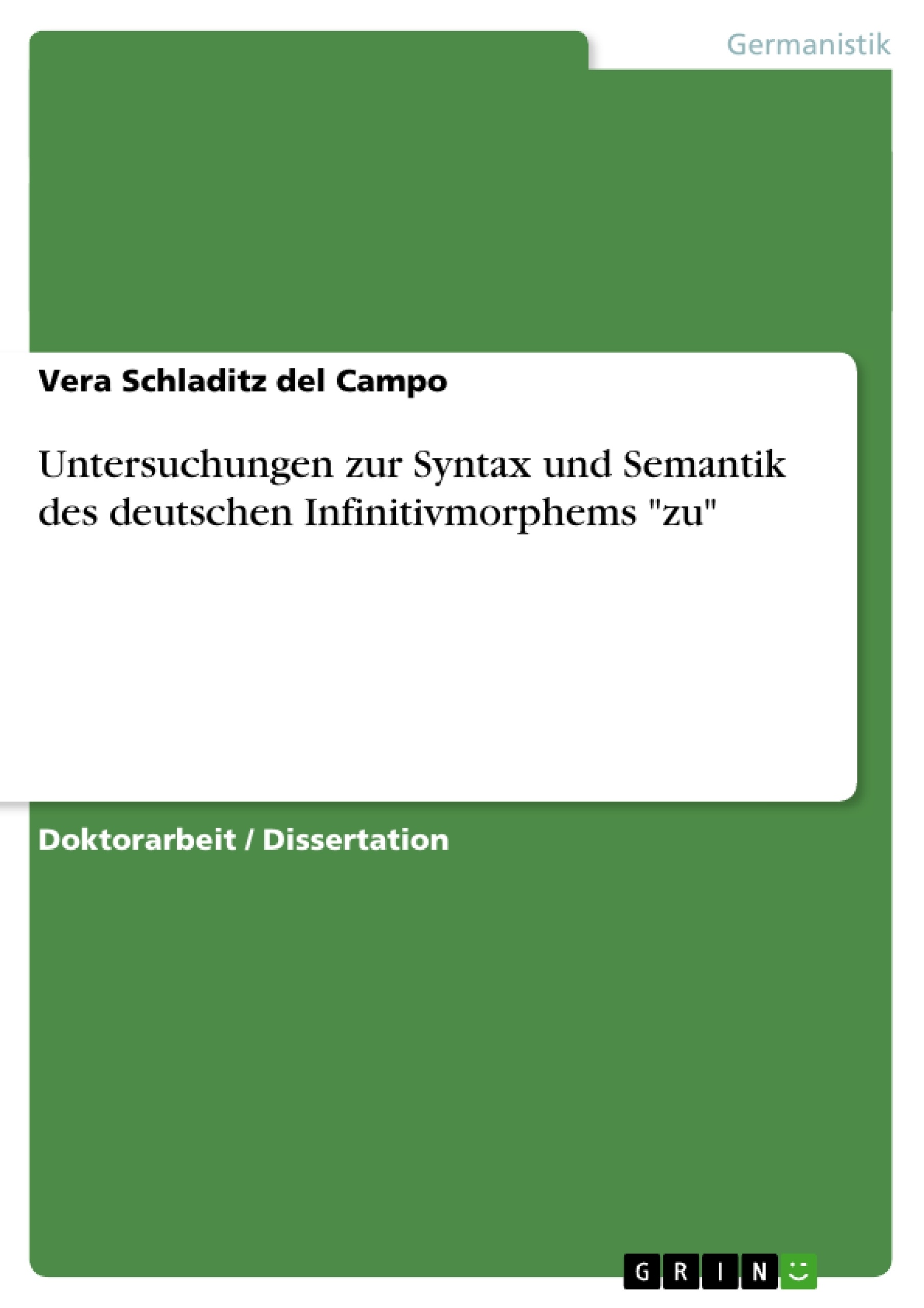Untersuchungen zur Syntax und Semantik des deutschen Infinitivmorphems zu sind der Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit, die eine empirische Untersuchung und Analyse des in Rede stehenden Elements darstellt. Den Ausgangspunkt unserer Überlegungen bildet erstens die Einsicht, dass obwohl zu überwiegend ein graphemisch unabhängiges Morphem ist, es sich aber doch als nur bedingt eigenständig erweist. Zweitens stellt sich die Frage seiner kategorialen Zugehörigkeit, die wir unter anderem anhand von Vergleichen mit dem englischen to und den italienischen di und a, zu bestimmen versuchen. Wenngleich zu in den traditionellen Grammatiken als Präposition oder Konjunktion gewertet wird, kommen wir nach einer ausführlichen Erörterung der Frage zu dem Schluss, dass es weder zu der einen noch zu der anderen Kategorie gehören kann. Unserer Arbeit liegt die Rektions-Bindungstheorie zugrunde, wenngleich wir uns verschiedener, zur traditionellen deskriptiven Grammatik gehörender Begriffe, wie Bechs Einteilung der infiniten Verbalformen und die Aufteilung des deutschen Satzes in sogenannte Felder und Satzklammern, bedient haben. Dieser Rückgriff auf die traditionelle Terminologie hat praktische Gründe und keine konzeptionellen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhalt
- Abkürzungen und Symbole
- Einleitung
- Kapitel 1 - Ein Grundriss der Rektions-Bindungs-Theorie
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Die Generative Grammatik
- 1.1.1 Die Universalgrammatik
- 1.1.2 Der pro-drop-Parameter
- 1.1.3 Phrasenstrukturregeln
- 1.1.4 Die X-bar-Syntax
- 1.2 Die Theta-Theorie
- 1.3 Die Kasustheorie
- 1.3.1 Wortstellungstypologien
- 1.4 Transformationen
- 1.4.1 Die erweiterte Standard-Theorie
- 1.4.2 Bewegungsregeln
- 1.4.2.1 NP-Bewegung
- 1.4.2.2 wh-Bewegung
- 1.4.2.3 Kopf-zu-Kopf-Bewegung
- 1.4.3 Das Verb-zweit-Phänomen
- 1.5 Module der generativen Grammatik
- 1.5.1 Rektionstheorie
- 1.5.2 Bindungstheorie
- 1.5.3 Kontrolltheorie
- 1.6 Schlusswort
- Kapitel 2 Die infinitivische Form des Verbs und zu
- 2.0 Einleitung
- 2.1 Etwas aus der Geschichte von zu
- 2.2 Wie erkennt man die infinitivische Form des Verbs?
- 2.2.1 Bechs Status und Stufen des infiniten Verbs
- 2.2.2 Felder-Theorie/Die rechte Satzklammer
- 2.3 zu: Eigenständiges Wort oder Affix/Infix
- 2.3.1 Über die kategoriale Zugehörigkeit der Infinitiv-Morpheme zu, to, di, a
- 2.4 Schlusswort
- Kapitel 3 Die strukturelle Position des Infinitiv-morphems zu
- 3.0 Einleitung
- 3.1 Über die Struktur des deutschen Satzes: Eine S'-Analyse
- 3.1.1 S-Analyse der deutschen Infinitivsätze: Tappes Theorie
- 3.2 Exceptional Case Marking (ECM)
- 3.3 zu als Konjunktion: Wilders Theorie
- 3.4 Über die Unmöglichkeit von wh-Infinitiven mit zu
- 3.5 zu als Kopf von IP: Giustis INFL-Hypothese
- 3.5.1 Evidenz aus dem Dänischen und Norwegischen
- 3.6 Die Position des Infinitivmorphems im Deutschen und Englischen im Verhältnis zu dem Satzadverbial nicht/not
- 3.7 Beukemas und den Dikkens AGR-Hypothese
- 3.8 Schlusswort
- Kapitel 4 Das Matrixverb und zu
- 4.0 Einleitung
- 4.1 Autonomiethese der Syntax und die Rolle der Semantik
- 4.2 Subklassifizierung der Verben durch den zu-Infinitiv
- 4.2.1 Kontrollverben
- 4.2.2 raising-Verben
- 4.3 Vorläufige Bilanz der Erkenntnisse
- 4.4 Subklassifizierung der Verben durch den Infinitiv ohne zu
- 4.4.1 Modalverben
- 4.4.2 Bewegungsverben
- 4.4.3 Wahrnehmungsverben
- 4.4.4 Kausative/permissive Verben
- 4.5 Zusammenfassung
- 4.5.1 Bedingte Eigenständigkeit/Keine Kategorie
- Die generativen Prinzipien und die Rolle der Rektions-Bindungs-Theorie
- Die strukturelle Position des Infinitivsatzes und des Morphems "zu"
- Die Interaktion von "zu" mit dem Matrixverb und die Subklassifizierung von Verben
- Die Semantik des Infinitivsatzes und die Bedeutung von "zu"
- Die Rolle von "zu" in Bezug auf die Kasuszuweisung und die Bewegung von Konstituenten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Syntax und Semantik des deutschen Infinitivmorphems "zu". Ziel der Untersuchung ist es, die strukturelle Position des Morphems "zu" innerhalb der deutschen Satzstruktur aus generativer Sicht zu analysieren und zu erklären, wie dieses Morphem mit dem Matrixverb interagiert und die Interpretation des Infinitivsatzes beeinflusst.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet einen Überblick über die Rektions-Bindungs-Theorie, die die Grundlage für die Analyse des Infinitivmorphems "zu" bildet. Kapitel 2 befasst sich mit der infinitivischen Form des Verbs und der Geschichte des Morphems "zu", analysiert die Kriterien zur Identifizierung der infinitivischen Form und diskutiert die kategoriale Zugehörigkeit von "zu". In Kapitel 3 wird die strukturelle Position des Infinitivmorphems "zu" innerhalb des Satzes beleuchtet, verschiedene Theorien über die Struktur von Infinitivsätzen und die Position von "zu" werden präsentiert. Kapitel 4 untersucht die Beziehung zwischen dem Matrixverb und dem Infinitivmorphem "zu" und betrachtet verschiedene Kategorien von Matrixverben, die mit Infinitivsätzen verbunden sind.
Schlüsselwörter
Infinitivmorphem "zu", Generative Grammatik, Rektions-Bindungs-Theorie, Satzstruktur, Matrixverb, Subklassifizierung, Kasuszuweisung, Bewegung, Semantik.
- Quote paper
- Vera Schladitz del Campo (Author), 2001, Untersuchungen zur Syntax und Semantik des deutschen Infinitivmorphems "zu", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22280