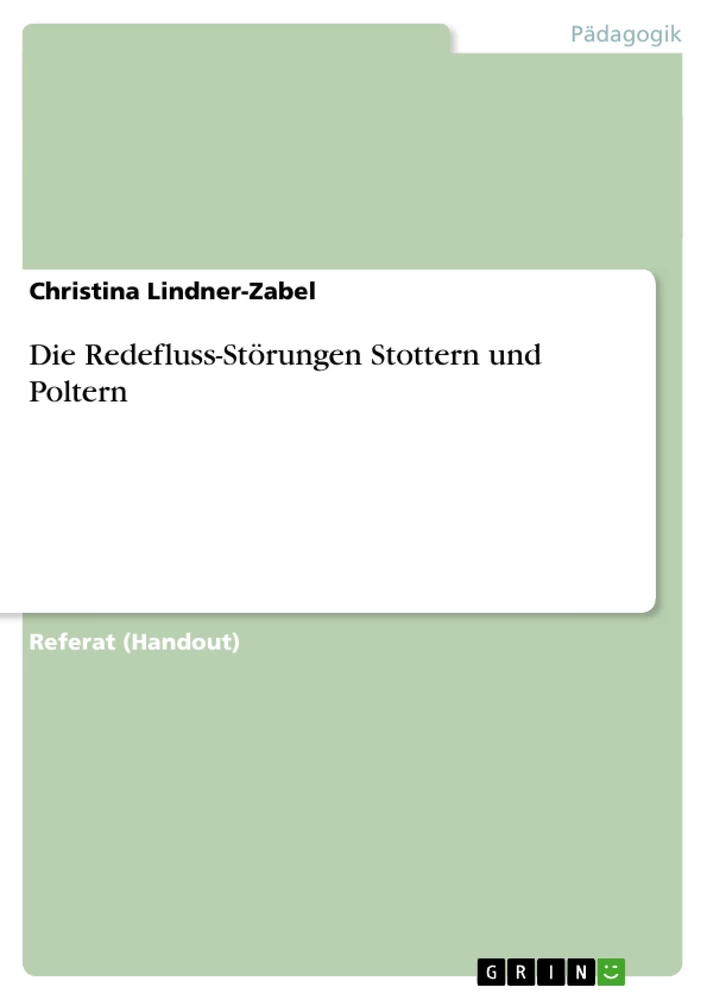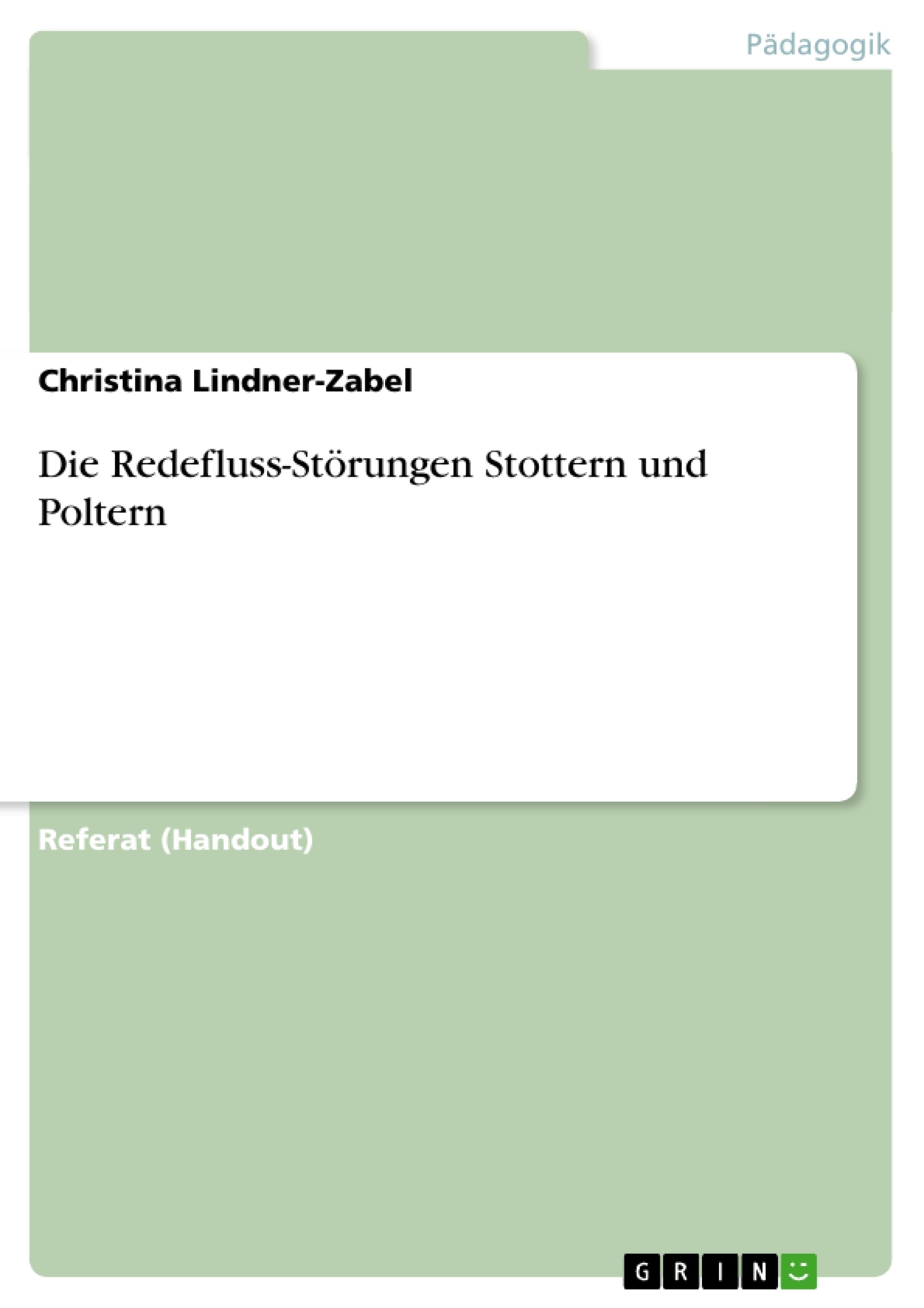Stottern ist ein Phänomen, mit dem wohl schon jede/r einmal in Berührung gekommen ist, vielleicht weil der Klassenkamerad gestottert hat oder weil man selbst die erste große Liebeserklärung nur unter Stottern hervorgebracht hat. Die Reaktionen auf und der Umgang mit diese/r Störung sind ganz unterschiedlich: die einen finden sie höchst amüsant, wovon viele Witze zeugen („Trifft ein Stotterer einen Glatzköpfigen und fragt diesen: <Wwwwwas kkkkostet denn ddddein Haarschnitt?> Der Glatzköpfige antwortet: <Weniger als bei dir ein Ortsgespräch!> “). Mitunter sicherlich ein Grund dafür, dass viele Betroffene versuchen, Situationen zu umgehen, die ihr Stottern preisgeben könnten. Andere Stotterer haben auch mit ihrer Krankheit Karriere gemacht: Winston Churchill, Bruce Willis, Marylin Monroe, Gareth Gates- die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Der US- Sänger „Scatman John“ machte aus seiner Krankheit einen Song, widmete sein erstes Album allen stotternden Menschen. Als er dafür den Grammy erhielt, brauchte er zehn Minuten, um sich in zwei Sätzen für die Auszeichnung zu bedanken. Das Phänomen Poltern ist dagegen eher unbekannt, obwohl es den meisten Menschen ebenso schon mal begegnet oder gar passiert sein dürfte. Die folgende Arbeit möchte einen ersten Überblick über diese beiden Redeflussstörungen, ihre möglichen Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Überblick über Störungen des Sprechens und der Sprache
- 3. Stottern
- Definition
- Häufigkeit
- Beginn
- Formen
- Sekundäre Symptome
- Ursachen
- Therapie
- Prognose
- 4. Poltern
- Abgrenzung zum Entwicklungsstottern
- Definition
- Symptome
- Ursachen
- Therapie und Prognose
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen ersten Überblick über die Redeflussstörungen Stottern und Poltern. Ziel ist es, die möglichen Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten dieser beiden Störungen zu beschreiben und zu erläutern. Die Arbeit konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte beider Phänomene, ohne tief in die detaillierte Forschung einzutauchen.
- Definition und Abgrenzung von Stottern und Poltern
- Häufigkeit und Beginn der Störungen
- Symptome und verschiedene Formen des Stotterns
- Mögliche Ursachen beider Störungen
- Therapieansätze und Prognose
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung führt in das Thema der Redeflussstörungen Stottern und Poltern ein und verdeutlicht deren gesellschaftliche Wahrnehmung, die von Amusement bis hin zu Verständnis und Akzeptanz reicht. Sie stellt die unterschiedlichen Reaktionen auf Stottern dar, von Witzen bis hin zu erfolgreichen Persönlichkeiten, die mit dieser Störung leben und arbeiten. Die Einleitung hebt die relative Unbekanntheit des Polterns hervor und kündigt eine Übersicht über beide Störungen an.
2. Überblick über Störungen des Sprechens und der Sprache: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Störungen des Sprechens und der Sprache. Es beschreibt das komplexe Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die an der Entstehung von Sprachstörungen beteiligt sind, und benennt verschiedene Störungsbilder, einschließlich Dyslalie, Dysgrammatismus und Sprachentwicklungsstörungen. Es wird auf den Mutismus und Störungen der Stimme und des Stimmklangs eingegangen, bevor der Fokus auf die Redeflussstörungen Stottern und Poltern gelegt wird, die im Folgenden detaillierter behandelt werden.
3. Stottern: Dieses Kapitel definiert Stottern als eine willensunabhängige, situationsabhängige Redeflussstörung. Es erläutert die vielfältigen Symptome und die unterschiedlichen Ursachen, welche körperliche, seelische und interpersonelle Faktoren umfassen. Die Häufigkeit, der Beginn und verschiedene Formen des Stotterns, wie das klonische Stottern, werden beschrieben. Es wird auf die Fehlinterpretation von Stottern als schlechte Angewohnheit hingewiesen und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung hervorgehoben.
4. Poltern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Redeflussstörung Poltern, wobei zunächst eine Abgrenzung zum Entwicklungsstottern vorgenommen wird. Es beschreibt Definition, Symptome und mögliche Ursachen des Polterns. Leider bietet der Auszug keine detaillierte Darstellung der Therapie und Prognose für diese Störung.
Schlüsselwörter
Stottern, Poltern, Redeflussstörungen, Sprachstörungen, Sprechstörungen, Balbuties, Symptome, Ursachen, Therapie, Prognose, Häufigkeit, Sprachentwicklung, Kommunikationsstörungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Redeflussstörungen: Stottern und Poltern"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Redeflussstörungen Stottern und Poltern. Sie behandelt Definitionen, Häufigkeit, Beginn, Symptome, Ursachen, Therapieansätze und Prognosen beider Störungen. Zusätzlich enthält sie eine Einführung in das Thema, einen Überblick über verschiedene Sprech- und Sprachstörungen und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Der Fokus liegt auf den wesentlichen Aspekten, ohne tief in die detaillierte Forschung einzutauchen.
Welche Störungen werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf Stottern und Poltern. Sie bietet jedoch auch einen allgemeinen Überblick über verschiedene Sprech- und Sprachstörungen, darunter Dyslalie, Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstörungen, Mutismus und Störungen der Stimme und des Stimmklangs.
Was ist der Unterschied zwischen Stottern und Poltern?
Die Arbeit definiert und grenzt Stottern und Poltern voneinander ab. Während Stottern als willensunabhängige, situationsabhängige Redeflussstörung beschrieben wird, wird der Unterschied zum Entwicklungsstottern beim Poltern herausgestellt. Die genauen Unterschiede in den Symptomen und Ursachen werden im Detail erläutert.
Welche Symptome werden bei Stottern beschrieben?
Die Arbeit beschreibt vielfältige Symptome des Stotterns, einschließlich verschiedener Formen wie klonisches Stottern. Sie betont die Bedeutung der differenzierten Betrachtung und weist auf die Fehlinterpretation von Stottern als schlechte Angewohnheit hin.
Welche Ursachen für Stottern und Poltern werden genannt?
Die Arbeit nennt körperliche, seelische und interpersonelle Faktoren als mögliche Ursachen sowohl für Stottern als auch für Poltern. Jedoch werden die Ursachen nicht im Detail behandelt.
Wie werden Stottern und Poltern behandelt?
Die Arbeit beschreibt Therapieansätze für Stottern. Für Poltern wird leider im vorliegenden Auszug keine detaillierte Darstellung der Therapie und Prognose angeboten.
Wie häufig treten Stottern und Poltern auf?
Die Arbeit erwähnt die Häufigkeit des Stotterns, bietet aber keine genauen Zahlen. Informationen zur Häufigkeit des Polterns werden nicht detailliert dargestellt.
Wann beginnen Stottern und Poltern typischerweise?
Die Arbeit erwähnt den Beginn des Stotterns, aber es werden keine genauen Angaben zum Zeitpunkt des Beginns gemacht, weder für Stottern noch für Poltern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen: Stottern, Poltern, Redeflussstörungen, Sprachstörungen, Sprechstörungen, Balbuties, Symptome, Ursachen, Therapie, Prognose, Häufigkeit, Sprachentwicklung, Kommunikationsstörungen.
- Citar trabajo
- Christina Lindner-Zabel (Autor), 2004, Die Redefluss-Störungen Stottern und Poltern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22260