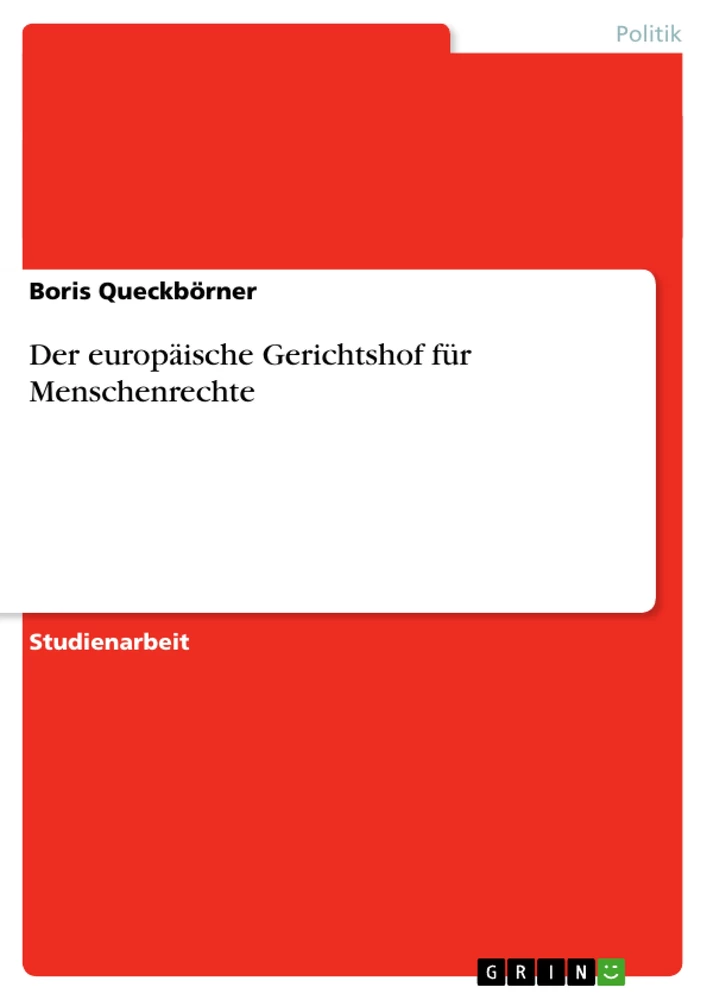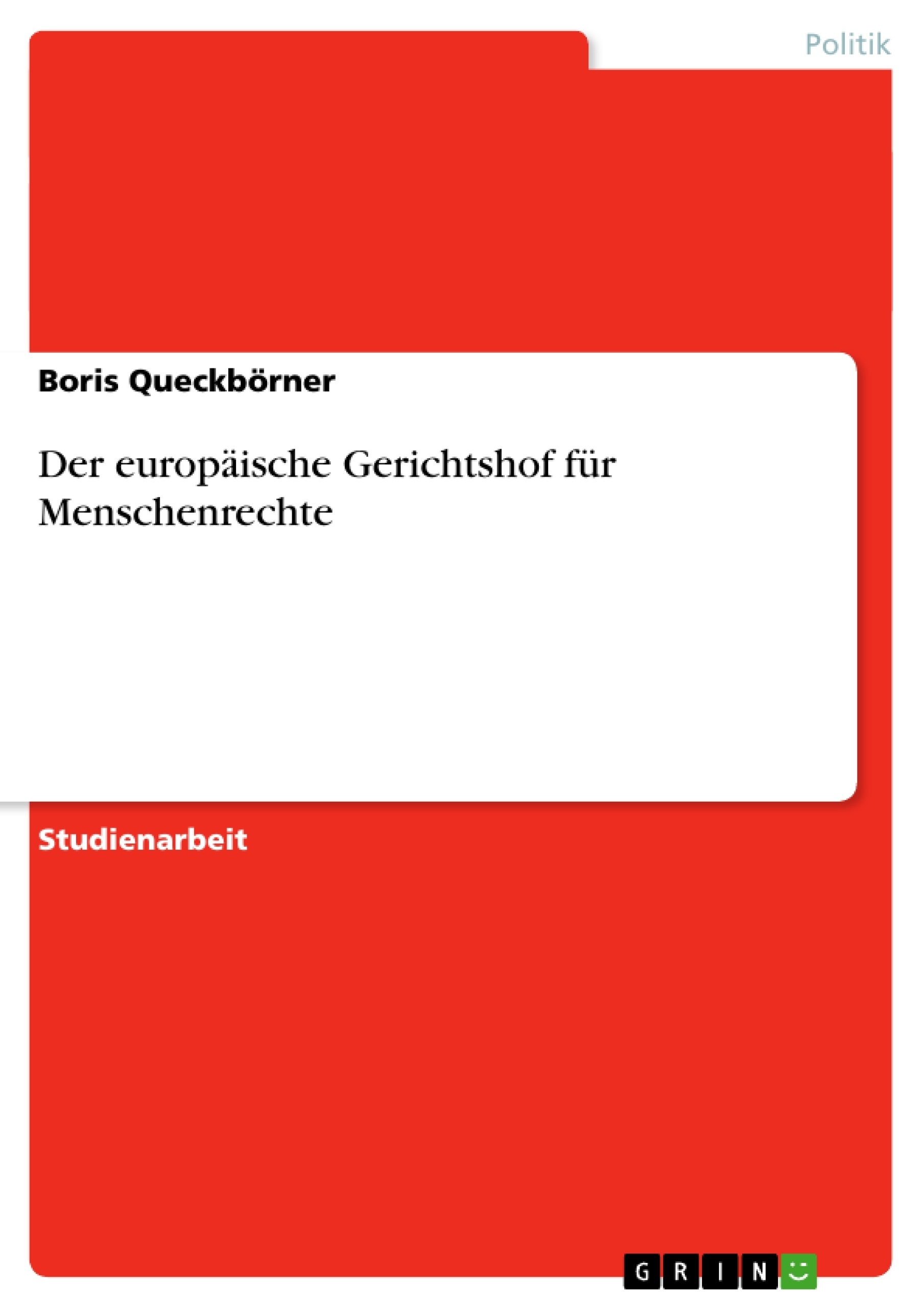Die nachfolgende Arbeit soll sich mit der Institution des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte beschäftigen. In Anbetracht gewisser Umstände – etwa die äußerst dürftige Quellenlage, oder auch der Rahmen, den diese Arbeit einhalten soll – muß sich die Darstellung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Wesentlichen auf die Arbeitsweise und die Zusammensetzung beschränken. Dabei soll aber nicht vergessen werden, kurz auf die Entstehungsgeschichte des Gerichtshofes als Organ der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Europäische Menschenrechtskonvention(EMRK)
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte(EGMR)
Schlußteil
Anhang
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die nachfolgende Arbeit soll sich mit der Institution des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte beschäftigen. In Anbetracht gewisser Umstände – etwa die äußerst dürftige Quellenlage, oder auch der Rahmen, den diese Arbeit einhalten soll – muß sich die Dar-stellung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte im Wesentlichen auf die Arbeitsweise und die Zusammensetzung beschränken. Dabei soll aber nicht vergessen werden, kurz auf die Entstehungsgeschichte des Gerichtshofes als Organ der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) einzugehen.
Die Europäische Menschenrechtskonvention(EMRK)
Nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, in dessen Verlauf u.a. die elementarsten Menschenrechte in einer Weise verletzt wurden, die schlichtweg „unmenschlich“ war, trachteten die Staaten dieser Erde danach, solche Greueltaten für die Zukunft zu verhindern.
Ein erster Schritt auf diesem Weg hin zu einer gerechteren und besseren Welt sollte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10.12.1948 sein. Obwohl dieses Dokument lediglich in der Form einer rechtlich unverbindlichen Deklaration verabschiedet wurde, hatte es doch vor allem eine starke Auswirkung auf die nachfolgende Menschenrechtspolitik der westlichen Welt. Aber es war nicht nur die Menschenrechtspolitik der westlichen Mächte, die durch die „Erklärung“ eine neue Form annahm; das politische Spektrum erweiterte sich im Zuge jener Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte auch um nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen wie etwa Amnesty International.
In einer Zeit des verstärkten Strebens nach mehr Schutz für die Menschenrechte konnte oder wollte Europa nicht hintenanstehen. So wurde – unter dem Einfluß der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte – am 04.11.1950 die Europäische Menschenrechtskonvention in Rom unterzeichnet. Sie sollte nach Artikel 59,2 EMRK durch Ratifizierung von mindestens zehn Staaten am 03.09.1953 in Kraft treten.
Die Erklärung intendiert dabei „die universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten“, und ferner bekräftigt sie ihren tiefen Glauben an die Grundfreiheiten, „welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft demokratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Achtung der diesen Grund-freiheiten zugrunde liegenden Menschenrechte gesichert werden“.[1]
Die Europäische Menschenrechtskonvention hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte: Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die unterschriebenen Staaten dazu nötigt, den Beschlüssen ihrer Organe folge zu leisten, während die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – rechtlich gesehen – nur eine gutgemeinte Absichtserklärung darstellt.
Unterzeichnen kann die EMRK jeder Staat, der im Europarat vertreten ist und der der Abschaffung der Todesstrafe zugestimmt hat. Die Abschaffung der Todesstrafe, wie sie im 6. Zusatzprotokoll der EMRK festgelegt ist, ist das notwendige Kriterium für einen Beitritt zum Europarat und zur EMRK.
Wenn die Staaten erst das 6. Zusatzprotokoll anerkannt haben, unterliegen sie mit ihrem Beitritt zur EMRK automatisch der Gerichtsbarkeit ihrer Organe. Bis zum 01.11.1998 waren es im Wesentlichen drei Organe, die über die Einhaltung der Menschenrechte wachten und Sanktionen verhängten: Die Europäische Kommission für Menschenrechte (EKMR) hatte die Aufgabe, über die vorgebrachten Beschwerden zu beraten, sie zu untersuchen, alle relevanten Fakten für einen möglichen Prozess zusammenzutragen und gegebenenfalls die Beschwerde für zulässig zu erklären und sie an den Gerichtshof zu überweisen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) war dann für die eigentliche Urteilsfindung zuständig. Die Umsetzung der Urteile bzw. die Überwachung der Umsetzung der Urteile durch die Staaten wurde vom Ministerkomitee des Europarats übernommen.
Am 01.11.1998 trat das 11. Zusatzprotokoll (ZP) zur EMRK in Kraft, was die Zusammenlegung von Kommission und Gerichtshof zum alleinigen ständigen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Folge hatte. Motiviert wurde diese Vorgehensweise durch die aus Sicht der Beteiligten viel zu lange Dauer einer Urteilsfindung. So lag die Prozessdauer im Schnitt bis dato bei etwa sechs Jahren.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wurde in seiner ersten Form am 21.01.1959 gegründet und durch das 11. ZP 1998 reformiert. Seinen Sitz hat er in Straßburg. Zu seinen Aufgaben, als Organ der EMRK, gehört es, die Europäische Menschenrechtskonvention anzu-wenden und zu interpretieren.
Gegenwärtig besteht der Gerichtshof aus 41 Richtern. Die relativ hohe
[...]
[1] Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, in: Menschenrechte – Ihr internationaler Schutz, Sonderausgabe des Verlages C.H.Beck, 4. Aufl., dtv-Verlag, München 1998, S.258-270, hier: S.258.
- Quote paper
- Boris Queckbörner (Author), 2002, Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22004