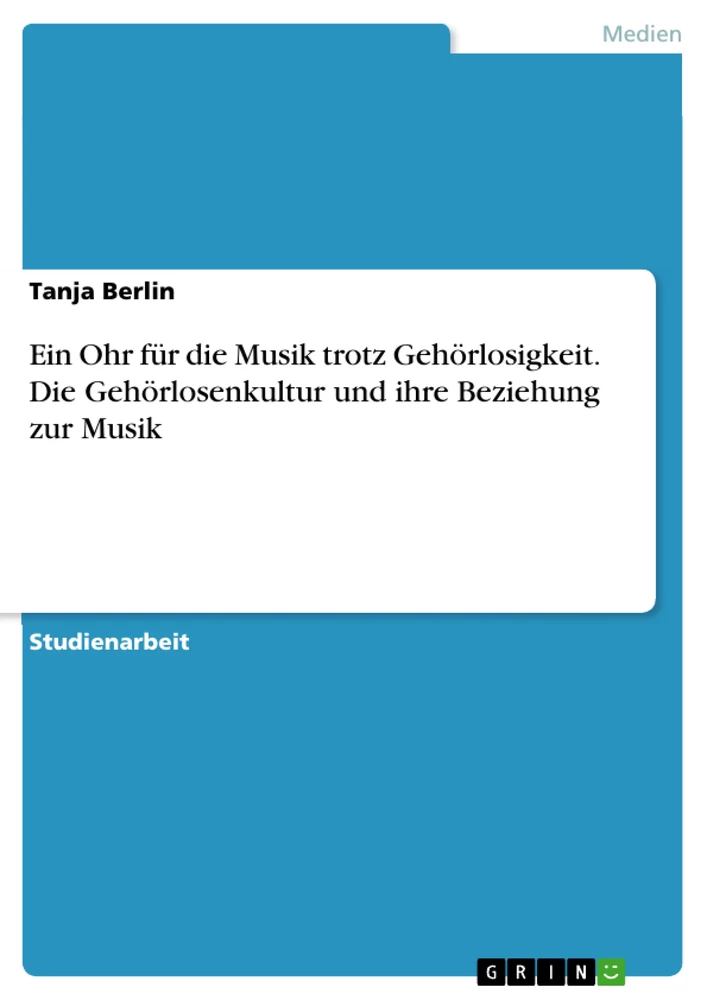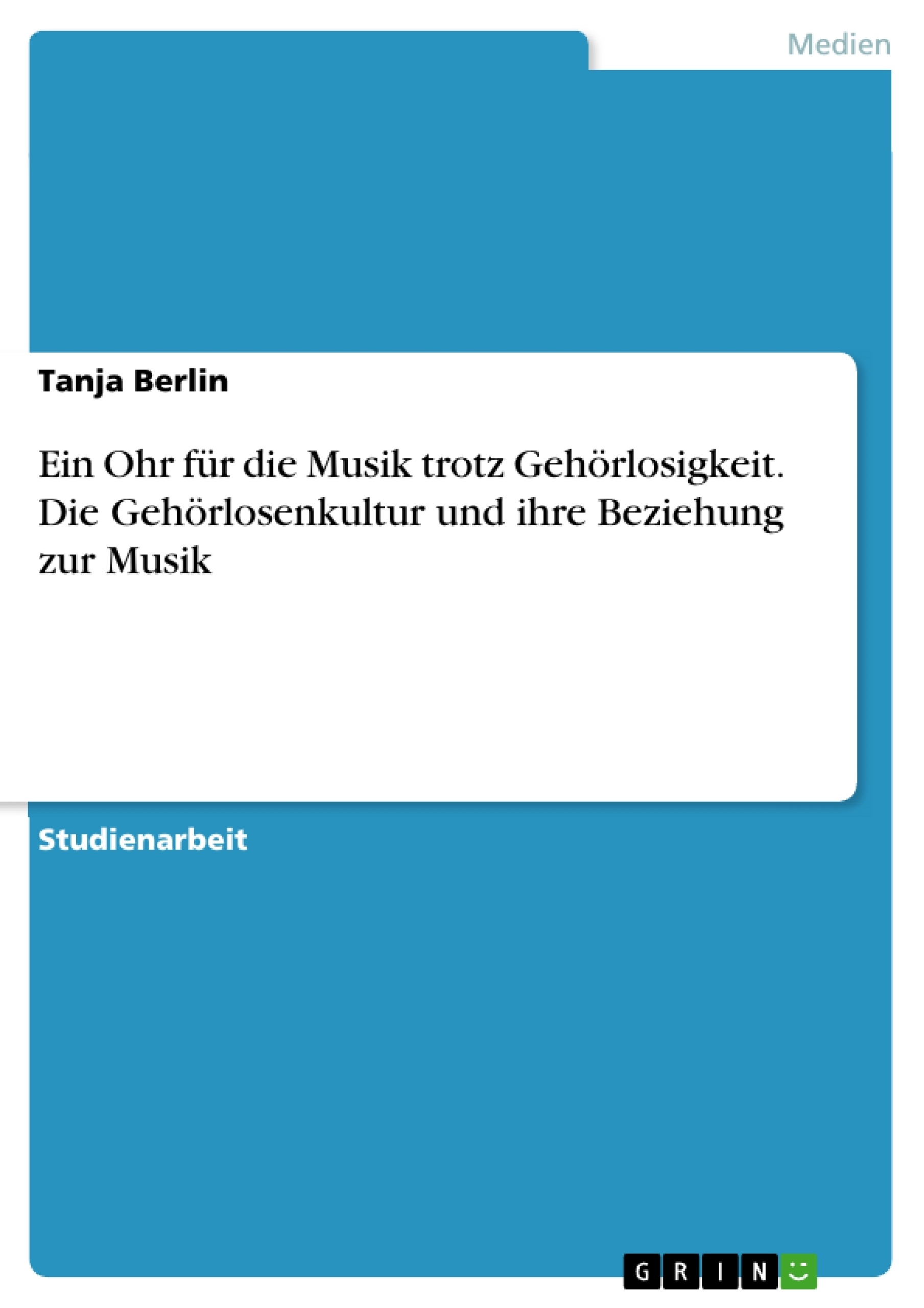Die Gehörlosenkultur und ihre Beziehung zur Musik stellt in Deutschland ein kaum beachtetes Gebiet dar. Musik und die Behinderung Gehörlosigkeit werden als unvereinbarer Gegensatz empfunden.
Die Frage die hierbei immer wieder in den Vordergrund tritt lautet: „Wie können hörbehinderte Menschen Musik wahrnehmen oder sogar selber musizieren?“.
Dieses Buch beinhaltet die Bereiche Aufbau des Ohres und den Hörvorgang, eine Definition von Gehörlosigkeit, verschiedene Ursachen für Hörbehinderungen, eine Erläuterung zum Begriff Musik, sowie ein Vergleich der hörenden und der gehörlosen Musikwahrnehmung.
Weiter werden die Ziele der rhythmisch musikalischen Förderung bei gehörlosen Menschen bearbeitet und anhand praktischer Beispiele das Musikerleben von gehörlosen Menschen dargestellt.
Ziel des Buches ist es, die vertraute hörende Musikwahrnehmung um den Bereich der fühlbaren Musik von gehörlosen Menschen zu erweitern, und somit das Wissen und Empfinden einer ganzheitlichen Musikwahrnehmung zu erreichen.
Weiterhin ist es das Ziel, der Gehörlosenkultur und ihrer Beziehung zur Musik mehr Beachtung zu schenken, damit dieses Thema in unserer Gesellschaft nicht mehr als unvereinbar empfunden wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Aufbau des Ohres und der Hörvorgang
- 3. Wo beginnt die Gehörlosigkeit?
- 3.1. International gültige Einteilung der Hörschäden
- 4. Ursachen für eine Hörbehinderung
- 4.1. Genetische Ursachen
- 4.2. Pränatale Ursachen
- 4.3. Perinatale Ursachen
- 4.4. Postnatale Ursachen
- 4.5. Umweltbedingte Ursachen
- 5. Kurze Erklärung zum Begriff Musik
- 6. Das Musikerleben von gehörlosen Menschen
- 6.1. Die Grundelemente der Musikwahrnehmung
- 6.2. Die hörende Musikwahrnehmung
- 6.3. Die gehörlose Musikwahrnehmung
- 6.4. Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- 7. Ziele der rhythmisch-musikalischen Förderung bei gehörlosen Menschen
- 8. Wie erleben gehörlose Menschen Musik? -praktische Beispiele
- 8.1. Gehörlose und Tanz
- 8.2. Gebärdenlieder als rhythmischer „Gesang“
- 8.3. Musikerleben mit Instrumenten
- 9. Abschlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die Musikwahrnehmung und das Musikerleben gehörloser Menschen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der musikalischen Förderung in diesem Kontext und widerlegt gängige Vorurteile.
- Der Aufbau des Ohres und der Hörvorgang
- Definition von Gehörlosigkeit und deren Ursachen
- Vergleich hörender und gehörloser Musikwahrnehmung
- Ziele rhythmisch-musikalischer Förderung bei Gehörlosigkeit
- Praktische Beispiele für das Musikerleben gehörloser Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema „Musik nicht hören, sondern fühlen – Ein Ohr für die Musik trotz Gehörlosigkeit“ ein und betont die oft übersehene Bedeutung von Musik im Leben gehörloser Menschen. Sie stellt die Schwerhörigkeit als eine differenzierte Form der Hörbehinderung dar, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die Gehörlosigkeit und die Herausforderungen, die mit der Wahrnehmung von Musik in diesem Kontext verbunden sind. Die Autorin beschreibt ihre eigenen Erfahrungen und die Motivation, dieses Thema zu untersuchen, basierend auf Begegnungen mit gehörlosen Bekannten und Hospitationen in Einrichtungen für Hörgeschädigte. Die Einleitung verdeutlicht das Ziel des Referats: die gängigen Missverständnisse über die musikalischen Fähigkeiten gehörloser Menschen aufzuklären und deren Musikerleben zu beleuchten.
2. Der Aufbau des Ohres und der Hörvorgang: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Aufbau des menschlichen Ohres, von der Ohrmuschel bis zum Hörnerv, und erklärt den Hörvorgang. Es erläutert den Weg der Schallwellen vom Außenohr über das Mittelohr mit seinen Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) bis zum Innenohr und der Cochlea. Die Abbildungen unterstützen das Verständnis des komplexen Prozesses der Schallverarbeitung. Dieses Kapitel legt die physiologische Grundlage für das Verständnis der Gehörlosigkeit und deren Auswirkungen auf die Musikwahrnehmung.
3. Wo beginnt die Gehörlosigkeit?: Dieses Kapitel definiert den Begriff Gehörlosigkeit und differenziert zwischen verschiedenen Arten und Graden von Hörschäden. Es wird auf die internationale Klassifizierung von Hörschäden eingegangen, um ein fundiertes Verständnis der Thematik zu schaffen. Diese präzise Definition ist essentiell für die nachfolgenden Kapitel, um die jeweiligen Auswirkungen auf das Musikerleben gehörloser Menschen zu beleuchten und Missverständnisse zu vermeiden.
4. Ursachen für eine Hörbehinderung: Hier werden die vielschichtigen Ursachen von Hörbehinderungen detailliert beschrieben. Die Aufteilung in genetische, pränatale, perinatale, postnatale und umweltbedingte Ursachen verdeutlicht die Komplexität des Themas. Die Erläuterung der verschiedenen Ursachen liefert ein umfassendes Bild der Faktoren, die zu Gehörlosigkeit führen können, und trägt zum Verständnis der Diversität der Betroffenen bei.
5. Kurze Erklärung zum Begriff Musik: Dieses Kapitel liefert eine kurze, aber prägnante Definition des Begriffs Musik, um eine gemeinsame Grundlage für die weiteren Ausführungen zu schaffen. Die Definition dient als Ankerpunkt für die folgenden Kapitel, in denen die Musikwahrnehmung und das Musikerleben von gehörlosen Menschen im Vergleich zur hörenden Musikwahrnehmung betrachtet werden.
6. Das Musikerleben von gehörlosen Menschen: Dieses Kapitel bildet den Kern des Referats. Es vergleicht die hörende und die gehörlose Musikwahrnehmung, indem es die Grundelemente der Musikwahrnehmung beleuchtet und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Die verschiedenen Aspekte der gehörlosen Musikwahrnehmung werden detailliert dargestellt und ermöglichen ein tieferes Verständnis der musikalischen Erfahrung gehörloser Menschen.
7. Ziele der rhythmisch-musikalischen Förderung bei gehörlosen Menschen: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele der musikalischen Förderung für gehörlose Menschen. Es betont die Bedeutung rhythmischer und taktiler Elemente und zeigt auf, wie Musik trotz Gehörlosigkeit erlebt und gestaltet werden kann. Die Darstellung der Ziele dient als Leitfaden für die praktische Anwendung der Erkenntnisse des Referats.
8. Wie erleben gehörlose Menschen Musik? - praktische Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert anhand praktischer Beispiele, wie gehörlose Menschen Musik erleben. Die Beispiele aus den Bereichen Tanz, Gebärdenlieder und Instrumentalmusik veranschaulichen die vielfältigen Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks und der Musikwahrnehmung bei Gehörlosigkeit. Die konkreten Beispiele machen die theoretischen Ausführungen anschaulicher und nachvollziehbarer.
Schlüsselwörter
Gehörlosigkeit, Musikwahrnehmung, Musikerleben, rhythmisch-musikalische Förderung, Hörschädigung, Musikwahrnehmung Gehörlose, taktile Wahrnehmung, Gebärdensprache, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen zu "Musik nicht hören, sondern fühlen – Ein Ohr für die Musik trotz Gehörlosigkeit"
Was ist das Thema des Referats?
Das Referat untersucht die Musikwahrnehmung und das Musikerleben gehörloser Menschen. Es beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der musikalischen Förderung und widerlegt gängige Vorurteile.
Welche Kapitel umfasst das Referat?
Das Referat gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Aufbau des Ohres und Hörvorgang, Definition von Gehörlosigkeit und deren Ursachen, Ursachen für Hörbehinderungen, kurze Erklärung des Begriffs Musik, Musikerleben gehörloser Menschen, Ziele rhythmisch-musikalischer Förderung, praktische Beispiele für das Musikerleben gehörloser Menschen und Abschlussgedanken. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung detailliert beschrieben.
Wie wird Gehörlosigkeit definiert und welche Ursachen werden genannt?
Das Referat definiert Gehörlosigkeit und differenziert zwischen verschiedenen Arten und Graden von Hörschäden anhand der internationalen Klassifizierung. Es werden genetische, pränatale, perinatale, postnatale und umweltbedingte Ursachen für Hörbehinderungen detailliert erläutert.
Wie unterscheidet sich die Musikwahrnehmung bei hörenden und gehörlosen Menschen?
Das Referat vergleicht die hörende und gehörlose Musikwahrnehmung, indem es die Grundelemente der Musikwahrnehmung beleuchtet und Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Die gehörlose Musikwahrnehmung wird detailliert dargestellt, um ein tieferes Verständnis der musikalischen Erfahrung gehörloser Menschen zu ermöglichen.
Welche Ziele verfolgt die rhythmisch-musikalische Förderung bei gehörlosen Menschen?
Das Referat beschreibt die Ziele der musikalischen Förderung für gehörlose Menschen, wobei die Bedeutung rhythmischer und taktiler Elemente hervorgehoben wird. Es zeigt auf, wie Musik trotz Gehörlosigkeit erlebt und gestaltet werden kann.
Welche praktischen Beispiele werden für das Musikerleben gehörloser Menschen genannt?
Das Referat präsentiert praktische Beispiele aus den Bereichen Tanz, Gebärdenlieder und Instrumentalmusik, um die vielfältigen Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks und der Musikwahrnehmung bei Gehörlosigkeit zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Referat?
Schlüsselwörter sind: Gehörlosigkeit, Musikwahrnehmung, Musikerleben, rhythmisch-musikalische Förderung, Hörschädigung, Musikwahrnehmung Gehörlose, taktile Wahrnehmung, Gebärdensprache, Inklusion.
Welche physiologischen Grundlagen werden im Referat behandelt?
Das Referat beschreibt detailliert den Aufbau des menschlichen Ohres und den Hörvorgang, von der Ohrmuschel bis zum Hörnerv, um die physiologische Grundlage für das Verständnis der Gehörlosigkeit und deren Auswirkungen auf die Musikwahrnehmung zu legen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin/der Autor?
Das Referat zielt darauf ab, die gängigen Missverständnisse über die musikalischen Fähigkeiten gehörloser Menschen aufzuklären und deren Musikerleben zu beleuchten. Es betont die oft übersehene Bedeutung von Musik im Leben gehörloser Menschen.
- Quote paper
- Tanja Berlin (Author), 2003, Ein Ohr für die Musik trotz Gehörlosigkeit. Die Gehörlosenkultur und ihre Beziehung zur Musik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21942