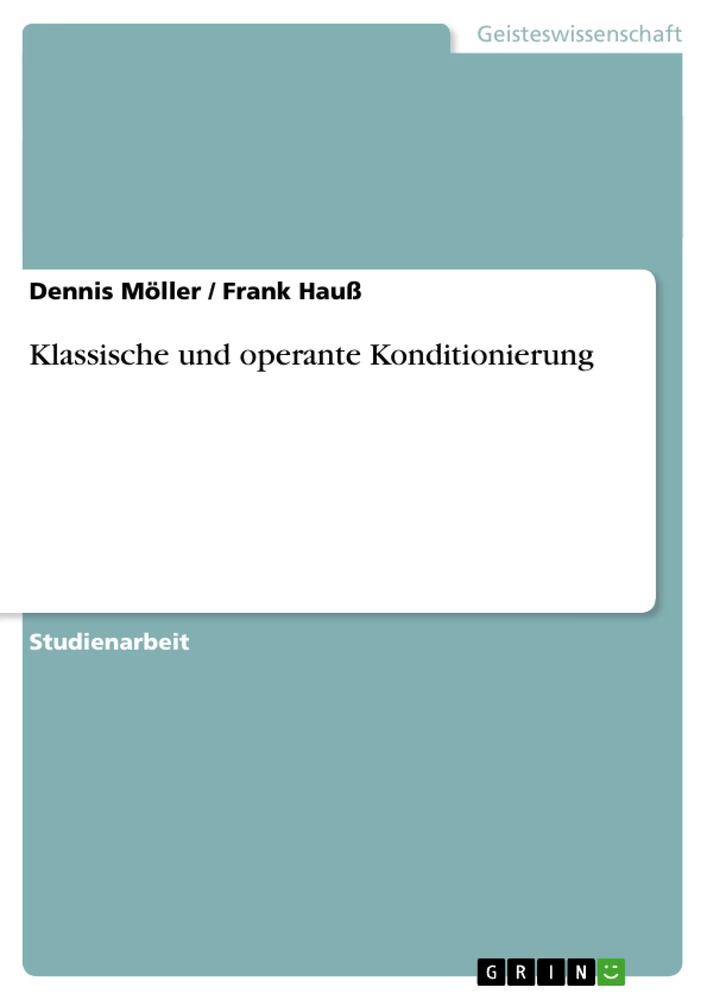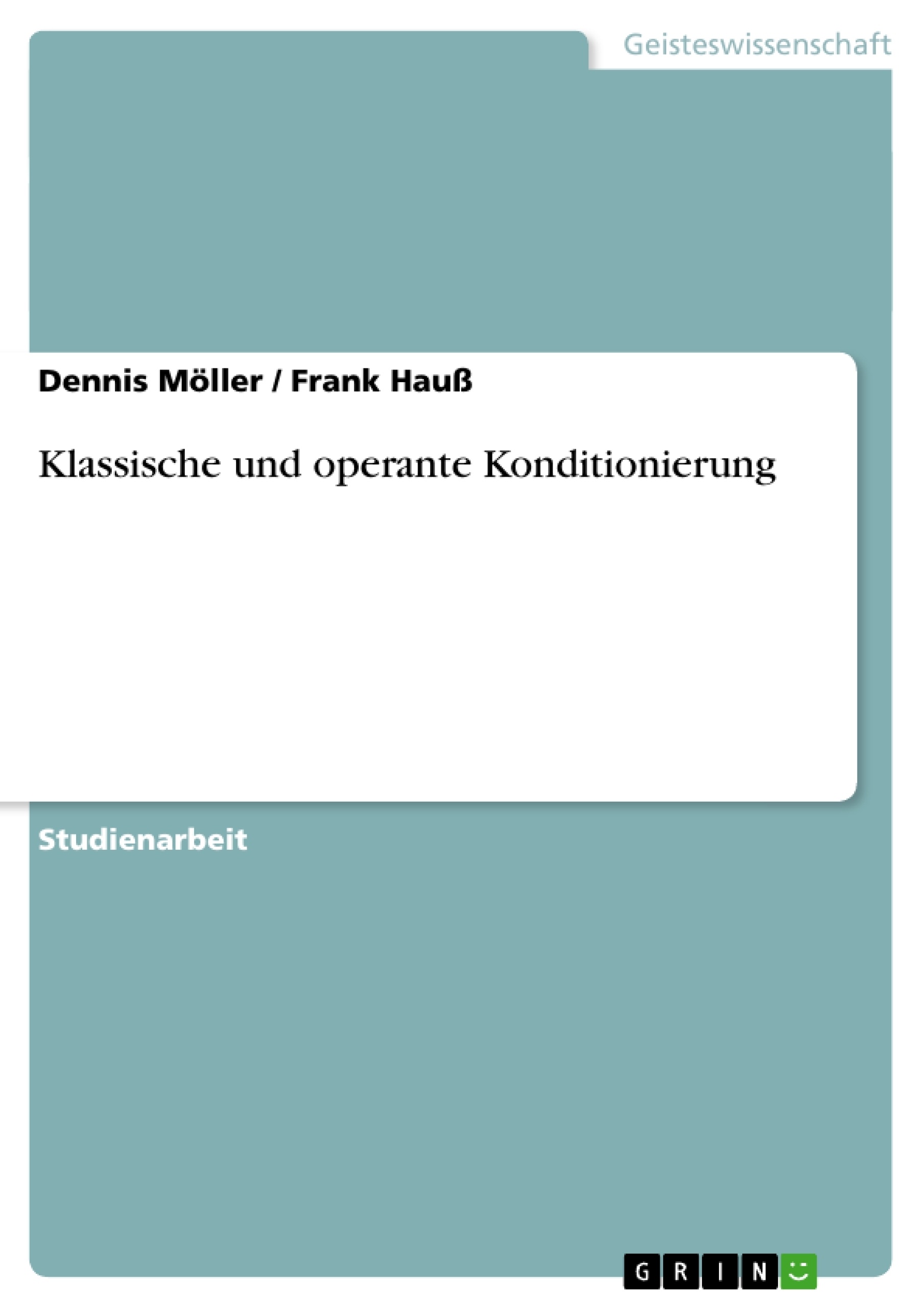Lange Zeit war die internationale Psychologie geprägt durch die Lerntheorien.
Lerntheorien sind für die Sozialpsychologie von solch hervorgehobener Bedeutung, da der
Mensch nur mit wenigen angeborenen Verhaltensweisen ausgestattet ist. Die meisten
notwendigen Teilprozesse und Voraussetzungen sozialer Interaktion müssen erst durch
Erfahrung erworben, also gelernt werden.1
Der Erfolg der Darwinschen Theorie der Evolution im zweiten Teil des 19. Jahrhunderts
ebnete den Weg für ein neues Verständnis des Lernens. Die Evolutionstheorie stellte den
Menschen in dieselbe biologische Entwicklungskette wie andere Lebewesen. Das
tierische Lernen wurde als Model des menschlichen Lernens betrachtet.
Unter diesem Einfluss sind die Prinzipien des Konditionierens zu sehen.2
Im Punkt 2 dieser Hausarbeit befasst sich Dennis Möller mit der Klassischen
Konditionierung, nach der ein Großteil des komplexen Verhaltensrepertoires, welches alle
Tiere und den Menschen kennzeichnet, in einfacher Reiz-Reaktions-Verbindungen
verstanden werden kann.
In dem von Frank Hauß erarbeiteten Punkt 3 dieser Hausarbeit, der sich mit dem
Operanten Konditionieren beschäftigt, wird diese Forschungsrichtung weiterverfolgt. Es
wird aufgezeigt, wie sich bei dieser Art des “instrumentellen” Lernens die
Umweltbedingungen des Probanten durch das Verhalten ändern. Der Punkt 4 der Hausarbeit wurde von Dennis Möller und Frank Hauß gemeinsam
erarbeitet. Hier wird aufgezeigt, in welchen (auch wechselseitigen) Beziehungen diese
beiden Konditionierungsarten stehen.
Die Einleitung und das Fazit der vorliegenden Hausarbeit wurden ebenfalls von ihnen
gemeinsam (nach zum Teil sehr heftigen, aber doch immer konstruktiven und sachlichen
Diskussionen) erarbeitet.
1 Vgl.: Herkner, Werner; Lehrbuch Sozialpsychologie; 2. Auflage; 1991; Verlag Hans Huber Bern; S.23;
(Im folgenden zitiert als: Herkner)
2 Vgl.: Krech, David; Crutchfield, Richard S.; Livison, Norman; Wilson jr., William A; Parducci, Allan;
Grundlagen der Psychologie; Psychologie Verlags Union Weinheim; 1992; Band 3; S. 7 (Im
folgenden zitiert als: Krech)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Themeneingrenzung
- 2. Klassische Konditionierung
- 2.1 Der Pawlowsche Hund
- 2.2 Das Vokabular der klassischen Konditionierung
- 2.3 Konditionierung zweiter Ordnung
- 2.4 Positive und negative Auswirkungen klassischer Konditionierung
- 2.5 Die zeitliche Anordnung des Konditionierens
- 3. Operante Konditionierung
- 3.1 Verstärkung
- 3.2 Verhaltensausformung und Kettenbildung
- 3.3 Verstärkungspläne
- 3.4 Motivation und Leistung
- 3.5 Bestrafung
- 3.6 Löschung
- 4. Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Beziehungen zwischen klassischem und operantem Konditionieren
- 5. Fazit und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, klassische und operante Konditionierung als zentrale Lerntheorien vorzustellen, zu vergleichen und ihre Beziehung zueinander aufzuzeigen. Die Arbeit basiert auf dem Verständnis, dass ein Großteil menschlichen Verhaltens durch Lernprozesse erworben wird.
- Klassische Konditionierung: Reiz-Reaktions-Verbindungen und deren Entstehung.
- Operante Konditionierung: Verhaltenskonsequenzen und deren Einfluss auf zukünftiges Verhalten.
- Vergleich beider Konditionierungsformen: Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Interaktionen.
- Bedeutung der Lerntheorien für die Sozialpsychologie.
- Anwendung der Konditionierungsprinzipien in verschiedenen Kontexten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Themeneingrenzung: Die Einleitung führt in die Bedeutung von Lerntheorien für die Sozialpsychologie ein und begründet die Wahl der Themen klassische und operante Konditionierung. Sie betont, dass der Mensch nur wenige angeborene Verhaltensweisen besitzt und die meisten Verhaltensweisen durch Lernen erworben werden. Der Einfluss der darwinistischen Evolutionstheorie auf das Verständnis von Lernen und die Betrachtung tierischen Lernens als Modell für menschliches Lernen wird hervorgehoben. Die Arbeit teilt die Aufgaben zwischen den Autoren auf und beschreibt den Aufbau der Hausarbeit.
2. Klassische Konditionierung: Dieses Kapitel beschreibt die klassische Konditionierung als Lernprozess, bei dem eine Assoziation zwischen einem neutralen und einem unbedingten Reiz gebildet wird. Der ehemals neutrale Reiz löst nach der Konditionierung eine ähnliche Reaktion aus wie der unbedingte Reiz. Der Pawlowsche Hund wird als klassisches Beispiel angeführt, und die Bedeutung von Wiederholungen für die Stärke der Assoziation wird erklärt. Das Kapitel beleuchtet auch die unbewussten Einflüsse klassischer Konditionierung auf Einstellungen, wie im Razran-Experiment (1940) gezeigt wird, bei dem politische Slogans durch Kopplung mit angenehmen oder unangenehmen Reizen unterschiedlich bewertet wurden.
3. Operante Konditionierung: Dieses Kapitel widmet sich der operanten Konditionierung, bei der Verhaltenskonsequenzen den Lernprozess beeinflussen. Es werden Verstärkung, Verhaltensausformung, Verstärkungspläne, Motivation, Bestrafung und Löschung als zentrale Konzepte erläutert. Der Fokus liegt darauf, wie sich Umweltbedingungen durch das Verhalten des Individuums verändern und wie dies zukünftiges Verhalten beeinflusst. Das Kapitel untersucht die verschiedenen Arten von Verstärkung und Bestrafung und ihre Auswirkungen auf das Verhalten.
4. Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Beziehungen zwischen klassischem und operantem Konditionieren: Dieses Kapitel analysiert die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und wechselseitigen Beziehungen zwischen klassischer und operanter Konditionierung. Es wird die komplexe Interaktion beider Lernformen im alltäglichen Verhalten untersucht und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen im Hinblick auf das Erklären komplexer Verhaltensmuster diskutiert. Die Kapitel beleuchtet mögliche Überschneidungen und Synergien zwischen den beiden Konditionierungsformen.
Schlüsselwörter
Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, Reiz-Reaktions-Verbindung, Lernen, Verhalten, Verstärkung, Bestrafung, Lerntheorien, Sozialpsychologie, Pawlow, Verhaltensausformung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Klassische und Operante Konditionierung
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit behandelt die klassischen und operanten Konditionierungstheorien. Sie vergleicht beide Lerntheorien, zeigt ihre Beziehungen zueinander auf und beleuchtet ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitel zu klassischer und operanter Konditionierung, einen Vergleich beider, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis (implizit). Zusätzlich beinhaltet sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, sowie Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Lerntheorien werden behandelt?
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die klassische und die operante Konditionierung. Die klassische Konditionierung wird anhand des Pawlowschen Hundes und des Razran-Experiments erläutert. Die operante Konditionierung wird mit den Konzepten Verstärkung, Bestrafung, Verhaltensausformung und Löschung erklärt.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel ist die Vorstellung, der Vergleich und die Darstellung der Beziehung zwischen klassischer und operanter Konditionierung als zentrale Lerntheorien. Es soll aufgezeigt werden, wie ein Großteil menschlichen Verhaltens durch Lernprozesse erworben wird und welche Rolle diese Lerntheorien in der Sozialpsychologie spielen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf Reiz-Reaktions-Verbindungen (klassische Konditionierung), Verhaltenskonsequenzen und deren Einfluss (operante Konditionierung), dem Vergleich beider Formen, ihrer Bedeutung für die Sozialpsychologie und der Anwendung der Konditionierungsprinzipien in verschiedenen Kontexten.
Wie werden klassische und operante Konditionierung verglichen?
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Vergleich der Gemeinsamkeiten, Unterschiede und der wechselseitigen Beziehungen zwischen klassischer und operanter Konditionierung. Es werden mögliche Überschneidungen und Synergien beider Lernformen untersucht und ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf das Erklären komplexer Verhaltensmuster diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Klassische Konditionierung, Operante Konditionierung, Reiz-Reaktions-Verbindung, Lernen, Verhalten, Verstärkung, Bestrafung, Lerntheorien, Sozialpsychologie, Pawlow, Verhaltensausformung.
Was wird in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Kapitel behandeln jeweils einen Aspekt der Konditionierungstheorien: Die Einleitung beschreibt die Relevanz von Lerntheorien und den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel zur klassischen Konditionierung erklärt den Lernprozess durch Reizassoziationen (am Beispiel des Pawlowschen Hundes). Das Kapitel zur operanten Konditionierung erläutert den Einfluss von Verhaltenskonsequenzen. Das letzte Kapitel vergleicht beide Konditionierungsformen.
Wie wird der Pawlowsche Hund in die Arbeit eingebunden?
Der Pawlowsche Hund dient als klassisches Beispiel für die klassische Konditionierung, um den Lernprozess durch Reizassoziationen zu veranschaulichen.
Welche Rolle spielt das Razran-Experiment?
Das Razran-Experiment (1940) veranschaulicht die unbewussten Einflüsse der klassischen Konditionierung auf Einstellungen, indem es zeigt, wie politische Slogans durch Kopplung mit angenehmen oder unangenehmen Reizen unterschiedlich bewertet werden.
- Citar trabajo
- Dennis Möller (Autor), Frank Hauß (Autor), 2003, Klassische und operante Konditionierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21935