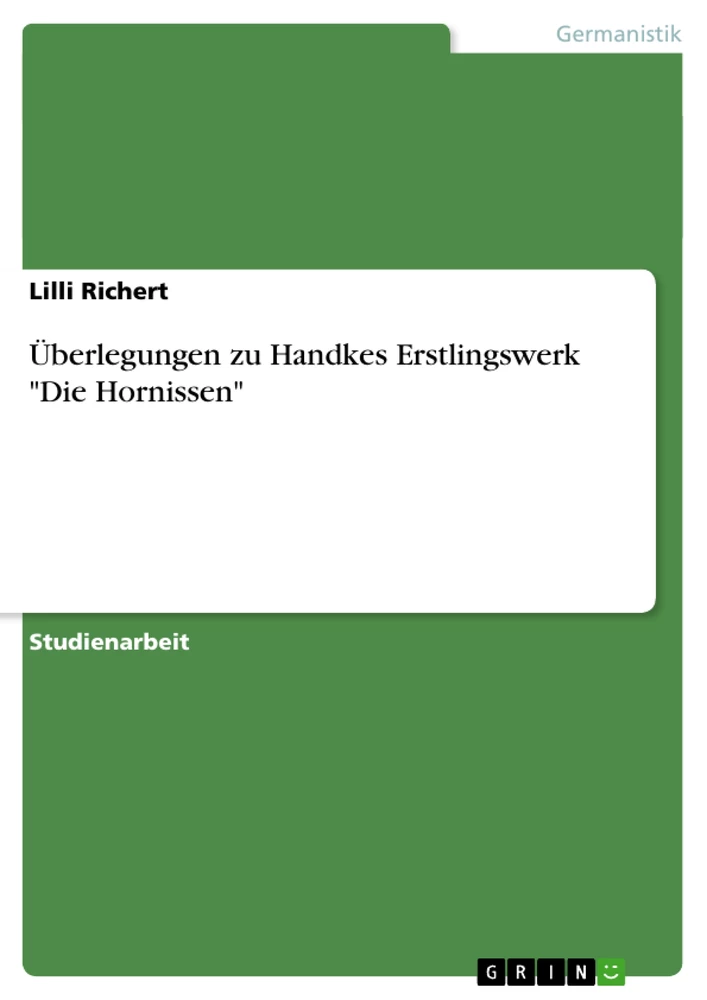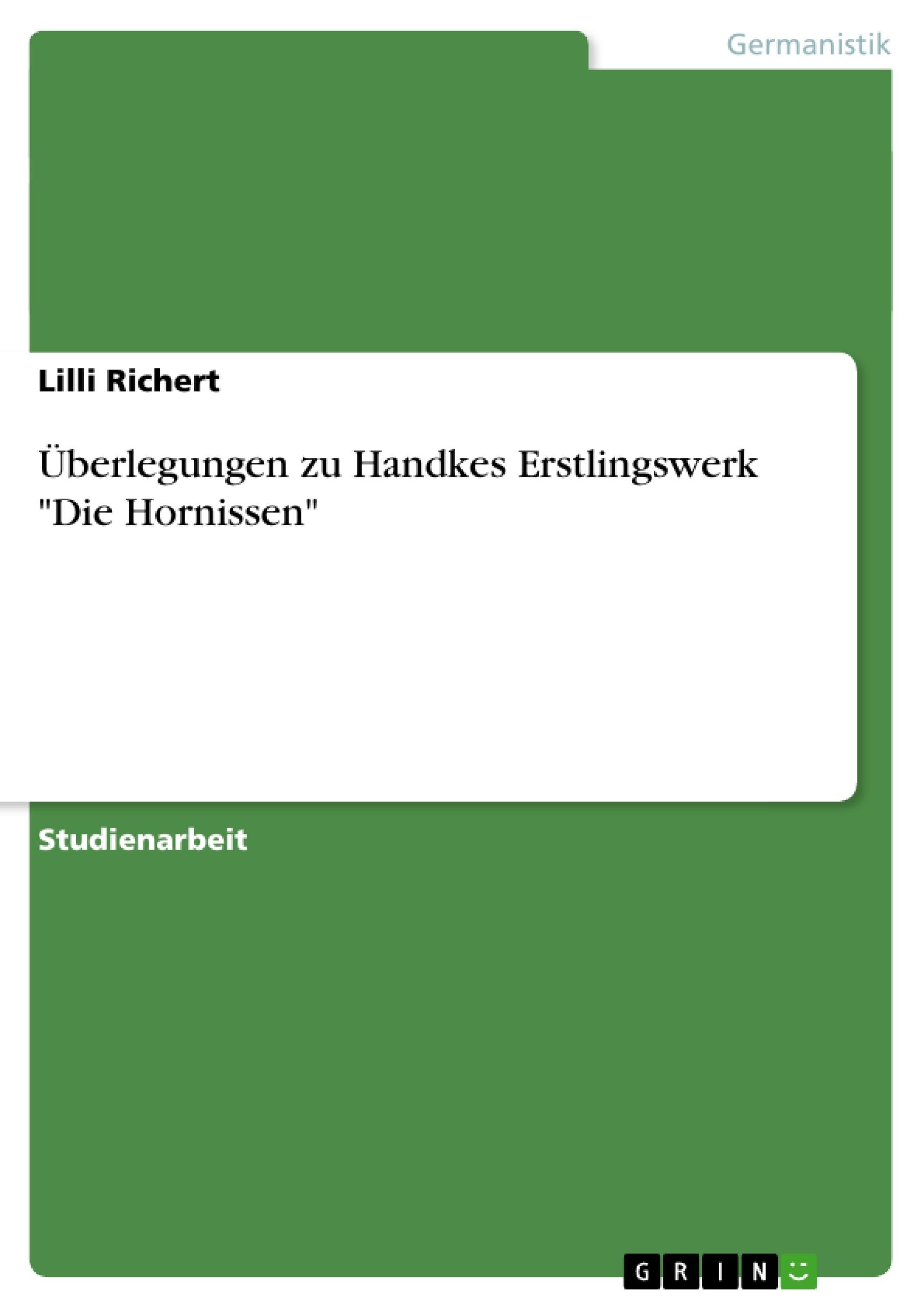Der 1966 herausgegebene Roman Die Hornissen von Peter Handke, fand in der literarischen Öffentlichkeit zunächst eine eher mäßige Beachtung. Innerhalb von drei Jahren wuchs Handkes Bekanntheitsgrad so schnell, dass Kritiker fragten „wie ein Schriftsteller in dieser vergleichsweise kurzen Zeit eine derartige Popularität erlangen konnten, wie sie Peter Handke Ende der sechziger Jahre besaß“. Der Erfolg wurde dabei hauptsächlich seinem Aussehen und Auftreten zugeschrieben. Als zorniger junger „Literatur-Beatle“ ging er in die literarische Kritik ein. Sein zeitgemäßes Image und seine Person standen im Mittelpunkt. Wenn jedoch von Handke als jungen Schriftsteller gesprochen wird, so ist sein erster Roman von außerordentlicher Bedeutung. Handkes Idee lag in einer sprachkritischen Literatur, die auf den verzerrenden Charakter der Sprache hinweisen soll. Er wollte „die tückische Sprache selber durchschauen und, wenn man sie durchschaut hat zeigen, wie viele Dinge mit der Sprache gedreht werden können.“ Sein erster Roman ist ein gutes Beispiel für die Radikalität, mit der er diese Idee umsetzte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Biographisches
- „Die Hornissen“
- Sprachliche Beobachtungen
- Inhaltliche Gestaltung
- Der Roman als Erinnerung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit widmet sich einer detaillierten Analyse von Peter Handkes Erstlingsroman „Die Hornissen“, der 1966 veröffentlicht wurde. Dabei werden die sprachlichen Besonderheiten des Romans im Kontext von Handkes literarischem Ansatz und seiner frühen Kritik an der „Gruppe 47“ beleuchtet.
- Handkes Kritik an der Sprache und ihre Rolle in der Literatur
- Die sprachliche Gestaltung von „Die Hornissen“ und ihre Auswirkungen auf die Interpretation
- Die Bedeutung der Erinnerung und des autobiographischen Elements in Handkes Werk
- Die Rezeption von „Die Hornissen“ in der literarischen Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik des Romans „Die Hornissen“ ein und skizziert die Rezeption des Werks in der literarischen Öffentlichkeit. Der Fokus liegt auf Handkes frühen Erfolgen und seinem image als „Literatur-Beatle“ sowie seiner Kritik an der Sprache und ihrer Fähigkeit, die Wirklichkeit zu verzerren.
Biographisches
Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Abriss von Peter Handkes Leben und seinen frühen Jahren. Er beleuchtet die Bedeutung von Handkes Kindheitserfahrungen und den Einfluss der katholischen Erziehung auf seine Entwicklung als Autor.
„Die Hornissen“
Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung von „Die Hornissen“. Es beleuchtet Handkes Verzicht auf konventionelle Erzählstrukturen und die fragmentarische Struktur des Romans. Die Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten geht auf Handkes innovative Nutzung der Sprache und seine Kritik an der „Beschreibungsimpotenz“ ein.
Der Roman als Erinnerung
Dieser Abschnitt analysiert „Die Hornissen“ als Erinnerungsroman und beleuchtet die autobiographischen Elemente, die in die literarische Fiktion einfließen. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Handkes eigenem Leben und der Welt des Romans.
Schlüsselwörter
Peter Handke, „Die Hornissen“, Sprache, Erinnerung, Autobiographie, Literaturkritik, „Gruppe 47“, Beschreibungsimpotenz, sprachliche Gestaltung, fragmentarische Struktur, Roman, Erzählung, Kritik an der Sprache.
- Quote paper
- Lilli Richert (Author), 2004, Überlegungen zu Handkes Erstlingswerk "Die Hornissen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21886