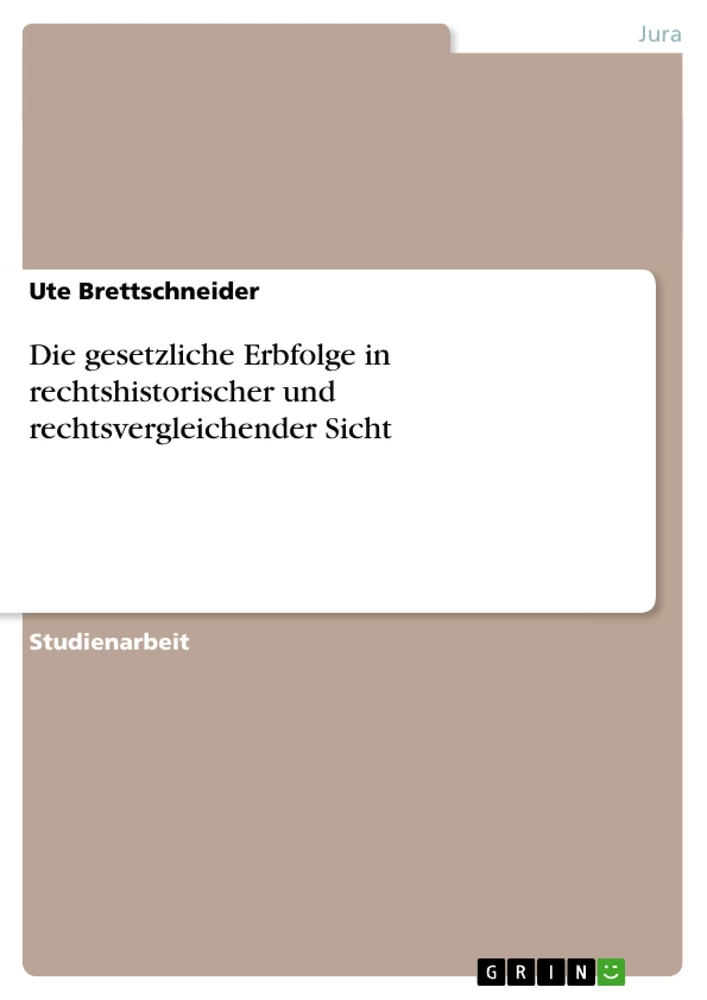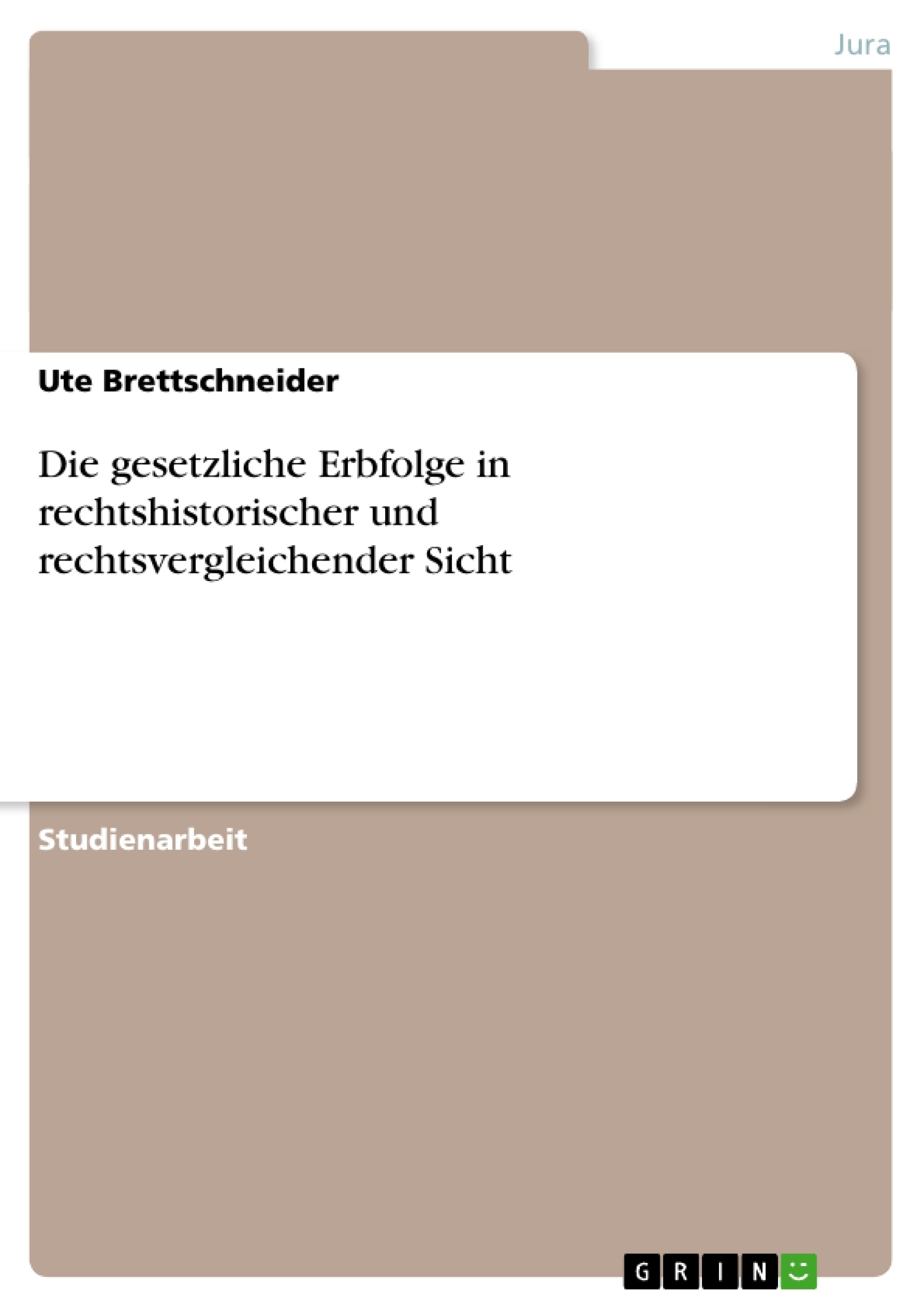Vermögen eines Verstorbenen einem neuen Rechtsträger zuzuweisen, definiert werden1. Dabei gibt es verschiedene Arten
dieser Vermögenszuweisung. Von Interesse soll hier diejenige an die gesetzlichen Erben sein.
1. RECHTSHISTORISCHER TEIL
Voraussetzung für diese Arbeit ist die Kenntnis der gesetzlichen Erbfolge nach dem heutigen BGB. Daher wird diese im
folgenden grob aufgezeigt, um anschließend deren historische Entwicklung verdeutlichen zu können.
1.1. DIE GESETZLICHE ERBFOLGE NACH DEM HEUTE GELTENDEN RECHT
Die Erbfolge wird im fünften Buch des BGB, im ersten Abschnitt, §§ 1922 bis 19412, behandelt. Sie beruht auf der
Verwandtschaft, der Ehe und der Zugehörigkeit zum Staat. Dabei stehen diese Gruppen nicht gleichberechtigt nebeneinander.
An erster Stelle sind die Verwandten berufen (§ 1589 i.V.m. §§ 1924 ff.) und neben ihnen der überlebende Ehegatte (§§ 1931
ff.). Die Verwandten sind dabei in Ordnungen eingeteilt, deren Rangfolge so gestaltet ist, daß ein Verwandter dann nicht zur
Erbfolge berufen ist, solange ein Verwandter der vorhergehen Ordnung vorhanden ist, § 1930. Innerhalb der ersten drei
Ordnungen gilt die Erbfolge nach Stämmen unter der Beachtung des Repräsentations- und Eintrittsprinzips.
Unter einem Stamm versteht das Gesetz die Abkömmlinge, die von ein und demselben Kind des Erblassers abstammen, §
1924 III.
Als Repräsentationsprinzip erachtet man die Vertretung eines gesamten Stammes durch den mit dem Erblasser am nächsten
verwandten Abkömmling3, § 1924 II.
Gemäß § 1924 III tritt innerhalb eines Stammes an die Stelle eines weggefallenen Abkömmlings die durch diesen mit dem
Erblasser verwandten Abkömmlinge: Eintrittsprinzip4.
Gemäß § 1924 I bilden die Abkömmlinge des Erblassers die erste Ordnung.
Die Eltern des Erblassers und deren Abkömmlinge bilden die zweite Ordnung, § 1925 I. Leben beide Eltern noch, so schließen
sie ihre Abkömmlinge aus und erben zu gleichen Teilen, § 1925 II. [...]
1 Mayer-Maly, S.160; vergleiche auch Mertens, S.23.
2 §§ ohne nähere Kennzeichnung sind solche des BGB.
3 Firsching/Graf, Rn 1.16.
4 In älteren Quellen werden Eintritts- und Repräsentationsprinzip oft gleichgestellt und kein Unterschied gesehen. Daher
umfaßt im folgenden das Repräsenationsrecht auch das Eintrittsrecht. Ältere Quellen vergleiche Hübner und Scheurer.
Inhaltsverzeichnis
- Rechtshistorischer Teil
- Die gesetzliche Erbfolge nach dem heute geltenden Recht
- Das „Erbrecht“ der Frühzeit
- Das römische Erbrecht
- Das Agnationsprinzip der Zwölf Tafeln
- Die einzelnen Klassen der gesetzlichen Erbfolge
- Das gesetzliche Erbrecht der klassischen Zeit
- Die einzelnen Klassen der gesetzlichen Erbfolge
- Das nachklassische gesetzliche Erbrecht
- Die Erbfolge
- Das germanische Recht
- Die Herausbildung der Erbfolge
- Vermengung germanischer und römischer Gedanken durch die Rezeption des römischen Rechts
- Die Schaffung des BGB
- Änderungen der Erbfolge
- Die gesetzliche Erbfolge der DDR
- Rechtsvergleichender Teil
- Das hebräische Recht
- Die gesetzliche Erbfolge Frankreichs
- Die dänische Erbfolge
- Das gesetzliche Erbrecht in Italien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die gesetzliche Erbfolge aus rechtshistorischer und rechtsvergleichender Perspektive. Ziel ist es, die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge im Laufe der Geschichte nachzuvollziehen und sie im Kontext verschiedener Rechtssysteme zu betrachten.
- Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge im römischen Recht
- Einfluss des germanischen Rechts auf die Erbfolge
- Vergleich der gesetzlichen Erbfolge in verschiedenen Rechtssystemen (hebräisch, französisch, dänisch, italienisch)
- Die gesetzliche Erbfolge im BGB und ihre historische Grundlage
- Die Erbfolge in der Frühzeit und der Übergang zur individuellen Eigentumsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Rechtshistorischer Teil: Dieser Teil der Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge in verschiedenen historischen Kontexten. Beginnend mit der gesetzlichen Erbfolge im heutigen BGB wird deren historische Entwicklung detailliert nachgezeichnet. Es werden die unterschiedlichen Systeme der Erbfolge in der Frühzeit, im römischen Recht (mit den Phasen des Agnationsprinzips, der klassischen Zeit und der nachklassischen Periode) und im germanischen Recht beleuchtet. Der Einfluss der Rezeption des römischen Rechts und die Gestaltung der Erbfolge im BGB werden ebenso behandelt wie die Entwicklungen in der DDR. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen in den Prinzipien und der Struktur der gesetzlichen Erbfolge über die Jahrhunderte hinweg, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und rechtlicher Entwicklungen.
Das „Erbrecht“ der Frühzeit: Dieses Kapitel beschreibt die fehlende Bedeutung eines formalen Erbrechts in der Frühzeit aufgrund der gemeinschaftlichen Wirtschaftsordnung innerhalb von Sippenverbänden. Das Vermögen der Sippe wurde kollektiv genutzt, ein individuelles Erbrecht existierte nicht. Persönliche Habe diente oft als Grabbeigabe und unterlag nicht den Regeln einer Erbfolge. Erst mit der Entwicklung individueller Eigentumsverhältnisse und der Auflösung der Großfamilie in Kleinfamilien gewann das Erbrecht an Bedeutung.
Das römische Erbrecht: Das Kapitel behandelt die Entwicklung des römischen Erbrechts, beginnend mit dem Agnationsprinzip der Zwölf Tafeln, welches die intakte Großfamilie und den Sippenverband als Vermögensträger voraussetzte. Es analysiert die gesetzliche Erbfolge in der klassischen und nachklassischen Zeit und hebt die Bedeutung des Testaments als primäres Mittel der Vermögensübertragung hervor. Die Kapitel diskutieren die Herausforderungen der Gesetzgebung im Spannungsfeld zwischen Patriziern und Plebejern und erläutert, wie die Rechtsprechung die Erbfolge gestaltete.
Das germanische Recht: Hier wird die Herausbildung der Erbfolge im germanischen Recht untersucht. Es wird die Entwicklung der Prinzipien und Strukturen der Erbfolge in diesem Kontext analysiert und im Verhältnis zum römischen Recht betrachtet. Die Zusammenfassung betont die unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen und deren Einfluss auf die Rechtsordnung. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit anderen Rechtsordnungen, um die Entwicklung der Erbfolge zu verstehen.
Rechtsvergleichender Teil: Dieser Teil vergleicht die gesetzliche Erbfolge in verschiedenen Rechtssystemen (hebräisch, französisch, dänisch, italienisch). Die Zusammenfassung beschreibt die unterschiede in den Regelungen und Prinzipien der Erbfolge und analysiert die zugrundeliegenden gesellschaftlichen und rechtlichen Faktoren. Der Vergleich verdeutlicht die Vielfalt der Ansätze zur Regelung der gesetzlichen Erbfolge in verschiedenen Kulturen und Rechtsordnungen.
Schlüsselwörter
Gesetzliche Erbfolge, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Römisches Recht, Germanisches Recht, BGB, Testament, Intestaterbfolge, Agnationsprinzip, Erbrecht, Verwandtschaft, Ehegatte, Staat, Erbe, Erbenstellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Gesetzliche Erbfolge - Rechtshistorischer und Rechtsvergleichender Überblick
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die gesetzliche Erbfolge aus rechtshistorischer und rechtsvergleichender Perspektive. Ziel ist es, die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge im Laufe der Geschichte nachzuvollziehen und sie im Kontext verschiedener Rechtssysteme zu betrachten.
Welche historischen Epochen und Rechtssysteme werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge von der Frühzeit über das römische Recht (inkl. Agnationsprinzip, klassischer und nachklassischer Zeit), das germanische Recht, die Rezeption des römischen Rechts, die Entstehung des BGB und die gesetzliche Erbfolge in der DDR. Im rechtsvergleichenden Teil werden das hebräische Recht, französisches, dänisches und italienisches Recht betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in einen rechtshistorischen und einen rechtsvergleichenden Teil. Der rechtshistorische Teil zeichnet die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge detailliert nach, beginnend mit dem heutigen BGB und zurückgehend in die Frühzeit. Der rechtsvergleichende Teil analysiert und vergleicht die gesetzlichen Erbfolgeregelungen in verschiedenen Rechtssystemen.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der gesetzlichen Erbfolge im römischen Recht, den Einfluss des germanischen Rechts, den Vergleich der gesetzlichen Erbfolge in verschiedenen Rechtssystemen, die gesetzliche Erbfolge im BGB und ihre historische Grundlage sowie die Erbfolge in der Frühzeit und den Übergang zur individuellen Eigentumsordnung.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Der rechtshistorische Teil umfasst Kapitel zur gesetzlichen Erbfolge nach heutigem Recht, zum "Erbrecht" der Frühzeit, zum römischen Erbrecht (Agnationsprinzip, klassische und nachklassische Zeit), zum germanischen Recht, zur Vermengung germanischer und römischer Gedanken, zur Schaffung des BGB, zu Änderungen der Erbfolge und zur gesetzlichen Erbfolge der DDR. Der rechtsvergleichende Teil behandelt die gesetzliche Erbfolge in Israel, Frankreich, Dänemark und Italien.
Was wird im Kapitel über das „Erbrecht“ der Frühzeit behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt das Fehlen eines formalen Erbrechts in der Frühzeit aufgrund gemeinschaftlicher Wirtschaftsordnung innerhalb von Sippenverbänden. Erst mit der Entwicklung individueller Eigentumsverhältnisse gewann das Erbrecht an Bedeutung.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zum römischen Erbrecht?
Das Kapitel analysiert die Entwicklung des römischen Erbrechts vom Agnationsprinzip der Zwölf Tafeln über die klassische und nachklassische Zeit. Es beleuchtet die Herausforderungen der Gesetzgebung und die Rolle des Testaments.
Was ist der Fokus des Kapitels zum germanischen Recht?
Hier wird die Herausbildung der Erbfolge im germanischen Recht untersucht und im Verhältnis zum römischen Recht betrachtet. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen und deren Einfluss auf die Rechtsordnung.
Was wird im rechtsvergleichenden Teil untersucht?
Dieser Teil vergleicht die gesetzlichen Erbfolgeregelungen in verschiedenen Rechtssystemen (hebräisch, französisch, dänisch, italienisch) und analysiert die zugrundeliegenden gesellschaftlichen und rechtlichen Faktoren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Gesetzliche Erbfolge, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Römisches Recht, Germanisches Recht, BGB, Testament, Intestaterbfolge, Agnationsprinzip, Erbrecht, Verwandtschaft, Ehegatte, Staat, Erbe, Erbenstellung.
- Quote paper
- Ute Brettschneider (Author), 1998, Die gesetzliche Erbfolge in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21875