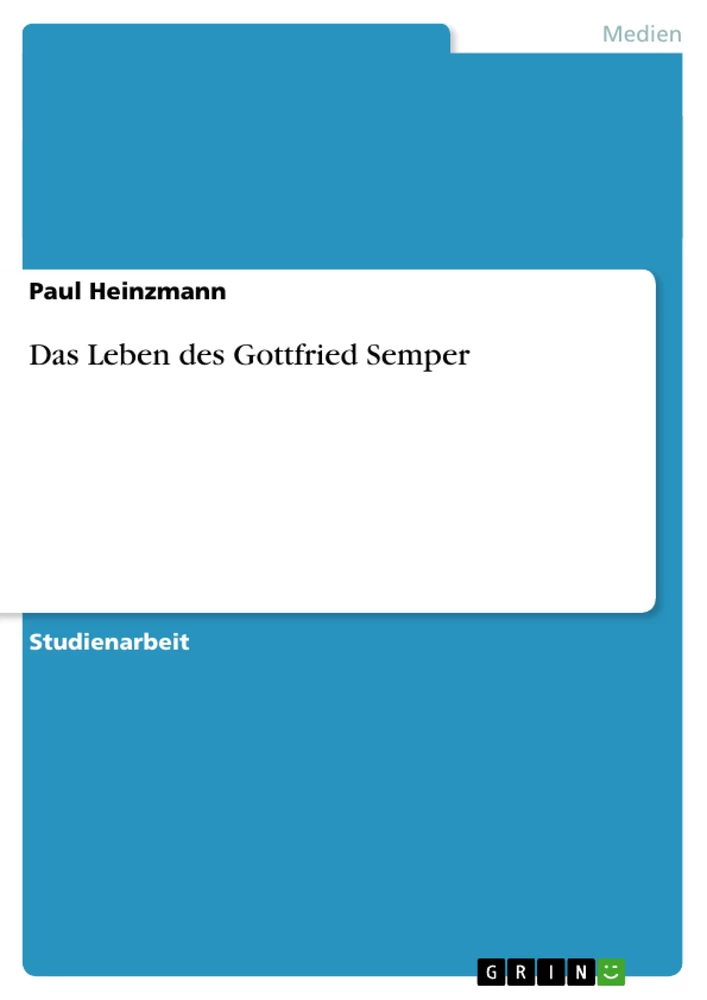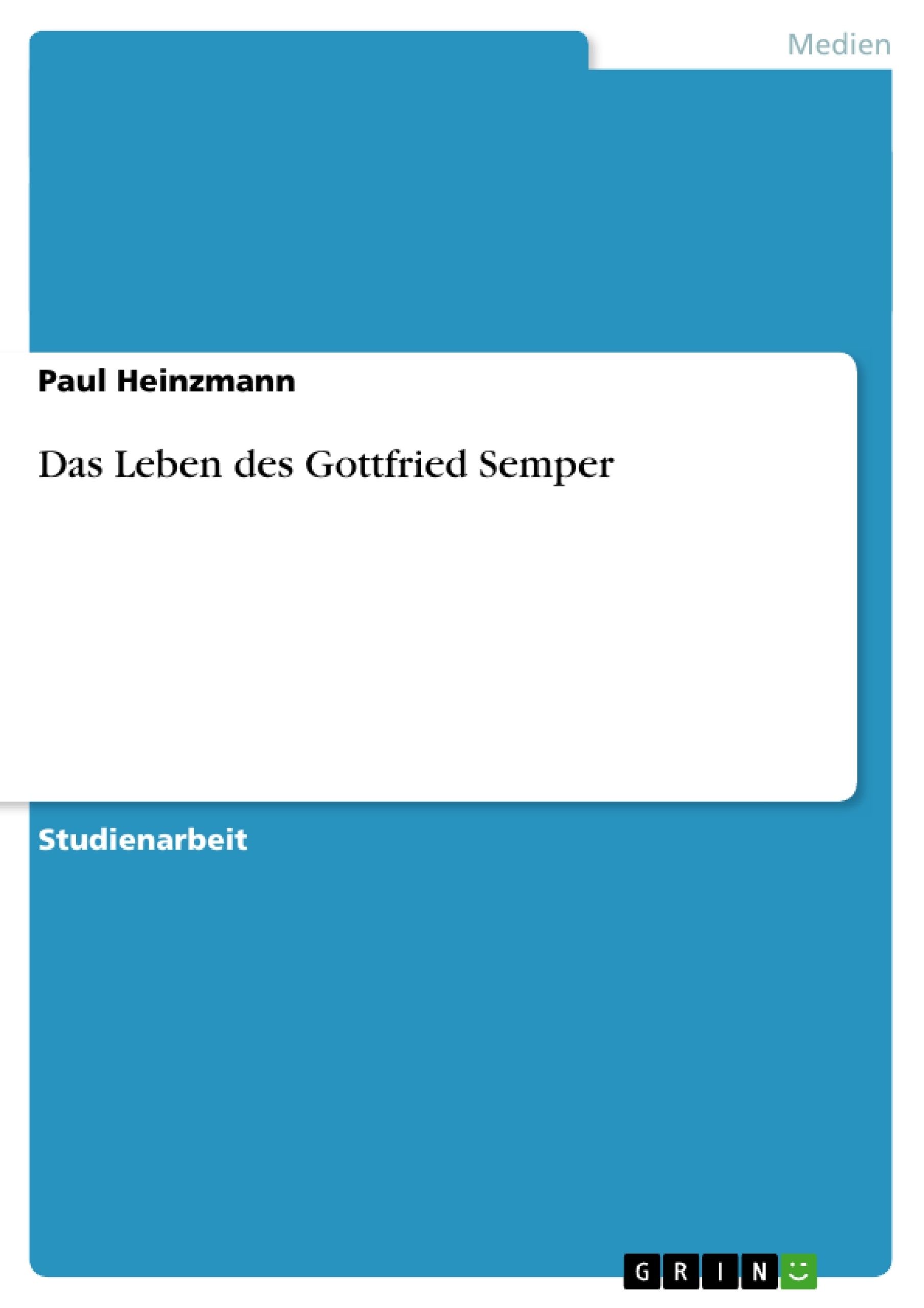Kurz bevor Semper 1834 als Professor in Dresden berufen wurde, bekam er auch seine ersten Bauaufträge, unter anderem in Hamburg. Als Architekturprofessor heiratete er dann 1835 Bertha Thimmig, mit der er sechs Kinder bekam und entwarf bis zu seiner Flucht 1849, aufgrund seiner aktiven Teilnahme an der Dresdener Revolution, unter anderem die Gemäldegalerie und das Königliche Hoftheater.
Zu Sempers Zeit in Dresden besuchten ca. 200 Schüler die Bauschule. Bernhard Krüger und Christian Friedrich Arnold erwiesen sich später als die bedeutendsten Semperschüler.
Krüger war unter anderem nach Sempers oben bereits genannter Flucht aus Dresden an der Vollendendung der Gemäldegalerie beteiligt.
Inhaltsverzeichnis
- Das Leben des Gottfried Semper
- Die jungen Jahre
- In Dresden
- In Europa
- Die Semperoper in Dresden
- Das erste Sempersche Hoftheater
- Das Interimstheater
- Das zweite Königliche Hoftheater
- Der Wiederaufbau der Semperoper
- Sempers weitere Werke in Dresden
- Die Sempergalerie
- Die Alte Synagoge
- Die Villa Rosa
- Das Matemihospital
- Der Palais Kaskel-Oppenheim
- Der Cholerabrunnen
- Sempers Werke in der Schweiz und in Österreich
- Das Polytechnikum in Zürich
- Der Kirchturm in Affoltem
- Die Eidgenössische Sternwalte in Zürich
- Das Stadthaus in Winterthur
- Das Kaisefforum in Wien
- Das Burgtheater in Wien
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Belegarbeit befasst sich mit dem Leben und Werk des Architekten Gottfried Semper. Sie präsentiert eine umfassende Analyse seiner wichtigsten Bauten, die von seiner frühen Karriere in Dresden bis zu seinen späten Projekten in der Schweiz und Österreich reichen. Die Arbeit beleuchtet Sempers architektonischen Stil, seine Einflüsse und seine Bedeutung für die Baugeschichte.
- Sempers architektonischer Stil
- Einflüsse von Semper
- Sempers Bedeutung für die Baugeschichte
- Sempers Werke in Dresden
- Sempers Werke in der Schweiz und Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Belegarbeit befasst sich mit dem Leben des Gottfried Semper. Es beschreibt seine frühen Jahre in Hamburg und Altona, seine Studien in Göttingen und München sowie seine ersten Bauaufträge. Das Kapitel beleuchtet auch seine Flucht aus Dresden nach der Revolution von 1849 und seine weitere Karriere in London und Zürich.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Semperoper in Dresden. Es beschreibt die Planung und den Bau des ersten Hoftheaters, das 1841 eingeweiht wurde. Es geht auch auf den Brand des Theaters im Jahr 1869 und den Wiederaufbau des zweiten Hoftheaters ein, das 1878 eröffnet wurde. Das Kapitel schildert die Zerstörung der Semperoper im Zweiten Weltkrieg und ihren Wiederaufbau in den 1970er Jahren.
Das dritte Kapitel behandelt weitere Werke Sempers in Dresden. Es beschreibt die Sempergalerie, die Alte Synagoge, die Villa Rosa, das Matemihospital, das Palais Kaskel-Oppenheim und den Cholerabrunnen. Das Kapitel beleuchtet die architektonischen Besonderheiten dieser Bauten und ihre Bedeutung für die Stadt Dresden.
Das vierte Kapitel widmet sich Sempers Werken in der Schweiz und Österreich. Es beschreibt das Polytechnikum in Zürich, den Kirchturm in Affoltem, die Eidgenössische Sternwalte in Zürich, das Stadthaus in Winterthur, das Kaiserforum in Wien und das Burgtheater in Wien. Das Kapitel analysiert die architektonischen Besonderheiten dieser Bauten und ihre Bedeutung für die Baugeschichte der beiden Länder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gottfried Semper, Semperoper, Dresden, Architektur, Baugeschichte, Polytechnikum, Zürich, Kaiserforum, Wien, Burgtheater, Alte Synagoge, Villa Rosa, Cholerabrunnen. Die Arbeit beleuchtet die architektonischen Besonderheiten von Sempers Werken und ihre Bedeutung für die Baugeschichte Deutschlands, der Schweiz und Österreichs.
- Quote paper
- Paul Heinzmann (Author), 2013, Das Leben des Gottfried Semper, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215935