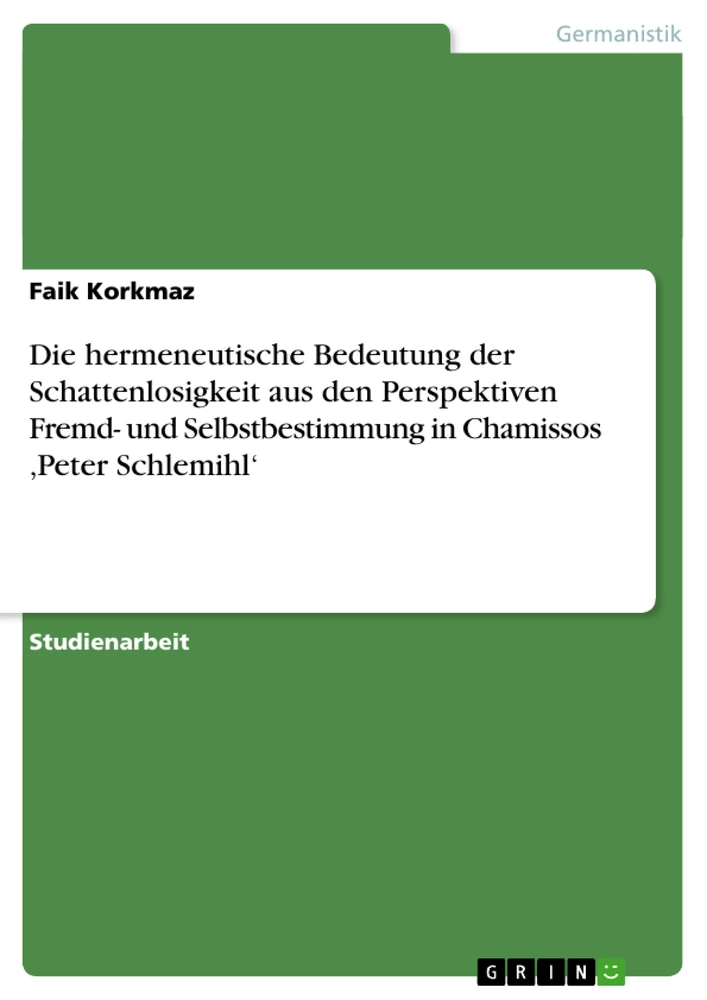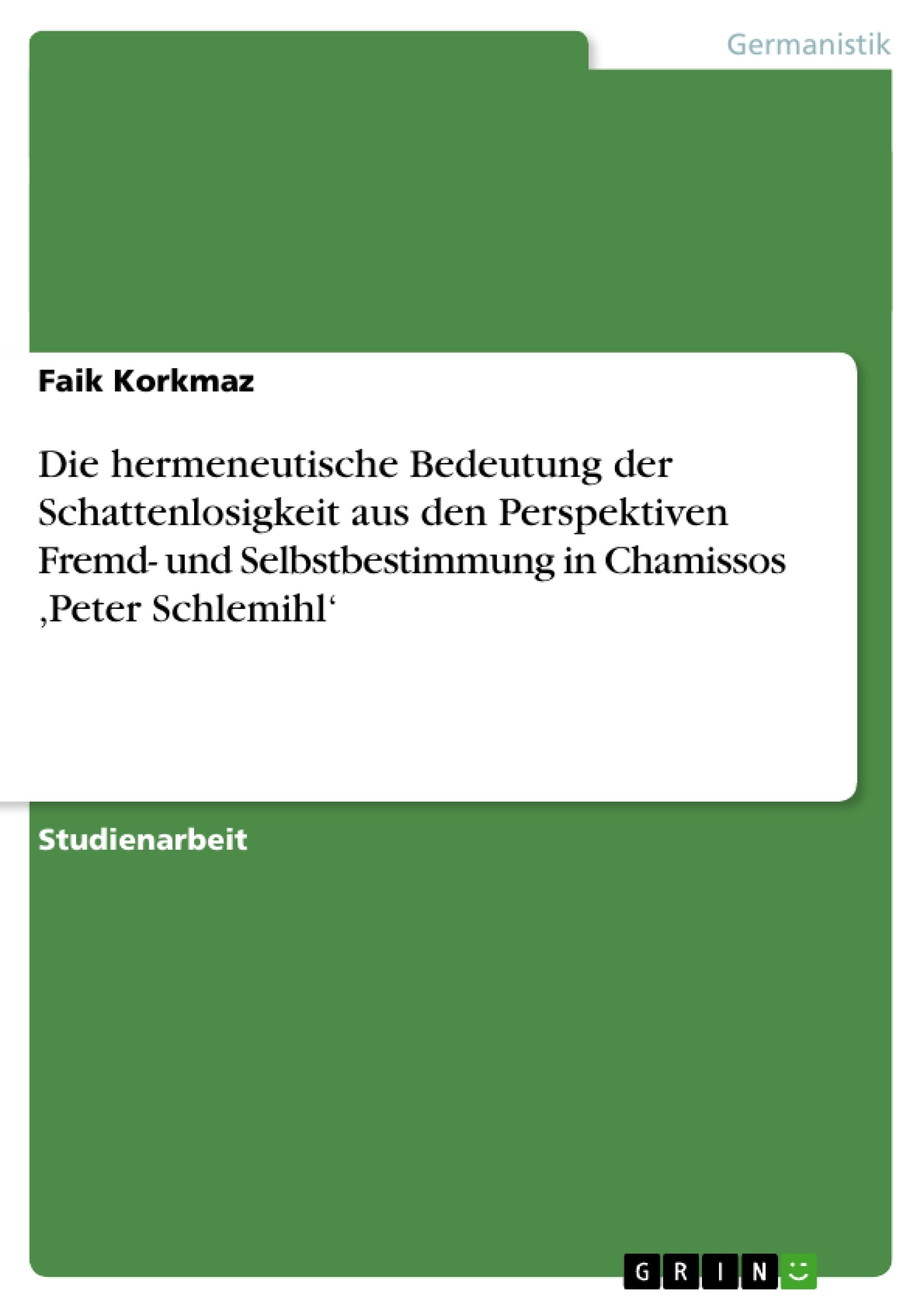Bereits nach wenigen Seiten durchzieht das leitmotivische Stigma der Schattenlosigkeit die Novelle; doch nicht nur die Novelle. Seit der Publikation des „Peter Schlemihl“ anno 1814 befleißigt sich Leserschaft wie Rezeptionsforschung dem Schattenmotiv eine haltbare Bedeutung zukommen zu lassen. So konkludiert Christine Schlitt, dass „die Geschichte des Peter Schlemihl […] die Geschichte der Interpretation seiner Schattenlosigkeit [ist].“
Worin aber besteht das Faszinierende dieses augenscheinlichen Faszinosums, das namhafte Schriftsteller wie Thomas Mann , Wilhelm Hauff und E.T.A. Hoffmann sowie Germanisten wie Peter von Matt und Gero von Wilpert in seinen Bann geschlagen hat?
Objektiv betrachtet ist der Schatten kaum der Beachtung wert und ohne jede Funktion. Der Verlust wäre mithin gleichbedeutend mit dem Besitz. Also viel Aufheben um nichts? Eine Farce?
Zieht man die Auslegung Adelbert von Chamissos heran, revidiert sich die These nicht. Im Gegenteil; sie verifiziert sich. Auf die Frage was es mit der Novelle auf sich habe, soll Chamisso jeden tieferen Sinn vehement abgestritten haben. Gerade diese Negierung jedoch wirkte sich stimulativ auf die Interpretationsforschung aus.
Innerhalb dieser erwies sich die methodische Herangehens- und Verfahrensweise der hermeneutischen Literaturtheorie als besonders produktiv.
Friedrich Schleiermachers Idee eines dichotomen Interpretationsansatzes (zur Rekonstruktion der Autorintention), nämlich die der grammatischen auf der einen, sowie der psychologischen Methode auf der anderen Seite, revolutionierte die hermeneutische Analyse und hat sie bis heute maßgeblich beeinflusst.
Ziel dieser Hausarbeit ist mit jener literaturtheoretischen Methode operierend, die einschlägige Bedeutung der Schattenlosigkeit hinblicklich Fremd- und Selbstbestimmung herauszuarbeiten. Der Schwerpunkt liegt auf der Thematik der Selbstbestimmung und innerhalb dieser auf der Interpretation der Fichteschen Ich-Konzeption , die nach Maßgabe des Erkenntnisinteresses eingehend behandelt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Literaturwissenschaftliche Methode und inhaltliche Schwerpunkte
- Die Bedeutung der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Fremdbestimmung
- Die Bedeutung der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Selbstbestimmung
- Schlussfolgerungen oder der Pragmatismus als Grundmotiv
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Bedeutung der Schattenlosigkeit in Adalbert von Chamissos Novelle „Peter Schlemihl". Der Fokus liegt dabei auf der Interpretation der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Fremd- und Selbstbestimmung. Die Arbeit untersucht, wie Chamissos Werk die gesellschaftlichen und philosophischen Konzepte der Zeit reflektiert, insbesondere die Ideen von Johann Gottlieb Fichte und die stoische Philosophie Epiktets.
- Die gesellschaftliche Bedeutung des Schattens als Zeichen von Zugehörigkeit und Anerkennung
- Die Rolle des Schattens im Kontext von Fremdbestimmung und Selbstentfremdung
- Die Verbindung zwischen Schattenlosigkeit und der Fichteschen Ich-Philosophie
- Die Frage nach der Willensfreiheit und der Determiniertheit des Weltlaufs
- Die Bedeutung des pragmatischen Wahrheitssuchers in Chamissos Werk
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Literaturwissenschaftliche Methode und inhaltliche Schwerpunkte: Die Einleitung stellt die hermeneutische Literaturtheorie als methodischen Ansatz für die Analyse von „Peter Schlemihl" vor und erläutert die zentralen Themen der Hausarbeit: die Bedeutung der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Fremd- und Selbstbestimmung.
- Die Bedeutung der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Fremdbestimmung: Dieses Kapitel untersucht, wie der Schattenverlust in „Peter Schlemihl" als Symbol für gesellschaftliche Determinierung und die Abhängigkeit des Einzelnen von externen Einflüssen interpretiert werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Thomas Manns Interpretation des Schattens als Zeichen gesellschaftlicher Zugehörigkeit und Anerkennung.
- Die Bedeutung der Schattenlosigkeit aus der Perspektive der Selbstbestimmung: Dieses Kapitel beleuchtet die Frage nach der Selbstbestimmung in „Peter Schlemihl" und untersucht, wie Chamisso die Fichtesche Ich-Philosophie in sein Werk integriert. Die Analyse konzentriert sich auf die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Willensfreiheit und der Kontingenz des Weltlaufs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Schattenverlust, die Fremdbestimmung, die Selbstbestimmung, die Fichtesche Ich-Philosophie, die stoische Philosophie Epiktets und den Pragmatismus. Die Arbeit analysiert, wie diese Konzepte in Adalbert von Chamissos Novelle „Peter Schlemihl" miteinander verwoben sind und welche Bedeutung sie für die Interpretation des Werks haben.
- Quote paper
- Faik Korkmaz (Author), 2013, Die hermeneutische Bedeutung der Schattenlosigkeit aus den Perspektiven Fremd- und Selbstbestimmung in Chamissos ,Peter Schlemihl‘, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215892