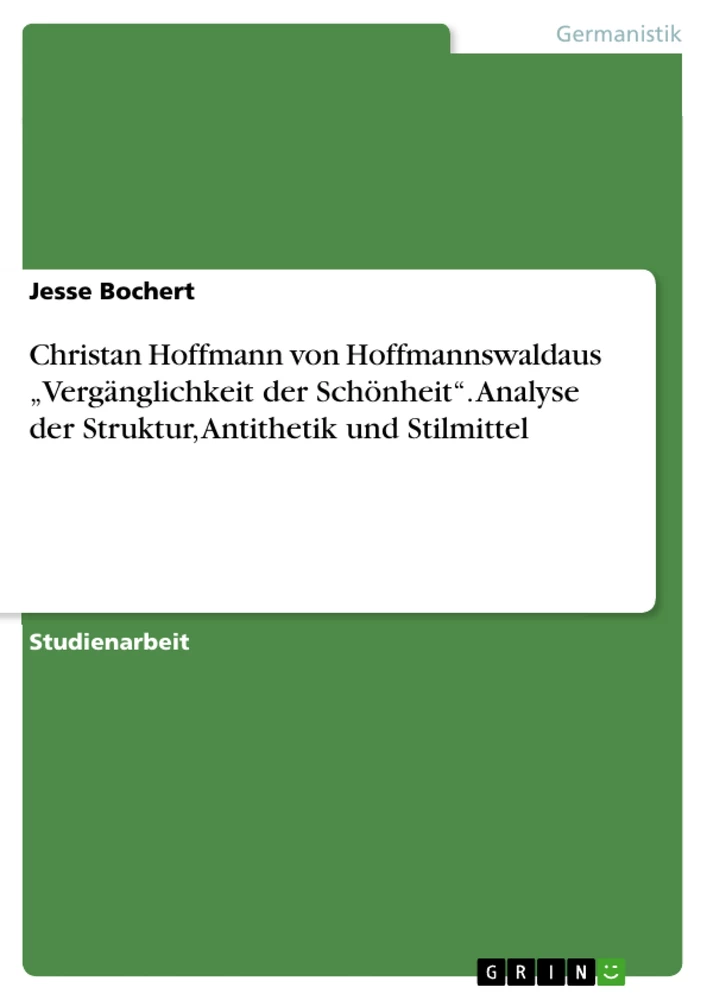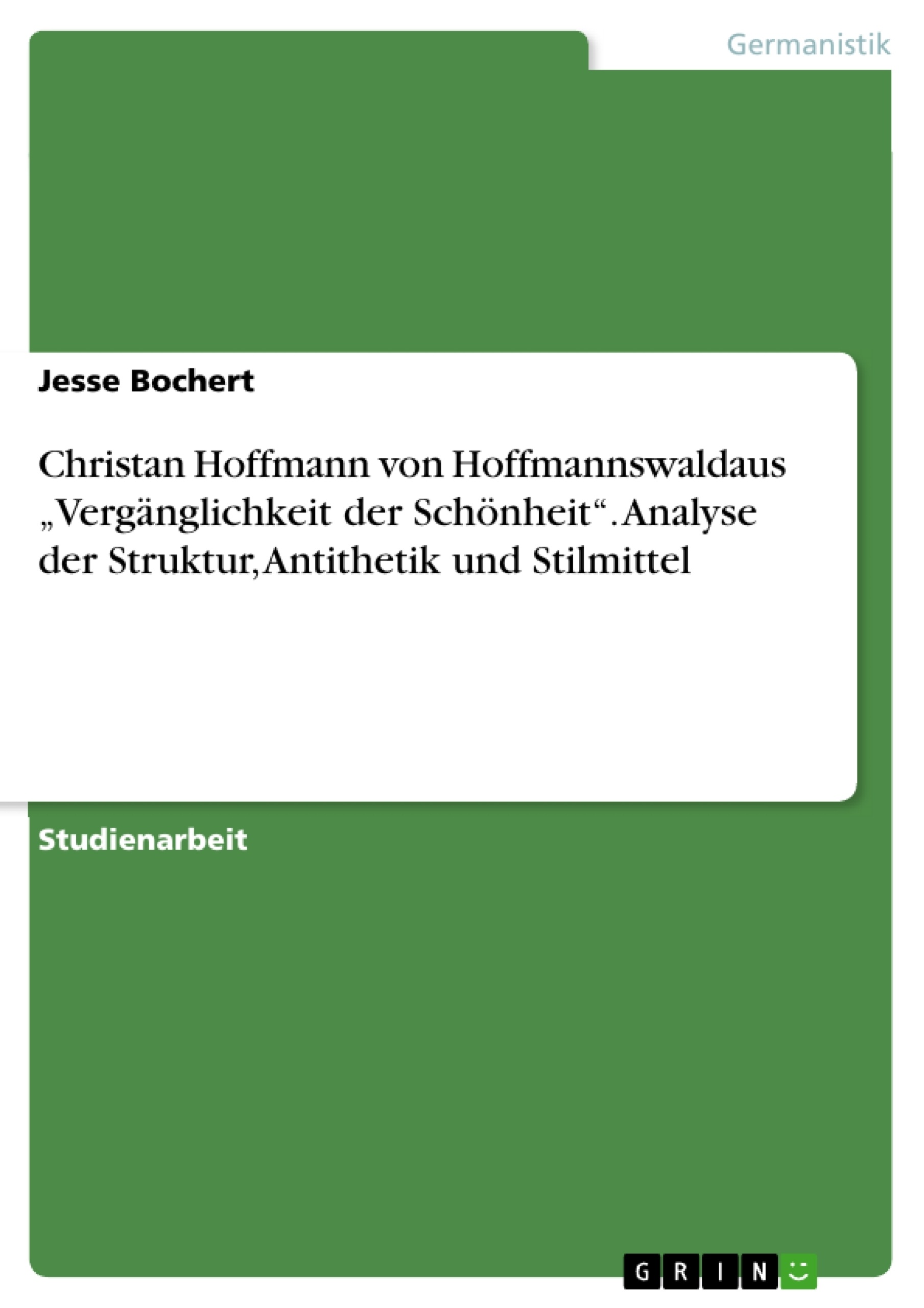In der literaturwissenschaftlichen Arbeit ist das Interpretieren der zentrale Bereich und zugleich ihr problematischster. Die Ergebnisse sind konstitutionell vorläufig und daher stets revisionsbedürftig. Da es die für immer geltende Interpretation nicht gibt,
„müssen literarische Texte, sollen sie im kulturellen Gedächtnis, d.h. für das Selbstbild eine Gesellschaft erhalten bleiben, immer neu interpretiert werden.“1
Ich widme mich in dieser Arbeit dem Gedicht „Vergänglichkeit der Schönheit“ von dem schlesischen Dichter Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, einer der bedeutendsten Barocklyriker der sogenannten „galanten Lyrik“2. Als Vorlage diente ihm das italienische Gedicht „Verrà la morte e con la man possente“ von Giuseppe Salomonis.3 Wann das Gedicht genau entstanden ist, konnte bis jetzt noch nicht eruiert werden, der Erstdruck (1965) ist jedoch erst zwanzig Jahre nach dem Tode des Verfassers erschienen.4
Das Gedicht handelt von der Vergänglichkeit der Schönheit einer hartherzigen Frau. Für die damalige Zeit der Dichtung gewiss nichts Originelles, was es jedoch so besonders macht, ist die formale Eleganz mit der Hoffmannswaldau dieses Thema behandelt und darüber hinaus liegt es
„auch an der zwanglosen Virtuosität, mit der zwei Grundthemen der Dichtung Hoffmannswaldaus und seiner Zeit, Carpe diem und Memento mori, mit schon leicht parodistisch anmutender Metaphorik dargestellt und aufeinander bezogen werden.“5
Gegenstand dieser Hausarbeit soll sein, als erstes die Struktur und die Begrifflichkeiten zu erläutern. Anschließend zeige ich, wie Hoffmannswaldau die Antithetik und andere Stilmittel nutzt, um die spitzfindige Pointe zu isolieren, damit im abschließenden Kapitel eben dieser Höhepunkt ins richtige Licht gestellt werden kann.
[...]
1 Laufhütte, Hartmut: Mit der Grenze spielen. Zu Christan Hofmann von Hoffmannswaldaus Sonett Vergänglichkeit der Schönheit; In: Frank, Gustav/ Lukas, Wolfgang (Hrsg.): Norm-Grenze-Abweichung. Kultursemiotische Studien zu Literatur, Medien und Wirtschaft, Passau 2004, S. 31.
2 Vgl. Szyrocki, Marian: Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung, Stuttgart 1997, S. 200.
3 Vgl. Noack, Lothar: Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, (1616 - 1679). Leben und Werk, Tübingen 1999, S. 226.
4 Vgl. Laufhütte S. 32.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur und Begrifflichkeit
- Die Schönheiten der Frau und der Griff des Todes
- Die Antithetik im Gedicht
- Die auffällige Zurückhaltung für die Schlusspointe
- Das Herz aus Diamant als Schlusspointe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Christian Hoffmann von Hoffmannswaldaus Sonett „Vergänglichkeit der Schönheit“. Ziel ist es, die Struktur und die verwendeten sprachlichen Mittel zu untersuchen und die Wirkung der Schlusspointe herauszuarbeiten. Die Interpretation fokussiert auf die formale Eleganz des Gedichts und den Umgang mit den barocken Topoi Carpe diem und Memento mori.
- Formale Analyse des Sonetts (Metrum, Reimschema)
- Interpretation der Antithesen und Stilmittel
- Analyse der Schlusspointe und ihrer Bedeutung
- Beziehung zwischen Carpe diem und Memento mori im Gedicht
- Kontextualisierung im Kontext der galanten Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Herausforderungen der literaturwissenschaftlichen Interpretation. Sie stellt das Gedicht „Vergänglichkeit der Schönheit“ von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau vor, einen bedeutenden Vertreter der galanten Lyrik, und skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit. Die Einleitung betont die Notwendigkeit der Neuinterpretation literarischer Texte für das kulturelle Gedächtnis und benennt die zentrale These: die formale Eleganz und der virtuose Umgang mit den Motiven Carpe diem und Memento mori als Besonderheiten des Gedichts. Sie umreißt die einzelnen Kapitel und ihre jeweiligen Schwerpunkte.
Struktur und Begrifflichkeit: Dieses Kapitel analysiert die formale Struktur des Sonetts nach den Regeln von Martin Opitz. Es beschreibt das Reimschema (abba abba und ccd eed), das Metrum (Alexandriner) und die Verwendung von Stilmitteln. Es beleuchtet die gezielte Verwendung des Alexandriners im Gegensatz zu anderen Dichtern der Zeit und zeigt durch genaue Erklärung der zeitgenössischen Wortbedeutungen auf, wie Hoffmannswaldau mit sprachlicher Präzision und Eleganz arbeitet, um dem Verständnis des Gedichts entgegenzukommen. Dies ist wichtig für die anschließende Interpretation des Inhalts.
Die Schönheiten der Frau und der Griff des Todes: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Beschreibung der vergänglichen Schönheit der Frau und die Gegenüberstellung mit dem Tod. Es wird die Verwendung von Antithesen und anderen Stilmitteln analysiert, die zur Herausarbeitung der Pointe beitragen. Die Aufzählung der vergänglichen Schönheiten der Frau wird mit ihren jeweiligen Gegenteilen gegenübergestellt, um die Vergänglichkeit zu verdeutlichen. Die Zurückhaltung in der Darstellung verstärkt die unerwartete Pointe im Schlussteil des Gedichts. Die Subkapitel beleuchten die Antithetik und die Zurückhaltung im Aufbau des Gedichts bis zur Pointe.
Das Herz aus Diamant als Schlusspointe: Das Kapitel widmet sich der Schlusspointe des Gedichts, dem „Herz aus Diamant“. Diese Pointe wird im Kontext des gesamten Gedichts interpretiert und ihre Bedeutung für das Verständnis des Werks herausgearbeitet. Die Unvergänglichkeit des Herzens wird als Kontrast zur Vergänglichkeit der äußeren Schönheit gesetzt und erzeugt eine überraschende und nachdenklich stimmende Wirkung. Die Pointe wird als Ausdruck einer barocken Weltsicht interpretiert, die Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit zugleich thematisiert.
Schlüsselwörter
Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Vergänglichkeit der Schönheit, Barocklyrik, Sonett, Galante Lyrik, Antithese, Memento mori, Carpe diem, formale Eleganz, Schlusspointe, Alexandriner, Sprachliche Mittel.
Häufig gestellte Fragen zu Christian Hoffmann von Hoffmannswaldaus "Vergänglichkeit der Schönheit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Sonett "Vergänglichkeit der Schönheit" von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau. Der Fokus liegt auf der formalen Struktur, den verwendeten sprachlichen Mitteln und der Wirkung der Schlusspointe. Die Interpretation betrachtet das Gedicht im Kontext der barocken Topoi Carpe diem und Memento mori und der galanten Lyrik.
Welche Aspekte des Sonetts werden untersucht?
Die Analyse umfasst die formale Struktur des Sonetts (Metrum, Reimschema), die Interpretation der Antithesen und Stilmittel, die Analyse der Schlusspointe und ihrer Bedeutung, die Beziehung zwischen Carpe diem und Memento mori im Gedicht sowie die Kontextualisierung im Kontext der galanten Lyrik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Struktur und Begrifflichkeit des Sonetts, ein Kapitel zur Analyse der Antithesen und der Darstellung von Schönheit und Tod, und ein Kapitel zur Interpretation der Schlusspointe ("Herz aus Diamant"). Die Einleitung stellt das Gedicht und die Forschungsfrage vor, während der Schluss die Ergebnisse zusammenfasst.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt das Gedicht und den Autor vor und skizziert den weiteren Verlauf der Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit der Neuinterpretation literarischer Texte und formuliert die zentrale These: die formale Eleganz und der virtuose Umgang mit den Motiven Carpe diem und Memento mori als Besonderheiten des Gedichts.
Was wird im Kapitel "Struktur und Begrifflichkeit" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die formale Struktur des Sonetts nach den Regeln von Martin Opitz. Es beschreibt das Reimschema, das Metrum (Alexandriner) und die Verwendung von Stilmitteln. Es beleuchtet die gezielte Verwendung des Alexandriners und erklärt die zeitgenössischen Wortbedeutungen, um das Verständnis des Gedichts zu erleichtern.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Die Schönheiten der Frau und der Griff des Todes"?
Dieser Abschnitt analysiert die Beschreibung der vergänglichen Schönheit der Frau und deren Gegenüberstellung mit dem Tod. Es werden Antithesen und andere Stilmittel untersucht, die zur Herausarbeitung der Pointe beitragen. Die Zurückhaltung in der Darstellung wird als Verstärkung der unerwarteten Schlusspointe hervorgehoben.
Wie wird die Schlusspointe interpretiert?
Das Kapitel "Das Herz aus Diamant als Schlusspointe" interpretiert die Schlusspointe im Kontext des gesamten Gedichts und arbeitet deren Bedeutung für das Verständnis des Werks heraus. Die Unvergänglichkeit des Herzens wird als Kontrast zur Vergänglichkeit der äußeren Schönheit gesetzt und als Ausdruck einer barocken Weltsicht interpretiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Vergänglichkeit der Schönheit, Barocklyrik, Sonett, Galante Lyrik, Antithese, Memento mori, Carpe diem, formale Eleganz, Schlusspointe, Alexandriner, Sprachliche Mittel.
- Quote paper
- Jesse Bochert (Author), 2012, Christan Hoffmann von Hoffmannswaldaus „Vergänglichkeit der Schönheit“. Analyse der Struktur, Antithetik und Stilmittel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215762