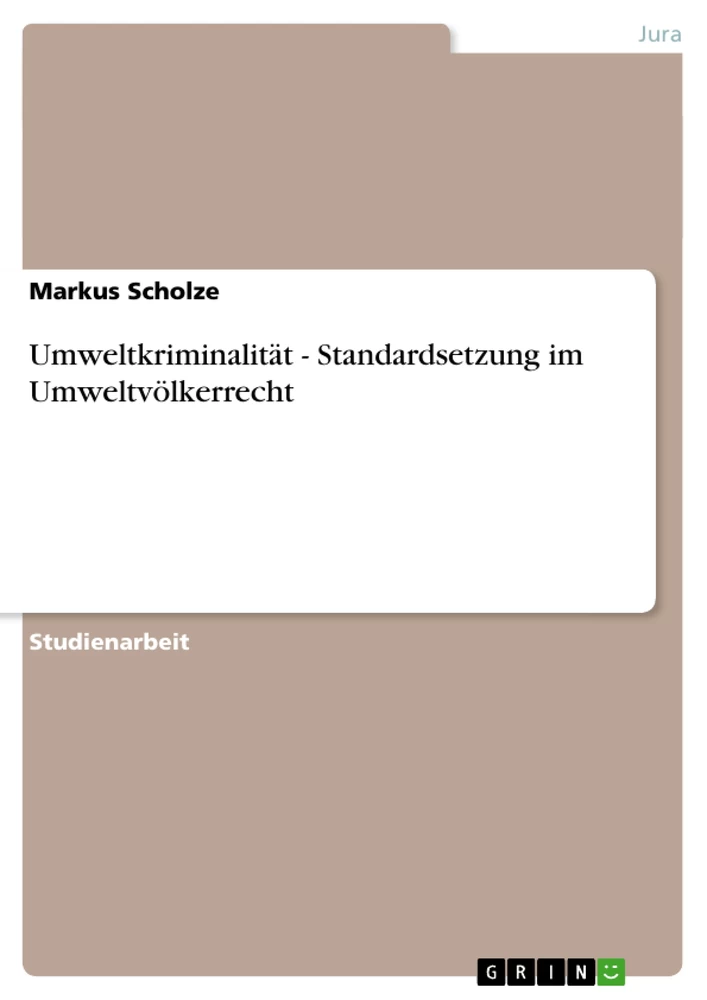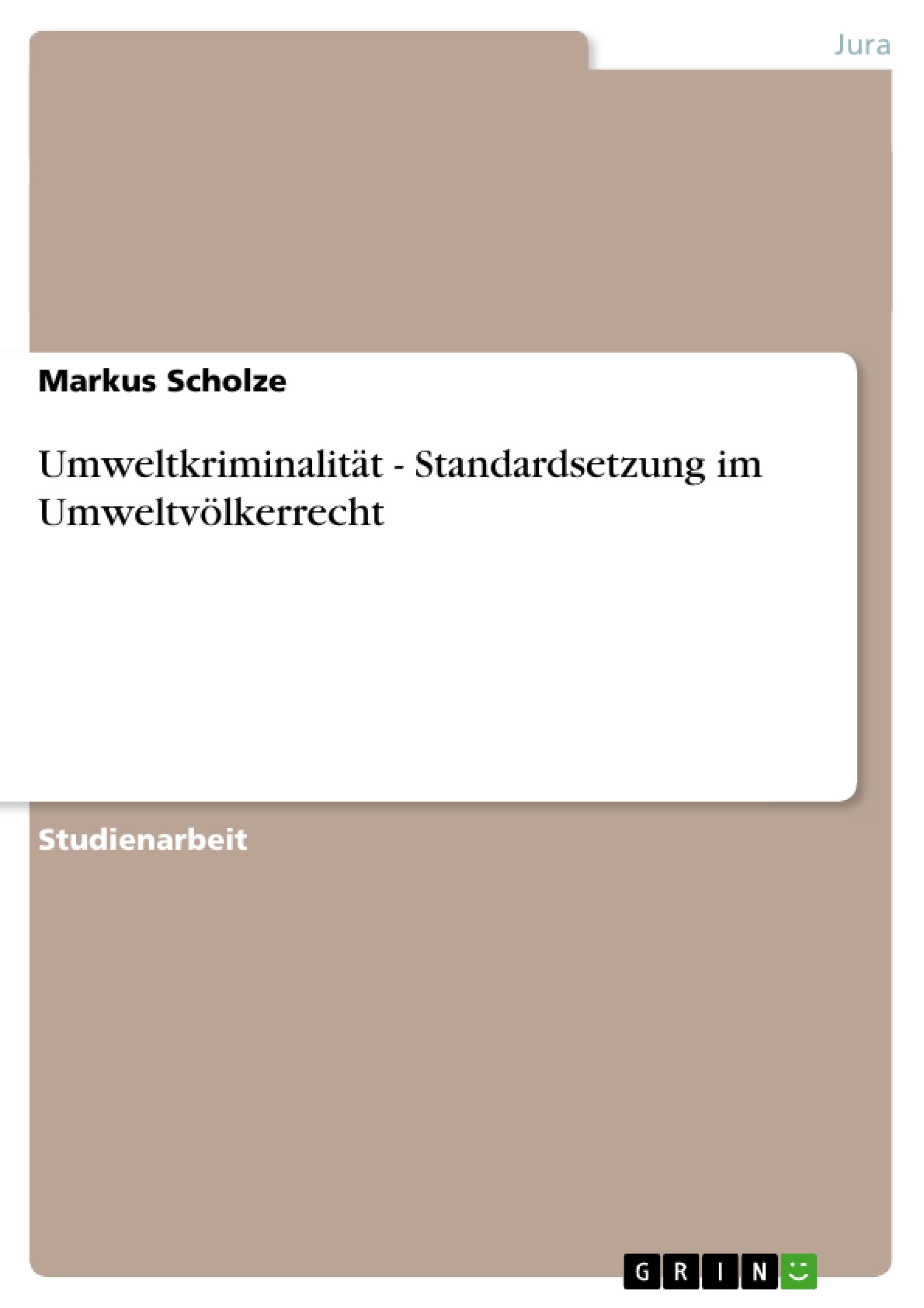Nach dem Giftunfall bei Sandoz im Herbst 1986 war das Thema Umweltkriminalität in aller Munde. Ein eklatantes Vollzugsdefizit im Umweltstrafrecht in Deutschland wurde wortreich beklagt und belegt. Das Motto damals: Die Großen lässt man laufen. Abhilfe wurde rasch versprochen, danach ebenso rasch vergessen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Definition - Umweltkriminalität
2. Ein Bericht von Greenpeace
3. Agenda 21
4. Basler Übereinkommen
5. Die Reaktion der Europäischen Union auf die internationale Umweltkriminalität
6. Umweltverbrechen und die EU
7. Umweltschutzdelikte im österreichischen Strafgesetzbuch
Literaturverzeichnis
Einleitung
Nach dem Giftunfall bei Sandoz im Herbst 1986 war das Thema Umweltkriminalität in aller Munde. Ein eklatantes Vollzugsdefizit im Umweltstrafrecht in Deutschland wurde wortreich beklagt und belegt. Das Motto damals: Die Großen lässt man laufen. Abhilfe wurde rasch versprochen, danach ebenso rasch vergessen.[1]
1. Definition - Umweltkriminalität
Von Umweltkriminalität spricht man, wenn ein rechtsverletzender Tatbestand vorliegt, der gegen Umweltschutznormen verstößt. Umweltkriminalität wird durch die internationalen Akteure wie das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Europäische Union, Interpol, G8 folgendermaßen definiert:
1) Illegaler Handel mit bedrohten Pflanzen- und Tierarten, der gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen von 1973 verstößt
2) Illegaler Handel und Transport von Substanzen welche die Ozonschicht abbauen, was gegen das Montrealer Protokoll von 1987 verstößt
3) Abladen bzw. deponieren und transportieren von gefährlichen Abfällen, was gegen das Basler Übereinkommen von 1989 verstößt
4) Illegales, unreguliertes und nicht protokolliertes Fischen, das gegen Fischereiabkommen und andere Kontrollen verstößt, die regionale Fischereiorganisationen zur Regulierung auferlegt haben.
5) Illegales abholzen und handeln mit gestohlenem Naturholz, was gegen nationale Gesetze verstößt.[2]
2. Ein Bericht von Greenpeace
Greenpeace veröffentlicht im greenpeace magazin 4.09 unter dem Titel: „Paradies für Umweltgangster“ folgendes:
In Deutschland kommen Sünder meist ungeschoren oder mit Bewährung davon. Die Dunkelziffer bei Umweltverbrechen ist hoch. Die Täter sind schwer zu überführen. Ermittlungen zu Umweltdelikten werden in Deutschland im Vergleich zu anderen Strafverfahren überdurchschnittlich häufig eingestellt. Kommt es doch zum Prozess, verhängen die Gerichte in der Regel nur Geldbußen: Im Jahr 2006 mussten 1811 von 1873
Verurteilten eine Geldstrafe zahlen, lediglich 49 wurden zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die Hälfte der Bußen lag unter 31 Tagessätzen, fast alle unter 91. Erst ab dieser Anzahl taucht eine Strafe im polizeilichen Führungszeugnis auf.[3]
3. Agenda 21
In der Agenda 21 wird in Kapitel 19 und 20 folgendes auszugsweise zur Umweltkriminalität gesagt:
Kapitel 19
Umweltverträglicher Umgang mit toxischen Chemikalien einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen internationalen Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten.
19.3 Zur Zeit beschäftigen sich eine ganze Reihe internationaler Gremien mit Fragen der Chemikaliensicherheit. Es werden 6 Programmbereiche vorgeschlagen wobei ich den 6. Punkt hervorheben möchte:
Maßnahmen zur Verhinderung des illegalen internationalen Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten.
Zur Zeit gibt es keine weltweit gültige internationale Vereinbarung zur Regelung des Handels mit toxischen und gefährlichen Produkten. Weltweit wird jedoch mit wachsender Besorgnis auf die vom illegalen internationalen Handel mit diesen Produkten ausgehende Gefährdung für Gesundheit und Umwelt, insbesondere in den Entwicklungsländern, hingewiesen, was auch in den von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedeten Resolutionen 42/183 und 44/226 bestätigt wurde. Mit "illegalem Handel" sind hier Aktivitäten gemeint, die gegen einzelstaatliche Gesetze oder einschlägige internationale Rechtsnormen verstoßen. Besorgnis besteht des Weiteren auch darüber, dass bei der grenzüberschreitenden Verbringung solcher Produkte häufig die einschlägigen, international gültigen Richtlinien und Grundsätze missachtet werden. Die im Rahmen des vorliegenden Programmbereichs ins Auge gefassten Maßnahmen zielen in erster Linie auf die verbesserte Aufdeckung und wirksame Verhinderung solcher Praktiken ab.
Kapitel 20:
Umweltverträgliche Entsorgung gefährlicher Abfälle einschließlich der Verhinderung von illegalen internationalen Verbringungen solcher Abfälle.
Die Unterbindung der illegalen internationalen Verbringung von gefährlichen Abfällen dient dem Wohle der Umwelt und der Gesundheit in allen Ländern, insbesondere aber in den Entwicklungsländern. Darüber hinaus ergibt sich damit die Möglichkeit, die Wirksamkeit des Baseler Übereinkommens und auf regionaler Ebene geschlossener internationaler Instrumente wie etwa des Bamako-Übereinkommens und des Lomé IV-Übereinkommens durch vermehrte Einhaltung der in diesen Übereinkommen festgelegten Kontrollen zu erhöhen. Artikel IX des Baseler Übereinkommens befaßt sich insbesondere mit der Frage des illegalen Transports gefährlicher Abfälle. Solche illegalen Transporte können enorme Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt mit sich bringen und den Empfängerländern eine besondere und außergewöhnliche Belastung aufbürden.[4]
4. Basler Übereinkommen
Im Basler Übereinkommen (1989) wird im Art.4 folgendes zur Bestrafung von Umweltkriminalität gesagt:
Art.4 (3)
„Die Vertragsparteien sind der Auffassung, dass der unerlaubte Verkehr mit gefährlichen Abfällen oder anderen Abfällen eine Straftat darstellt.
Art.4 (4)
Jede Vertragspartei trifft geeignete rechtliche, verwaltungsmäßige und sonstige Maßnahmen, um dieses Übereinkommen durchzuführen und ihm Geltung zu verschaffen, einschließlich Maßnahmen zur Verhinderung und Bestrafung übereinkommenswidriger Verhaltensweisen.“[5]
5. Die Reaktion der Europäischen Union auf die internationale
Umweltkriminalität
Laut eines Berichts der US-amerikanischen Regierung „International Crime Threat Assessment“, veröffentlicht im Dezember 2000, ist die Umweltkriminalität der rentabelste und am schnellsten wachsende Bereich der internationalen Kriminalität. Die US-Regierung vermutet, dass nationale und internationale Verbrechersyndikate durch die Deponierung vergifteter Abfälle, den Schmuggel verbotener, gefährlicher Stoffe sowie mit der Ausbeutung und dem Handel mit Bodenschätzen jährlich zwischen $ 22-31 Mrd. Dollar weltweit verdienen.
[...]
[1] http://www.zeit.de/1988/17/krimnine11 22.04.1988 - 08:00 Uhr, Quelle: DIE ZEIT, 22.4.1988 Nr. 17
[2] http://www.unodc.org/documents/NGO/EIA Ecocrime report 0908 final draft low.pdf, Environmental crime, A threat to our future: Environmental Investigation Agency (EIA)
[3] greenpeace magazin 4.09: http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=5787
[4] Agenda 21, Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro. Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn, Köllen Druck+Verlag GmbH, Postfach18 65, 53008 Bonn
[5] Randelzhofer, Albrecht; Völkerrechtliche Verträge. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2009.
- Quote paper
- MA Markus Scholze (Author), 2011, Umweltkriminalität: Standardsetzung im Umweltvölkerrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215680