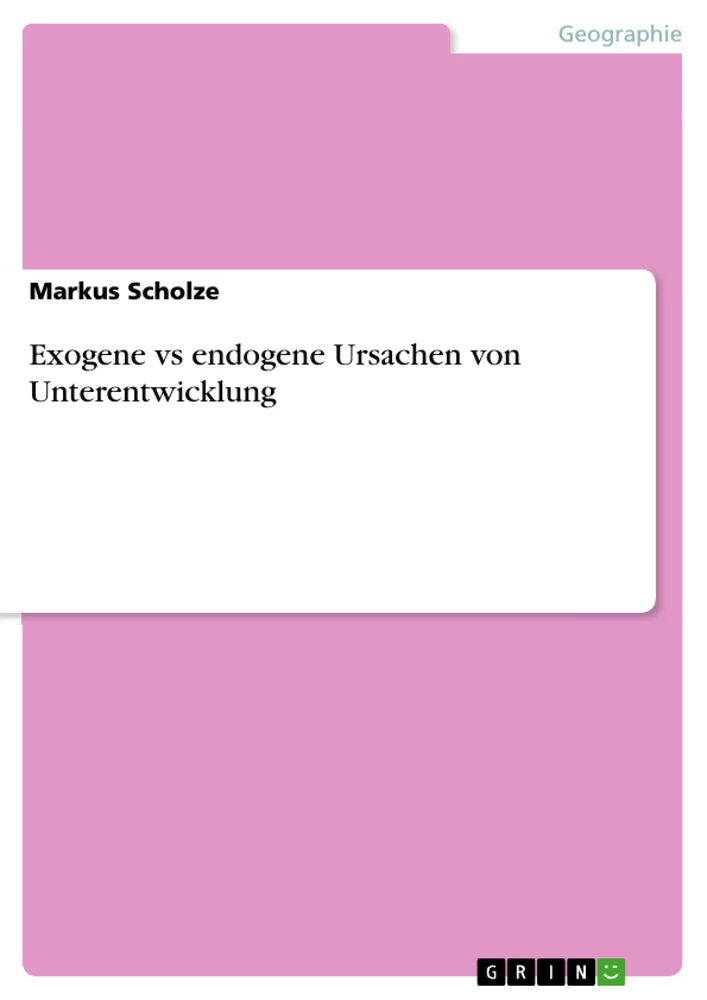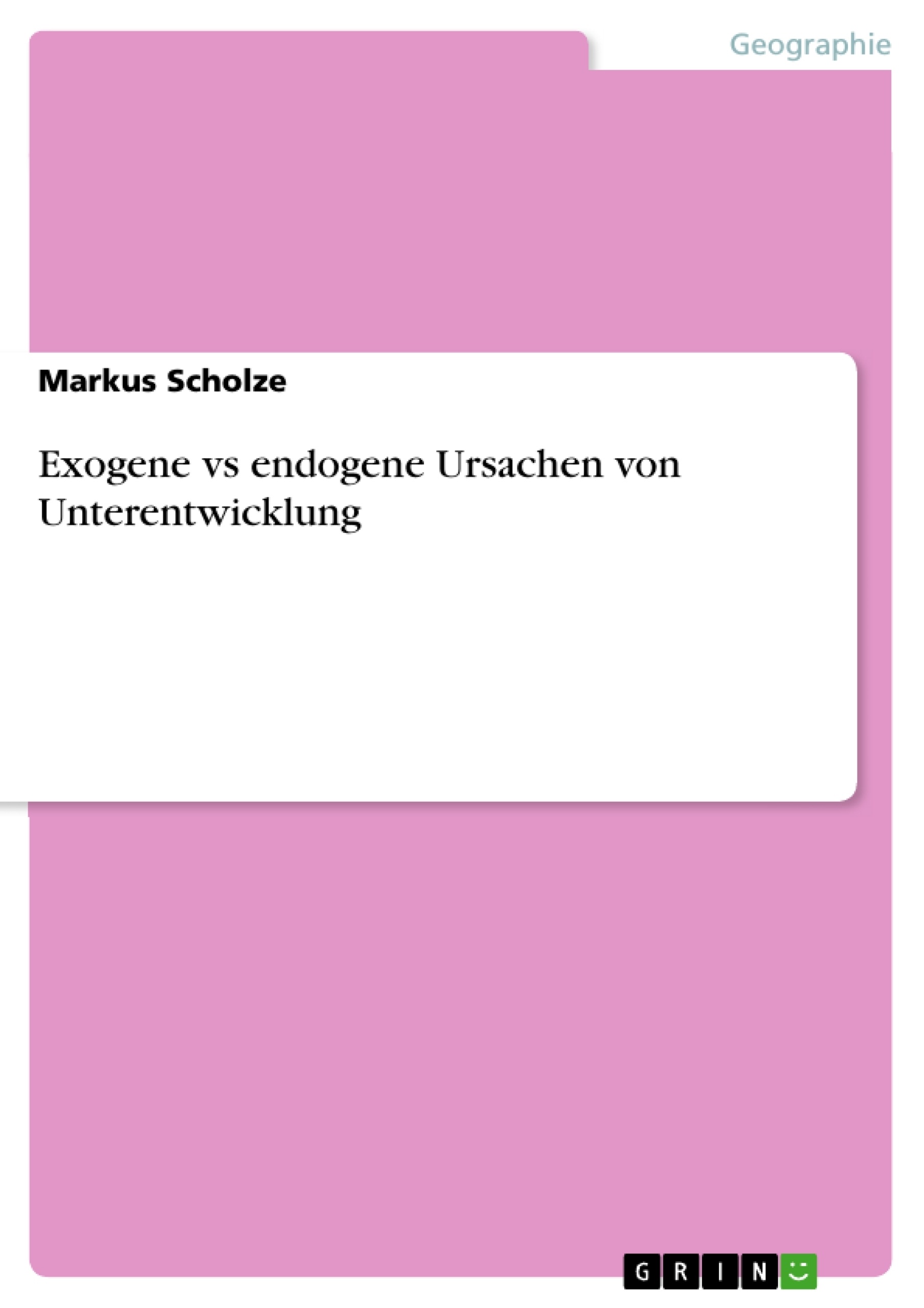Die Diskussion über die Ursachen der Unterentwicklung ist sehr komplex und keineswegs neu. Schon in den 70er Jahren beschäftigte Entwicklungsforscher die Frage, ob exogene oder endogene Ursachen für die Unterentwicklung verantwortlich sind. War es der Kolonialismus oder die neokoloniale Dependenz, die die Entwicklungsländer zu dem machten was sie heute sind. Liegen die Ursachen am Mangel von Impulsen und Möglichkeiten in ihrer Kultur und gesellschaftlichen Struktur oder ist es doch zuviel oder gar zuwenig Kapitalismus, der die Entwicklungsländer in Armut versinken lässt?
Exogene vs. endogene Ursachen von Unterentwicklung
Die Diskussion über die Ursachen der Unterentwicklung ist sehr komplex und keineswegs neu. Schon in den 70er Jahren beschäftigte Entwicklungsforscher die Frage, ob exogene oder endogene Ursachen für die Unterentwicklung verantwortlich sind. War es der Kolonialismus oder die neokoloniale Dependenz, die die Entwicklungsländer zu dem machten was sie heute sind. Liegen die Ursachen am Mangel von Impulsen und Möglichkeiten in ihrer Kultur und gesellschaftlichen Struktur oder ist es doch zuviel oder gar zuwenig Kapitalismus, der die Entwicklungsländer in Armut versinken lässt (vgl. Nuscheler 2004)?
Der Kolonialismus als (exogener) Grund allen Übels in den Entwicklungsländern hatte unbestritten einen großen Einfluss auf die ökonomische Entwicklung der heute unterentwickelten Länder. So wurden selbstständige Entwicklungen und fortgeschrittene Kulturen durch die Kolonialmächte unterbrochen, wie die Zerstörung der indischen Seidenmanufaktur durch den britischen Imperialismus deutlich zeigt. Gleichzeitig hat der Kolonialismus die Schranken des Provinzialismus abgebrochen, wie es Karl Marx in dem Artikel über die, Die britische Herrschaft in Indien’ beschrieb (vgl. Nuscheler 1996). Die meisten Staaten, die von Kolonialmächten beherrscht wurden, waren vor ihrer Unabhängigkeit fähig die Nahrungsmittelversorgung selbstständig zu bewerkstelligen, was viele davon heute nicht mehr sind. Es hat also nach der Kolonialzeit offensichtlich eine Fehlentwicklung in diesen Ländern stattgefunden.
Zu den Folgen (vielleicht auch als Folge) des Kolonialismus kommt in den 1970er Jahren der Neokolonialismus auf, der vor allem durch die hohe Verschuldung der Entwicklungsländer gekennzeichnet ist. Der Schuldenberg der Dritten Welt ist seit dem Jahre 1980 von 580 Milliarden Dollar auf 2400 Milliarden Dollar im Jahr 2004 angestiegen (vgl. Ziegler 2005, S.79). Obwohl zum Beispiel im Jahr 2005, im Rahmen eines Schuldensenkungsprogramms 27 Ländern, insgesamt ein Schuldenerlass von 54 Milliarden Dollar - was zwei Drittel der Gesamtschuld entsprach - gewährt wurde, konnte doch kein Wachstum ausgelöst werden (vgl. Easterly 2006). Der Schuldendienst verschlingt den größten Teil des Haushaltsbudgets und die noch vorhandenen Ressourcen der jeweiligen Staaten. Droht diesen Ländern Zahlungsunfähigkeit, so werden sie vom IWF und von den Gläubigern unter wirtschaftlichen und politischen Druck gesetzt.
Eine (endogene) Ursache der Unterentwicklung vor allem in Afrika ist der Jahrzehnte lange unwirtschaftlicher Umgang mit den vorhandenen Ressourcen der jeweiligen Staaten, was sicherlich ein belastendes Erbe aus der Kolonialzeit ist. Man möge meinen, dass natürlich vorkommende Bodenschätze zu Reichtum führen, aber offensichtlich wirken sich große Erträge aus Rohstoffexporten in vielen Entwicklungsländern als wachstumshemmend aus. Nach Schätzung von Paul Collier leben knapp 30 Prozent der ärmsten Milliarde in den Ländern, wo das Wirtschaftsleben vom Rohstoffreichtum bestimmt wird. In diesen Ländern kommt es zur ,holländischen Krankheit’. Durch die Rohstoffexporte gewinnt die inländische Währung gegenüber anderen Währungen an Wert, was zur Folge hat, dass die Wettbewerbsfähigkeit der anderen Exportgüter maßgeblich beeinträchtigt und schließlich vom Exportsektor verdrängt wird. Diese verdrängten Wirtschaftssektoren der industriellen Produktion sind der Motor des Wachstums, das letztendlich zum erliegen kommt (vgl. Collier 2008).
„Das Hauptproblem des Ressourcenfluchs besteht darin, dass Ressourceneinnahmen zu einer funktionellen Störung der Demokratie führen. [...] Das neue Gesetz des Dschungels, nach dem der politische Wahlkampf eines ressourcenreichen Landes abläuft, könnte lauten: Survival of the fattest. Nur die Reichen überleben“ (Collier 2008, S.63).
Abgesehen von den korrupten Staatspräsidenten und Regierungsmitgliedern - die sich mit Rohstoffen bereichern und mit Entwicklungsgelder ihre Schweizer Bankkonten füllen - ist eine schlechte Regierungspraxis und miserable Wirtschaftspolitik das Hauptproblem in diesen Ländern. Collier kommt zu dem Schluss, dass die wesentliches Probleme in diesen Ländern das niedrige Einkommen, Ausbeutung, politische Unterdrückung und fehlende Partizipation sind und diese Missstände in häufigen Fällen Rebellenbewegungen auf den Plan rufen, die zumindest einen Putsch, wenn nicht schlimmer einen Bürgerkrieg auslösen. Krieg ist bekannterweise der am meisten wachstumshemmende Faktor einer Volkswirtschaft. (vgl. Collier 2008, S.33ff.).
Die Ursachen für Unterentwicklung sind sehr ambivalent zu betrachten. So haben Kolonialmächte nicht nur vorhandene Strukturen zerstört sondern auch entwicklungsfähige Produktions- und Verkehrsstrukturen hinterlassen (vg. Nuscheler 1996). Der Kolonialismus kann daher nicht als die Ursache schlechthin für die unzureichende Entwicklung der heutigen Entwicklungsländer hingestellt werden. Sicherlich ist die Vorgehensweise der Gläubigerländer und des IWF, was die Kreditvergabe an die Entwicklungsländer betrifft kritisch zu betrachten. Vielleicht wäre anstatt der Vergabe von neuen Krediten, Beihilfen nach dem Modell des Marshall-Plans in Europa sinnvoller um den diese Länder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Man kann den Entwicklungsländern durchaus die Schuld für den unzureichenden Umgang mit Ressourcen zuweisen, sind es doch in Wirklichkeit die westlichen Industriestaaten die diese Ressourcen als ihr „Eigentum“ betrachten und dazu selbst korrupte Regierungen für ihre Profitmaximierung missbrauchen.
Literatur
Collier, Paul (2008): Die unterste Milliarde: warum die ärmsten Länder scheitern und was man dagegen tun kann. München: Beck.
Easterly, William Russell (2006): Wir retten die Welt zu Tode . Für ein professionelleres Management im Kampf gegen die Armut. Frankfurt [u.a.]: CampusVerlag.
Nuscheler, Franz (1996): Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. 4. Auflage, Bonn: Dietz.
Nuscheler, Franz (2004): Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik. 5. Auflage, Bonn: Dietz.
Sachs, Jeffrey (2005): Das Ende der Armut. Ein ökonomisches Programm für eine gerechtere Welt. München: Siedler.
Ziegler, Jean (2005): Das Imperium der Schande. Der Kampf gegen Armut und Unterdrückung. München: Bertelsmann.
[...]
- Arbeit zitieren
- MA Markus Scholze (Autor:in), 2011, Exogene vs endogene Ursachen von Unterentwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215663