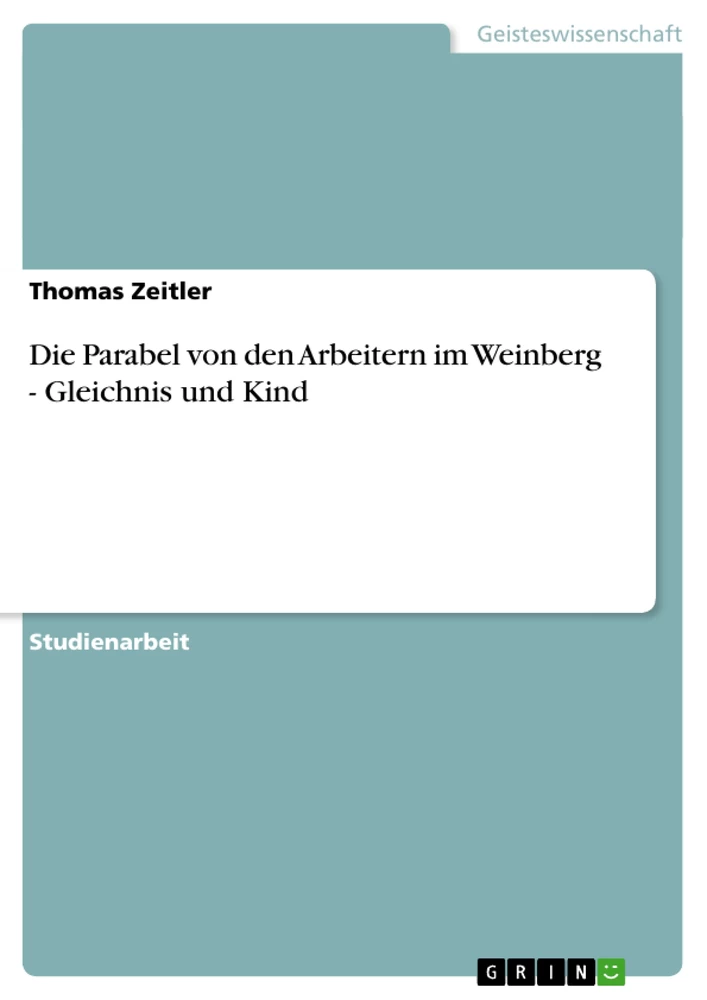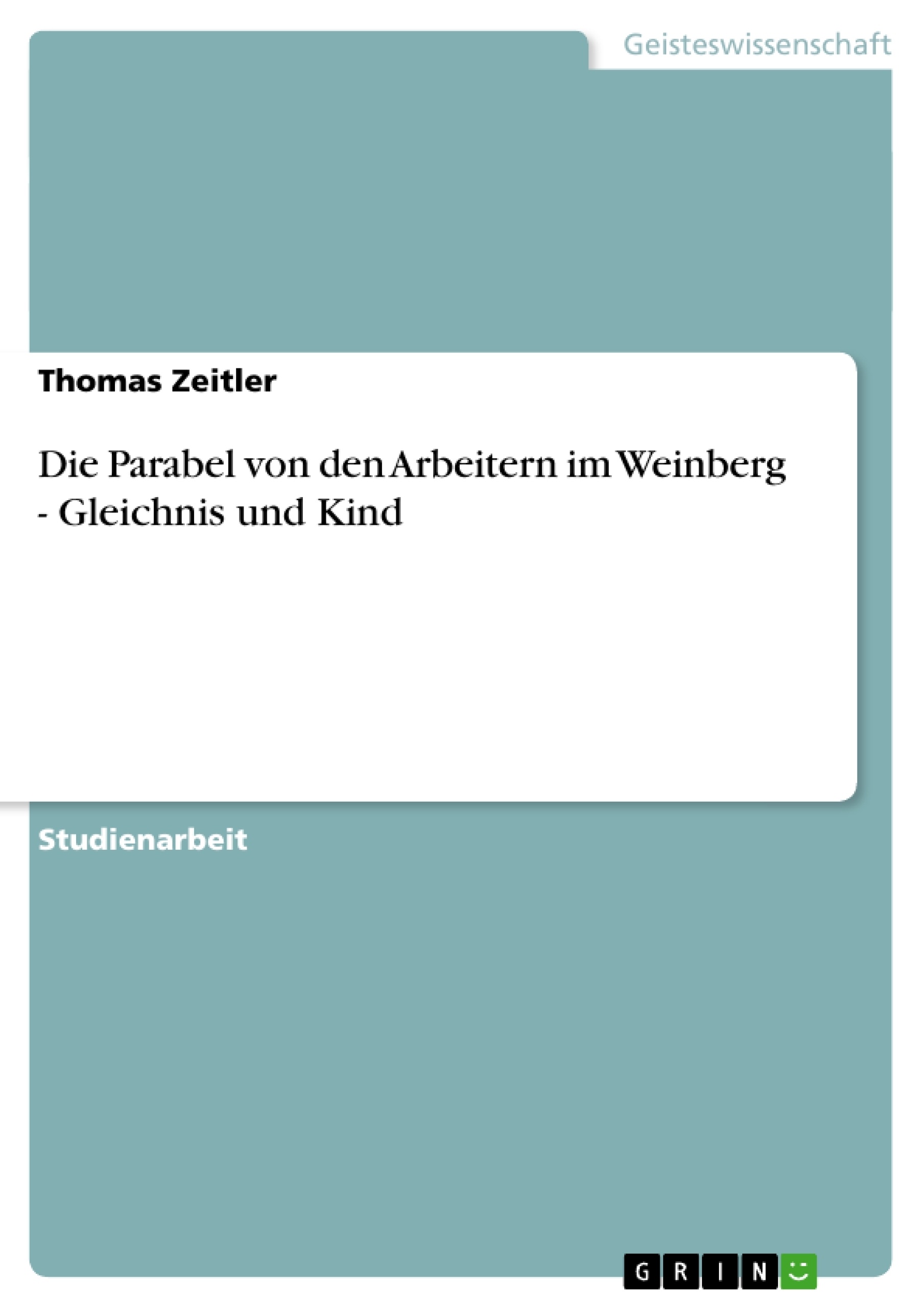Im Neuen Testament, besonders in den synoptischen Erzählungen, gibt es ca. 40 Gleichniserzählungen. Damit verkündet Jesus das Reich Gottes, was zu seiner Zeit eine gängige Methode der Rabbinen war. Den Hörern war dies nicht fremd. Im letzten Jahrhundert haben die Exegesen die Gleichnisse Jesu genauer untersucht und sind bei ihrer Auslegung zu verschiedenen Standpunkten gekommen. Adolf Jülicher spricht von einer Bild- und Sachhälfte der Gleichnisse. Im Vergleichspunkt (tertium comparationis) stimmen sie überein. Aus Erfahrungen können die Hörer und Hörerinnen zustimmen. Joachim Jeremias schreibt: „Gleichnisse sind nur zu verstehen, wenn ihre historische Situation rekonstruiert wird, in die hinein sie gesprochen wurden. Jedes Gleichnis ist also situationsverhaftet. Wohl kann man Bild- und Sachhälfte unterscheiden.“1 So bemerkt Jeremias, dass die Hörer und Hörerinnen zur Zeit Jesu aufgrund der Bildhälfte wussten, um was es geht. Als man später den Hintergrund nicht mehr wusste, fügte man die Sachhälfte mit ein. Das Beispiel von den
Arbeitern des Weinbergs (Mt 20,1-10) reichte den Menschen zu verstehen, dass es bei Jesus nicht um den Lohn geht, was und wie viel jeder gearbeitet hat, sondern um die Güte und die Liebe, die ein wichtiger Bestandteil im Leben der Menschen sind, um ins Reich Gottes zu gelangen. Die neuere Gleichnisforschung, besonders unter Hans Weber, zieht vor, die Gleichnisse Jesu mit Hilfe der Tiefenpsychologie zu deuten. „Hier geht es darum, wie ein Text auf die jeweilige Leserin, den Leser wirkt, inwiefern das Gesagte sich im eigenen Leben wiederfindet und damit für das persönliche deutend und bedeutsam ist.“2 Die Gleichnisse sollen die Erfahrungen des täglichen Lebens wieder spiegeln. So begegnet Paul Ricoeur, dass die Leser
in eine Geschichte verstrickt werden und sie sich meistens selbst darin wieder finden. Dies führt wiederum dazu, dass für die betroffene Person Fragen aufkommen. Gleichnisse darf man aber nicht als abstrakte Wahrheiten herabsetzen, sie „provozieren zur Stellungnahme, zu Zustimmung oder Widerspruch. Sie zielen auf eine ,Umkehr der Einbildungskraft’“3 für die Leser bzw. Leserinnen.
1 Spuren, Arbeitshilfen für einen ganzheitlichen Religionsunterricht an Förderschulen. Jesus bringt die Botschaft
vom Reich Gottes, Bis chöfliches Schulamt der Diözese Rottenburg/Stuttgart und IRP Freiburg, 1996, S. 5
2 Ebd. S. 5
3 Ebd. S. 5
Inhaltsverzeichnis
- Deutungen der Gleichnisse
- Gleichnisse in Schulen
- Stationen der Gleichnisdidaktik
- Gleichnis als Erzählung
- Die symbolische Sprache
- Gleichnis als Metapher
- Gleichnis als Spiel
- Eigene Meinung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Interpretation neutestamentlicher Gleichniserzählungen, insbesondere der Parabel von den Arbeitern im Weinberg. Er analysiert verschiedene Deutungsansätze von Gleichnissen und beleuchtet deren Relevanz im Kontext von Religionspädagogik und Schulunterricht.
- Die historische und theologische Bedeutung von Gleichnissen
- Die Herausforderungen der Gleichnisinterpretation in der Gegenwart
- Die Rolle von Bild und Sachhälfte in der Gleichnisdeutung
- Die Verwendung von Tiefenpsychologie in der Gleichnisanalyse
- Die didaktischen Implikationen von Gleichnissen im Schulunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Deutungen der Gleichnisse
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze zur Interpretation von Gleichnissen im Neuen Testament. Es fokussiert auf die Arbeiten von Adolf Jülicher und Joachim Jeremias, die die Bild- und Sachhälfte der Gleichnisse betonen, sowie auf die neuere Forschung, die Tiefenpsychologische Aspekte einbezieht.
Gleichnisse in Schulen
Das Kapitel diskutiert die Relevanz von Gleichnissen im Schulunterricht und die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen religiösen Entwicklung von Lehrern und Schülern ergeben können. Es wird die Gefahr des Missverständnisses zwischen dem allgemein-religiösen Kontext der Gleichnisse und der phantasievollen Interpretation durch Kinder hervorgehoben.
Stationen der Gleichnisdidaktik
Dieser Abschnitt behandelt die Entwicklung der Gleichnisdidaktik, beginnend mit Adolf Jülichers einflussreichem Werk „Die Gleichnisreden Jesu“. Es werden die Beiträge von Jeremias und Eta Linnemann zur Gleichnisforschung im Kontext von Religionspädagogik und Schulunterricht beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Textes beinhalten: Gleichnisse, Parabel, neutestamentliche Exegese, Jesus, Reich Gottes, Gleichnisdidaktik, Religionspädagogik, Schulunterricht, Tiefenpsychologie, Bild und Sachhälfte, historische Situation, Interpretation.
- Quote paper
- Thomas Zeitler (Author), 2001, Die Parabel von den Arbeitern im Weinberg - Gleichnis und Kind, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21565