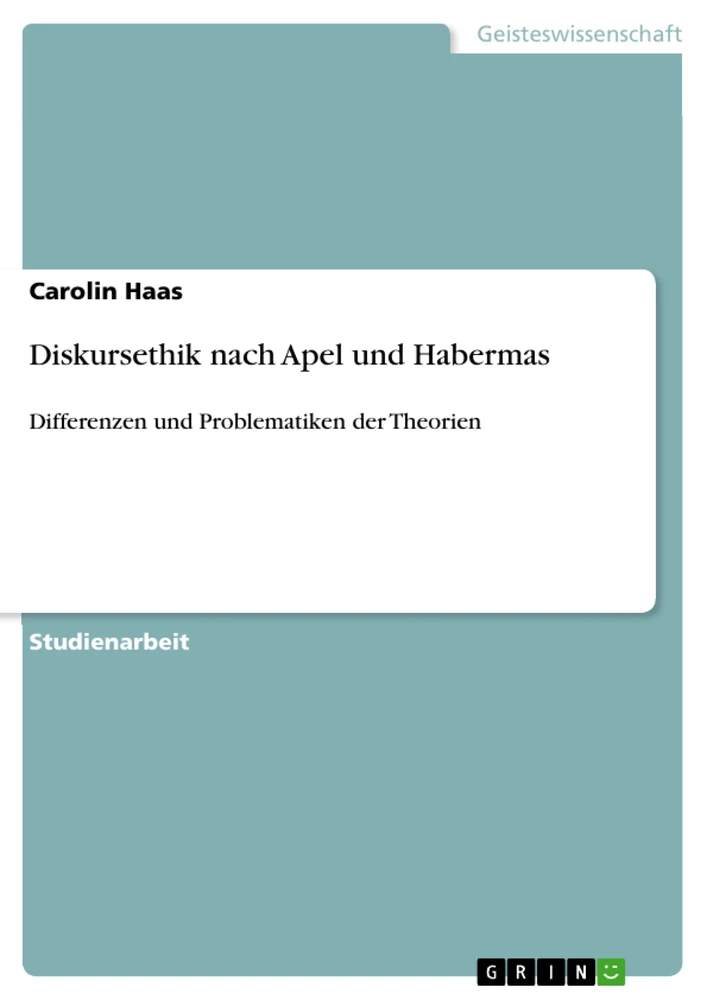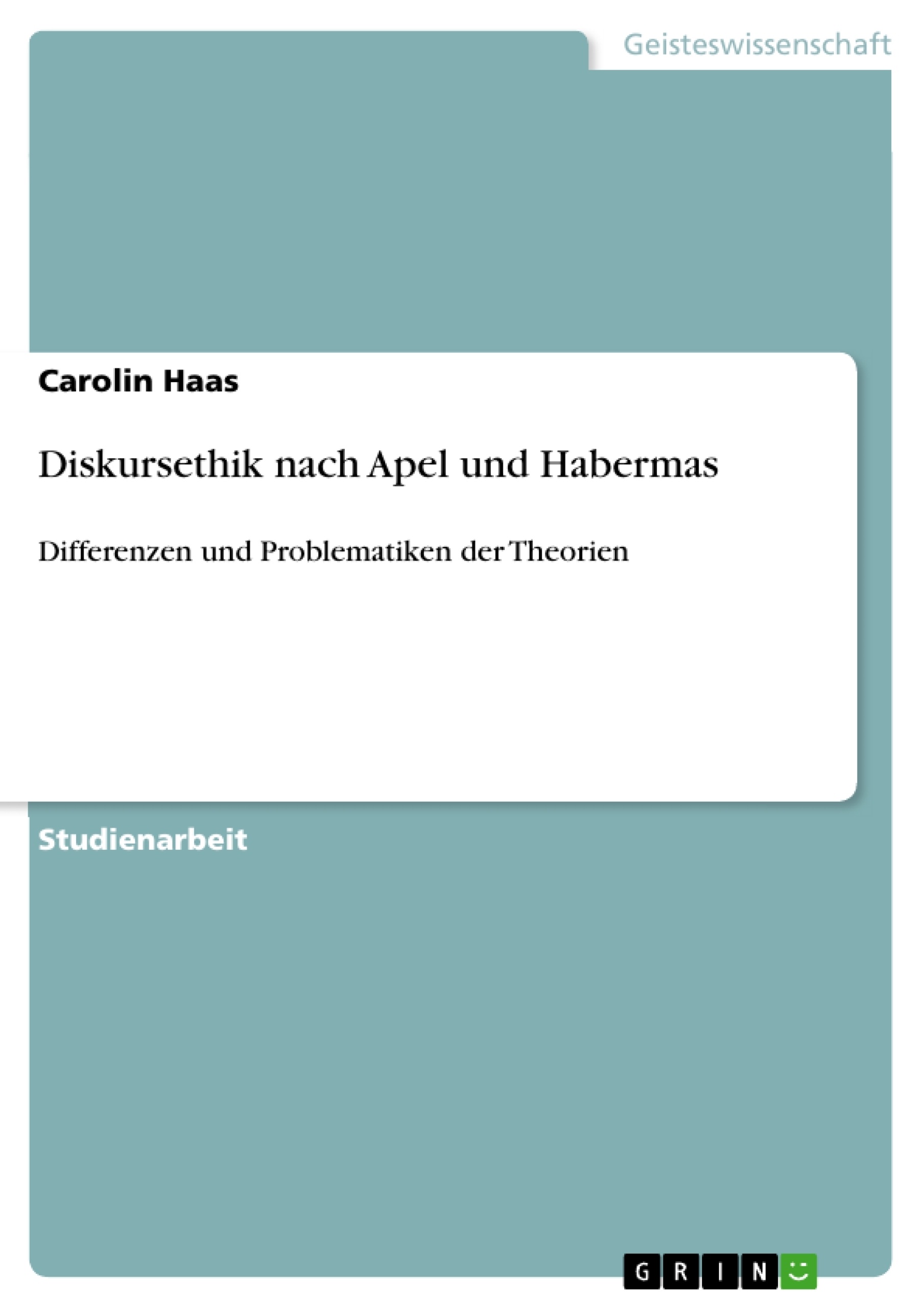Die meisten aktuellen moralischen Probleme wurden in den vergangenen Jahren vornehmend positiv betrachtet und haben nun ungeahnte Bedrohungspotentiale entwickelt. Neuartige, makroethische Probleme wie beispielsweise weltweite technische Innovationen, die Möglichkeiten wie einer In-vitro-Fertilisation oder Abtreibung neu eröffnen, ebenso wie Bereiche der Umweltethik, sprengen die Lösungskapazität traditioneller Moralvorstellungen. Zudem lassen anonyme Massengesellschaften, wie sie heutzutage in Städten vorzufinden sind, keine Instinkt geleitete Ethik mehr zu. Infolgedessen bedürfen diese Problematiken einer neuen ethischen, vernunftgebundenen Klärung .
An dieser Stelle kommt die Diskursethik zum Tragen, die auf eine gleichberechtigte, vernunftgebundene Diskussion von Normen mit einem einvernehmlichen Ergebnis aller Beteiligter zielt . Mit ihrer Hilfe und der konsequenten Befolgung ihrer von Habermas und Apel auferlegten Regeln soll eine Neuformulierung von Normen ermöglicht werden, die für jeden einzelnen Beteiligten akzeptabel ist. Insbesondere in Ethikkommissionen oder politischen Gremien ist die Umsetzung der diskurethischen Prinzipien angesichts der Brisanz der oben aufgeführten globalen Probleme sinnvoll.
Trotz der Aktualität und Dringlichkeit einer Neudefinition bzw. der Notwendigkeit einer Diskussion über moralische Tatbestände, verteidigen die Begründer der Diskursethik teilweise kontroverse Ansichten sowohl für die praktische Umsetzung als auch für die inhaltlichen Aspekte. Fraglich ist demnach, welche konkreten Unterschiede die Theorien aufweisen und welche möglichen Probleme hieraus resultieren können.
Da der kategorische Imperativ nach Kant nicht unerheblich für die Diskursethik ist, wird dieser zunächst im Hinblick auf dessen Bedeutung für die Diskursethik kurz erläutert, um anschließend die allgemeinen Inhalte der Diskursethik aufzugreifen. Im weiteren Verlauf werden die markantesten Differenzen der Theorien aufgezeigt und im Hinblick auf ihre jeweiligen Vor- und Nachteile verglichen. Ziel dieser Arbeit soll nach einer intensiven Abwägung eine Abschätzung darüber sein, wie schwer die jeweiligen Problematiken wiegen und, wenn möglich, welche der beiden Theorien naheliegender bzw. praktikabler ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung in den Seminarkontext
- Aktualität der Diskursethik im globalen Kontext
- Fragestellung
- Bedeutung des kategorischen Imperativs nach Kant für die Diskursethik
- Erläuterungen zur Diskursethik
- Intention und Regeln für praktische Diskurse
- Die Theorie nach Habermas im Vergleich zur Theorie Apels
- Teil B der Diskursethik
- Apels Rechtfertigung zu seiner Ergänzung und Habermas Kritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit der Diskursethik nach Apel und Habermas auseinander. Ziel ist es, die Differenzen und Problematiken der beiden Theorien zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die praktische Umsetzung und die inhaltlichen Aspekte.
- Der kategorische Imperativ nach Kant als Grundlage für die Diskursethik
- Die Regeln und Prinzipien der Diskursethik, insbesondere die Universalisierungsgrundsätze (U) und die ideale Konsensbildung (K)
- Die Kontroversen zwischen den Theorien von Apel und Habermas hinsichtlich der Konsensfindung, der Letztbegründung und der Rolle der Idealität versus Realität
- Die Kritik an Apels "Teil B" der Diskursethik und die Argumentation für dessen Notwendigkeit
- Die Herausforderungen der praktischen Umsetzung der Diskursethik im Kontext globaler Probleme und menschlicher Fehlbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung ordnet die Arbeit in den Kontext der Seminarthematik „Geschichte der Ethik“ ein und beleuchtet die Aktualität der Diskursethik in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt die Fragestellung der Arbeit dar, nämlich die Analyse der Unterschiede und Problematiken der Theorien von Apel und Habermas.
Kapitel 2 erläutert die Bedeutung des kategorischen Imperativs nach Kant für die Diskursethik, indem es auf die Verbindung zwischen Kants Universalisierungsprinzip und dem diskursethischen Grundsatz „D“ hinweist.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den allgemeinen Regeln und Prinzipien der Diskursethik. Es werden die drei Geltungsansprüche der Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit sowie die idealen Diskursbedingungen erläutert. Anschließend werden die Theorien von Apel und Habermas gegenübergestellt und ihre Unterschiede hinsichtlich der Konsensfindung, der Letztbegründung und der Rolle der Idealität versus Realität aufgezeigt. Der Teil B der Diskursethik wird im Detail analysiert, einschließlich der Argumentation Apels für seine Ergänzung und der Kritik Habermas daran.
Schlüsselwörter
Diskursethik, Apel, Habermas, kategorischer Imperativ, Universalisierungsgrundsatz, Konsensbildung, Letztbegründung, Idealität, Realität, Teil B, Moralprinzip, Gerechtigkeit, Menschheitsgeschichte, Fehlbarkeit, Verantwortung.
- Quote paper
- Carolin Haas (Author), 2013, Diskursethik nach Apel und Habermas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215553