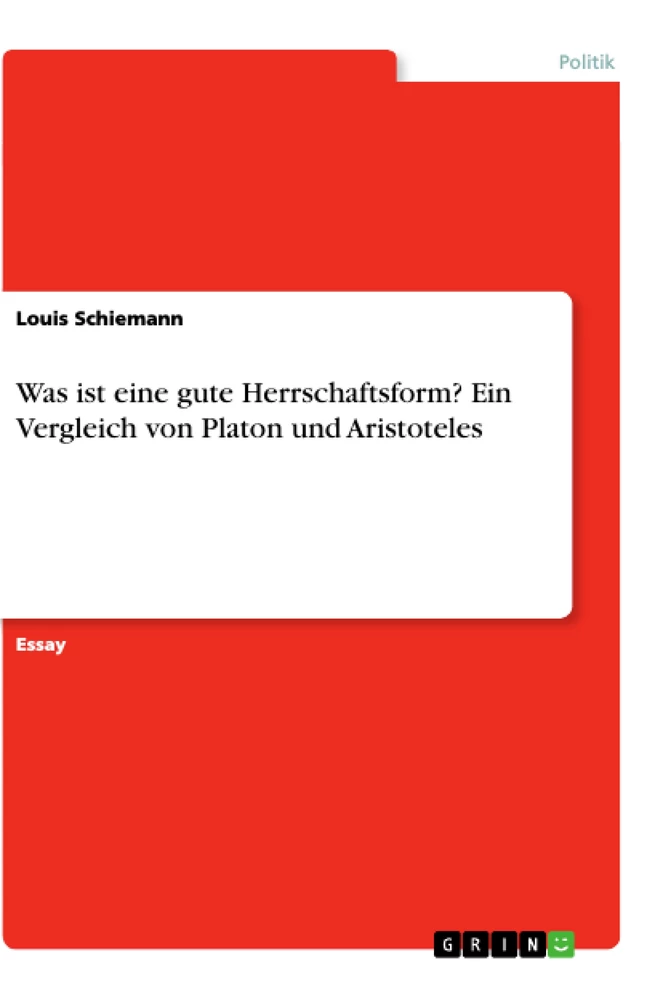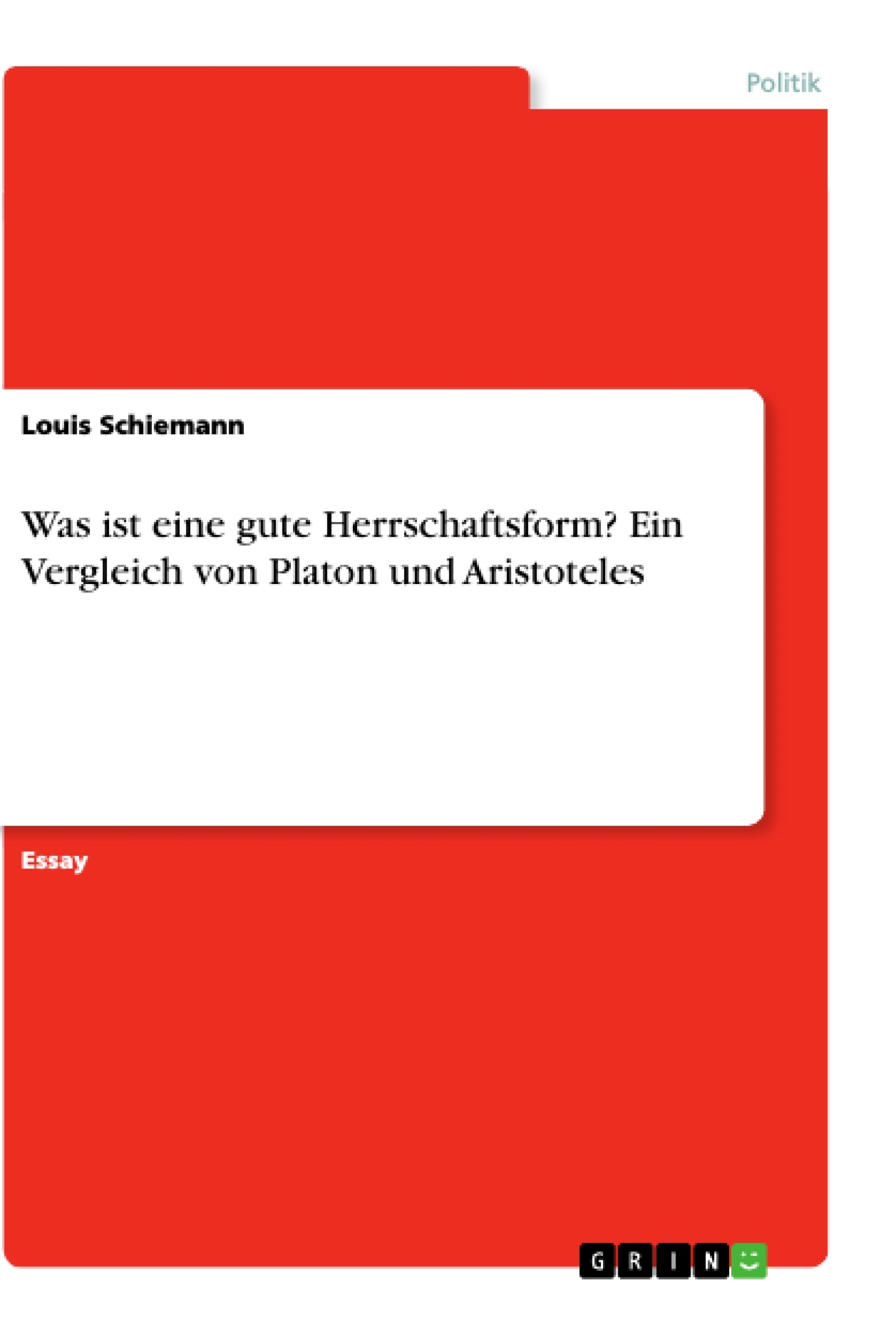In diesem Essay untersuche ich die Thesen von Platon und Aristoteles zu Herrschaftsformen auf die Frage „Was ist eine gute Herrschaftsform?“. Um diese Frage anhand der Autoren zu überprüfen, analysiere ich die Bücher „Politeia“ von Platon und „Politik“ von Aristoteles und vergleiche deren Thesen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Platon und Aristoteles haben verschiedene Auffassungen von einer guten Herrschaftsform. Platon ist ein Verfechter der Philosophenaristokratie, während Aristoteles mehrere Staatsformen für eine mögliche gute Herrschaftsform hält. Auf welchen Begründungen sich diese Aussagen der Autoren stützen, werde ich im Folgenden darstellen.
Einleitung
In diesem Essay untersuche ich die Thesen von Platon und Aristoteles zu Herrschaftsformen auf die Frage „Was ist eine gute Herrschaftsform?“. Um diese Frage anhand der Autoren zu überprüfen, analysiere ich die Bücher „Politeia“ von Platon und „Politik“ von Aristoteles und vergleiche deren Thesen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Platon und Aristoteles haben verschiedene Auffassungen von einer guten Herrschaftsform. Platon ist ein Verfechter der Philosophenaristokratie, während Aristoteles mehrere Staatsformen für eine mögliche gute Herrschaftsform hält. Auf welchen Begründungen sich diese Aussagen der Autoren stützen, werde ich im Folgenden darstellen.
Die Polis
Platon und Aristoteles haben leicht unterschiedliche Auffassungen von dem Aufbau der damals vorhandenen Polis, bzw. der Gemeinschaftsform. Platon fokussiert seine Darstellungen der Polis auf die Stellung der Philosophen und deren Arbeit. Er erklärt, dass der Ruf und die Philosophie selbst unter dem Einfluss der Menschen leide, die keine „wahren“ Philosophen seien, aber „vorgeben, ihr zu dienen!“ (Platon 385 v. Chr.: 489a-d). Durch die Überzeugung Platons, die Philosophie sei das höchstes Ziel eines Menschen, bezeichnet er gleichzeitig die Meisten als unbrauchbar und verdorben für die Philosophie (vgl. Platon 385 v. Chr.: 490c-419b). Die wahren Philosophen, die dessen würdig sind, müssten sich entweder verstecken, um sich von der verdorbenen Gesellschaft zu schützen (vgl. Platon 385 v. Chr.: 496a-497a) oder sie würden einsam in der Gesellschaft leben und diese hassen. Sie fühlen sich „über die engen Verhältnisse erhaben und verachte[n] sie“ (Platon 385 v. Chr.: 496a-497a). Zum Schluss kommt Platon zu dem Ergebnis, dass keine der vorhandenen Verfassungen der Philosophen würdig sei (vgl. Platon 385 v. Chr.: 497a-d). Während sich Platon bei der Betrachtung der Polis auf den Zustand der Philosophie konzentriert und die Zustände der Gesellschaft nicht genauer analysiert, macht Aristoteles dazu detaillierte und differenziertere Aussagen. Aristoteles definiert zunächst woher der Staat kommt und welchen Zweck er hat. Dabei sagt er, dass das staatliche Gemeinwesen von Natur aus bestehe, da der Mensch von Natur aus ein Wesen sei, das nach staatlichen Rahmen strebe (vgl. Aristoteles ca. 345-325 v. Chr.: 1252 b 26). Die Polis entsteht durch zwei Faktoren: Der erste ist der Fortpflanzungstrieb, der Männer und Frauen gegenseitig anzieht. Der zweite ist, dass Menschen von Natur aus unterschiedliche Begabungen haben und sich dadurch in Herrscher und Sklaven unterscheiden (vgl. Höffe 2007: 38). Aristoteles spricht dabei von vorhandenen Wechselbeziehungen zwischen Mann und Frau, Hausherr und Sklave und Vater und Sohn (vgl. Höffe 2007: 40). Wesen, die nicht in einer Gemeinschaft leben können, bezeichnet er als Tiere oder Götter (vgl. Aristoteles ca. 345-325 v. Chr.: 1253 a 15). Aristoteles beschreibt die Rolle der Frau in der Gesellschaft in soweit, dass die diese von Sklaven zu unterscheiden sei (vgl. Aristoteles ca. 345-325 v. Chr.: 1252 a 17). Gleichzeitig akzeptiert er mit dieser Aussage die Sklaverei. Während Platon als höchstes Gut die Philosophie definiert, differenziert Aristoteles die verschiedenen „Tugenden“ des Menschen und die damit verbundenen Aufgaben und Ämter. Die Tugend eines „guten Bürgers“ ist es, dass er ein guter Untertan gegenüber seinem Herrscher sei, gleichzeitig müsse er ein guter Herrscher für seinen Sklaven sein (vgl. Aristoteles ca. 345-325 v. Chr.: 1276 b 37). Die Tugend eines Fürsten wird von Aristoteles mit Klugheit bezeichnet, die dieser zum maßvollen Herrschen seiner Untertanen braucht (vgl. Aristoteles ca. 345-325 v. Chr.: 1277 b 11). Ein weiterer Punkt, in dem Aristoteles die Überlegungen von Platon weiter ausführt ist die Definition von drei öffentlichen Gewalten. Während Platon die drei Stände in der Philosophenherrschaft aufzählt, definiert Aristoteles des Weiteren die drei öffentlichen Gewalten: Die beratende Instanz, die Exekutive und die Rechtsprechung (vgl. Höffe 2007: 42). Diese haben große Ähnlichkeit mit den heute vertretenen Gewalten eines Staates, der Judikativen, der Legislativen und der Exekutiven.
[...]
- Quote paper
- Louis Schiemann (Author), 2013, Was ist eine gute Herrschaftsform? Ein Vergleich von Platon und Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215537