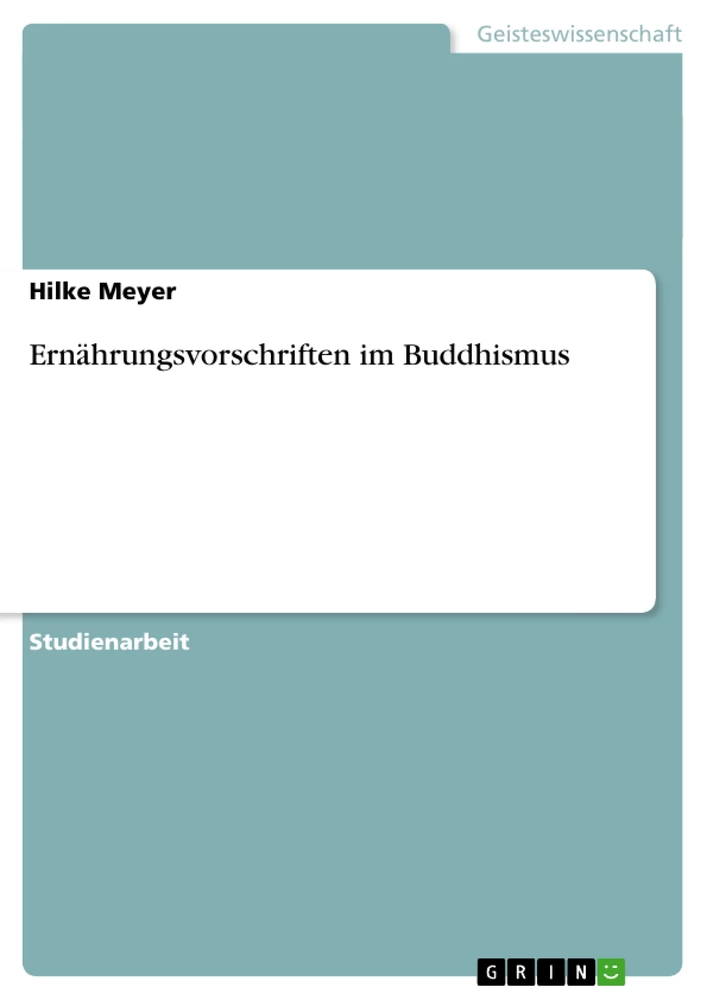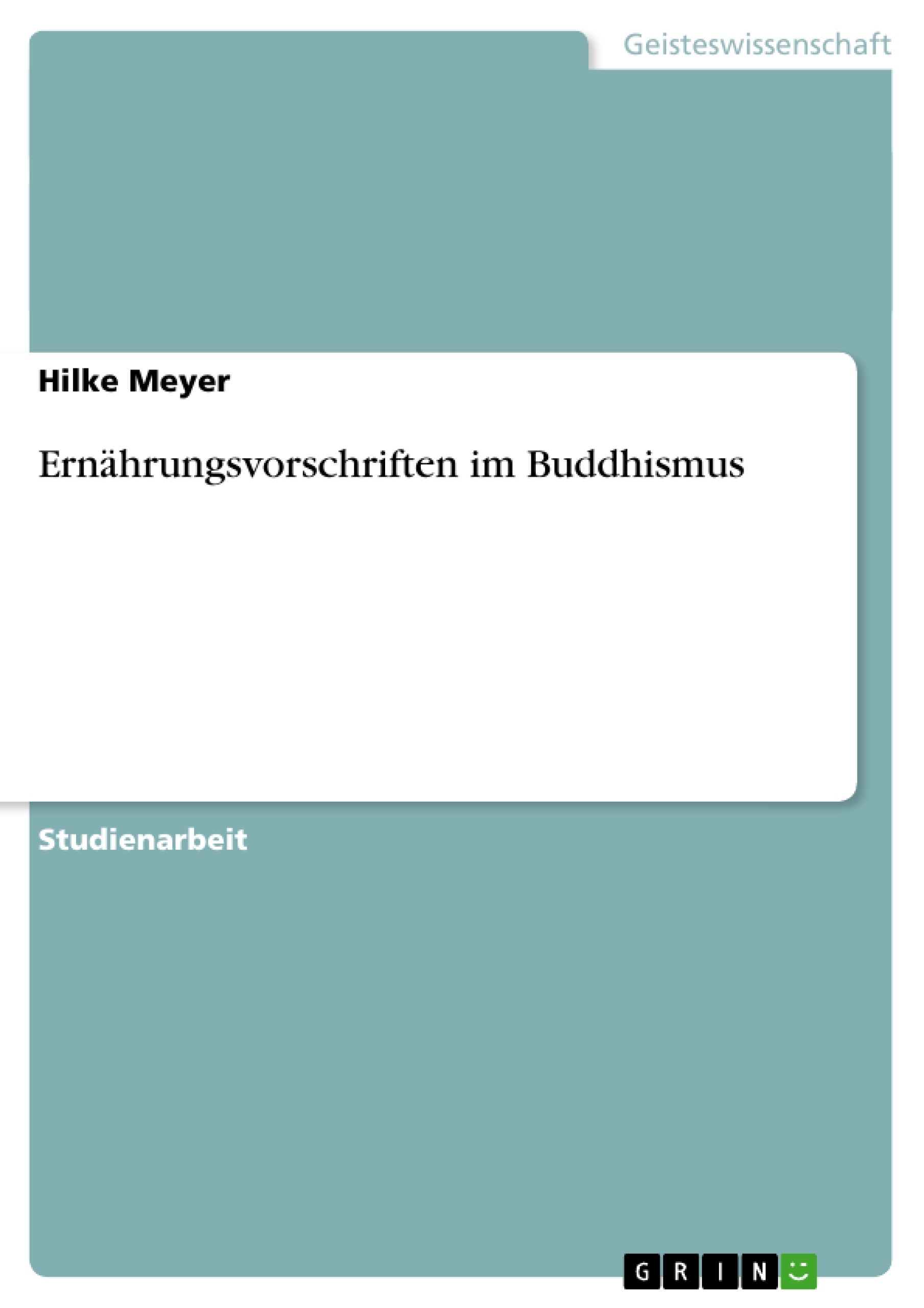Eine der größten Vorurteile gegenüber dem buddhistischen Glauben, ist die Annahme, dass überzeugte Buddhisten und Ordensangehörige kein Fleisch verzehren. Der Vegetarismus gehört zur Tradition und ist eines der typischen Eigenschaften des chinesischen Buddhismus. Die Ordensregeln verbieten allerdings nicht Fleisch zu essen.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Vegetarismus der Buddhisten und den verschiedenen Motivationen, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Darüber hinaus gibt sie einen Einblick in den gegenwärtigen Buddhismus, denn auch hier wird das Thema Fleischverzehr stark diskutiert.
Inhalt
1. Einleitung
2. Fleischverzehr ja – Tiertötung: nein.
3. Askese
4. Fleischtabus
5. Gesellschaftliche Auswirkungen
6. Buddhismus in der Gegenwart
7. Fazit
Literaturverzeichnis:
1. Einleitung
Eine der größten Vorurteile gegenüber dem buddhistischen Glauben, ist die Annahme, dass überzeugte Buddhisten und Ordensangehörige kein Fleisch verzehren. Der Vegetarismus gehört zur Tradition und ist eines der typischen Eigenschaften des chinesischen Buddhismus. Die Ordensregeln verbieten allerdings nicht Fleisch zu essen.[1]
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Vegetarismus der Buddhisten und den verschiedenen Motivationen, auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Darüber hinaus gibt sie einen Einblick in den gegenwärtigen Buddhismus, denn auch hier wird das Thema Fleischverzehr stark diskutiert.
2. Fleischverzehr ja – Tiertötung: nein.
Buddhisten, Nonnen und auch Laien verpflichteten sich dazu keine lebenden Wesen zu töten, somit auch keine Tiere. Eine fleischlose Ernährung hingegen ist nicht vorgeschrieben, somit isst die Mehrzahl der Buddhisten Fleisch und Fisch. Dies gilt zumindest für die Buddhisten aus den Gebieten Burma, Sri Lanka oder Thailand. Streng vegetarisch hingegen leben Mönche, Nonnen sowie Laien aus Taiwan.[2]
In den normierten Ordensregeln der Vinaya, die die Verhaltensvorschriften für Mönche und Nonnen enthalten, werden demnach keine Bedenken gegen den Verzehr von Fleisch und Fisch erbracht. In volkstümlichen Geschichten, die so genannten Jatakas, wird Fleisch sogar zu festlichen Anläsen serviert. Allerding gilt, zum Beispiel die Jagd im Königshaus, als unmoralisch, da sie Anlass zur direkten Tötung ist.[3]
Ein Vorläufer des Buddhismus sind die vedischen Religionen. Tieropfer waren hier von großer Bedeutung und auch das Fleisch wurde anschließend verzehrt. Vedische Inder aßen sogar Rindfleisch. Diese Religion fürchtete allerdings die Vorstellung, dass getötete Tiere sich im Jenseits rächen würden. Diese Annahme hatten sie ebenfalls bei Bäumen, Kräutern und Wasser. Die Anhänger der vedischen Religion wussten die Rache der getöteten Lebewesen jedoch durch Rituale wie – Wegsehen bei einer Tötung und vermeiden der Wörter die man in jenem Kontext gebraucht – zu vermeiden. Eine Frage die man sich stellen könnte wäre: Wie kann sich ein Anhänger dieser Religion ernähren ohne zu töten, wenn alles belebt ist? Zum Beispiel durch wildwachsende Wurzeln oder Früchte, sowie Raubtierbäutereste und Almosenspeisen. Wobei die „Speise-Reste-Lösung“ nur dann funktioniert, wenn andere die Aufgabe des Tötens übernehmen. Der Buddhismus übernimmt aus diesen Ansätzen, dass Mönche und Nonnen von Speisen die andere zubereitet haben, leben sollen. Die buddhistische Praxis hat sich somit für einen deutlich lockereren Weg entschieden. Die Belebtheit und das Empfinden von Pflanzen werden verdrängt.[4]
Der Verzehr von Fleisch ist weiterhin „[…]an drei Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung das Fleisch im Sinne des Ordenrechts als `rein` qualifiziert. Daher spricht man in der Sprache des Vinaya vom `dreifach reinen Fleisch`, dessen Verzehr unbedenklich ist“.[5] Reines Fleisch ist jenes, bei dem der Mönch oder die Nonne, nicht gesehen, nicht gehört oder keinen Grund zur Annahme hat, dass das Fleisch von einem Tier stammt, welches explizit für ihn oder sie getötet wurde. Im Fokus steht demnach, die „Entkopplung von Verzehr und Tötung“[6], um der Rache der getöteten Tiere aus dem Jenseits zu entgehen. Wichtig für buddhistische Ordensangehörige ist die Vergewisserung, dass sie nicht der Grund für den Schmerz und letztlich den Tod des Tieres sind. Diese Regelung lässt sich jedoch im Prātimoksasūtra – hier handelt es sich um die älteste Schicht der Vinaya Schriften – nicht wieder finden. Aufgeführt wird hier lediglich, dass Mönche und Nonnen Fleisch nicht erbitten dürfen. Sollte das Fleisch hingegen aus den Resten eines Familienessens stammen, so muss es angenommen werden.[7]
Es bleibt festzuhalten, dass im früheren Buddhismus der Fleischverzehr, für Mönche und Nonnen grundsätzlich, nicht verboten war, solange sie durch ihren Verzerr nicht mitverantwortlich für die Tötung des Tieres waren. Auch die Frage danach, ob ein Mönch mitverantwortlich für den Tod eines Tieres ist, wenn er veranlasst, dass Fleisch für ihn gekauft wird, lässt sich mit einem „Nein“ beantworten. Der Mönch hat bezüglich der Auswirkung die sein Konsum hat, keine Mitschuld am Tod des Tieres. In den Mahānsānghika – Texten zeigt sich allerdings eine Zurückhaltung auch in Bezug auf gekauftes Fleisch. In den verschiedenen Texten ließen sich weiterhin mehrere Motive feststellen, auf Grund dessen Buddhisten - obwohl kein ausdrückliches Verbot existiert – auf Fleisch verzichten.[8]
[...]
[1] Oliver Freiberger und Christoph Kleine: Buddhismus. Handbuch und kritische Einführung. Göttingen 2011, S. 476.
[2] Lambert Schmithausen: Essen ohne zu töten. Zur Frage von Fleischverzehr und Vegetarismus im Buddhismus. In: Die Religionen und das Essen, hrsg. Von Perry Schmidt-Leukel. München 2000, S. 144.
[3] Ebd.
[4] Schmithausen: Essen ohne zu töten, S. 145.
[5] Freiberger/Kleine: Buddhismus, S. 146.
[6] Ebd.
[7] Ebd.
[8] Ebd.
- Quote paper
- Hilke Meyer (Author), 2013, Ernährungsvorschriften im Buddhismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215376