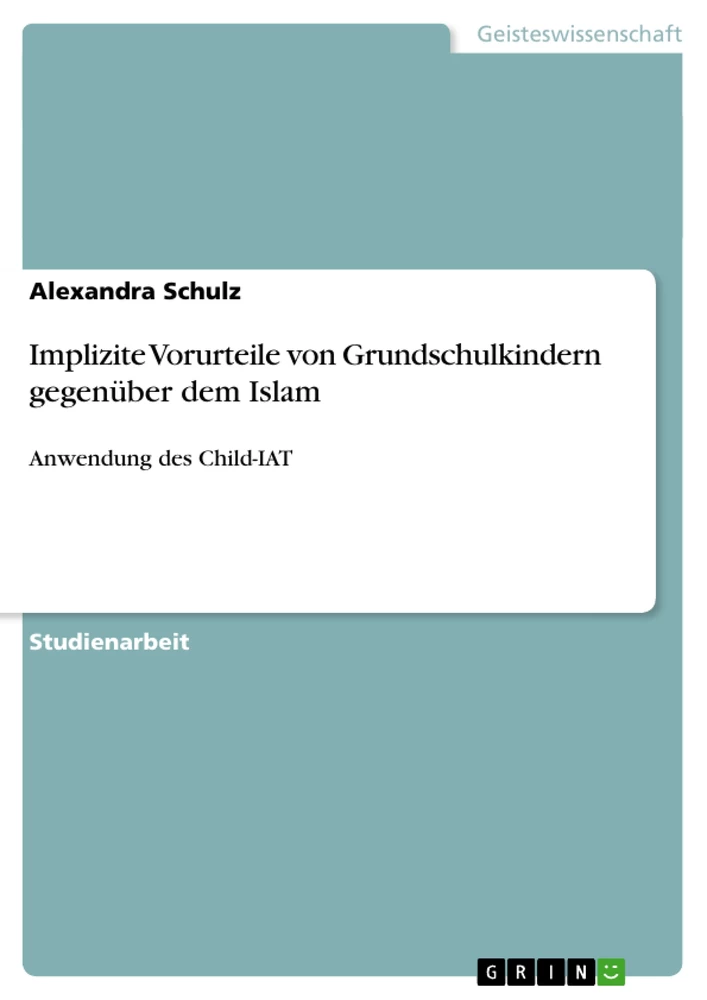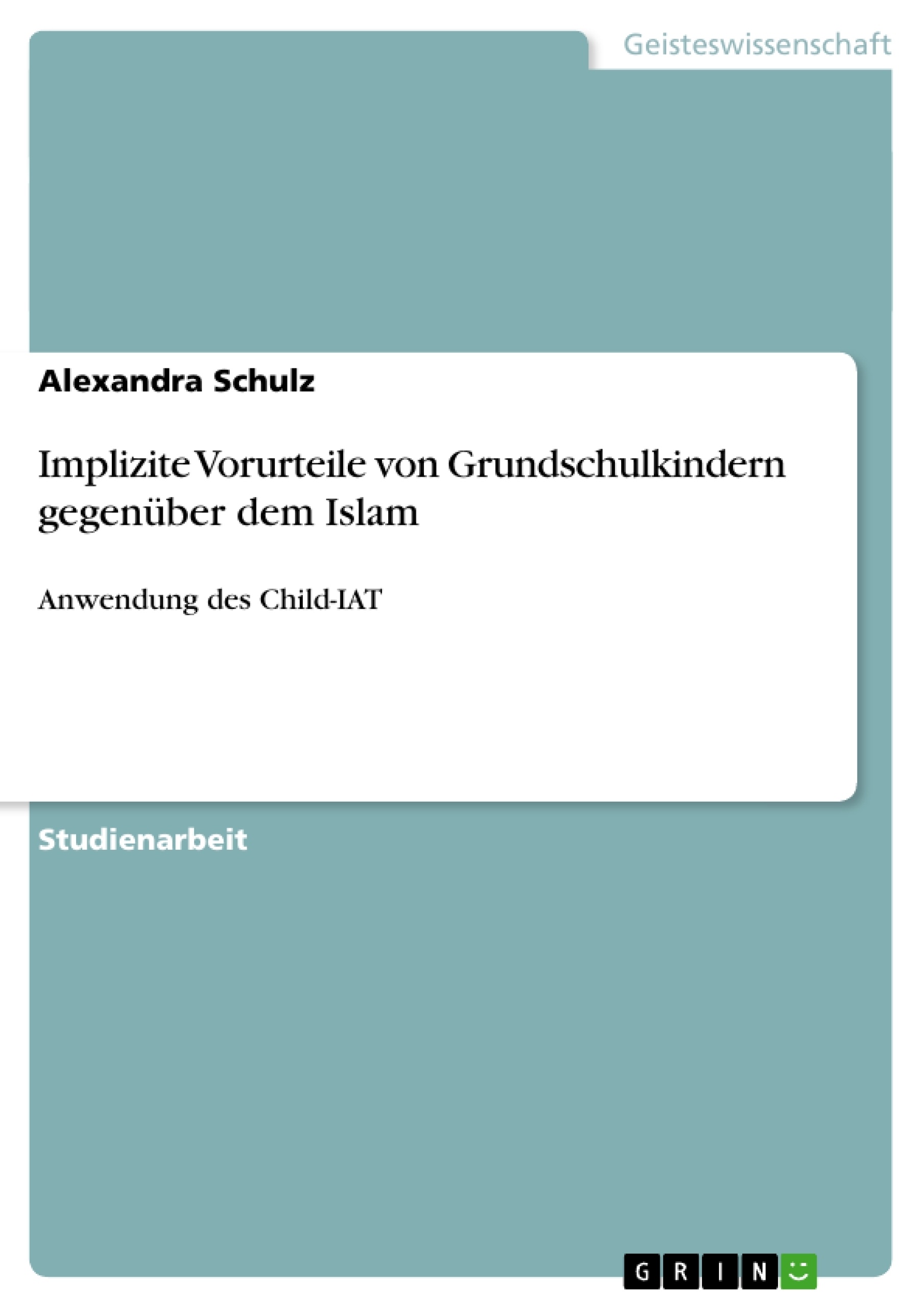Die Erforschung impliziter Vorurteile bei Kindern stellte bisher aufgrund mangelnder
impliziter Messverfahren eine große Herausforderung dar. Durch die Modifikation des weit
verbreiteten impliziten Assoziationstests (IAT; Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) ist es
nun auch möglich unbewusste Einstellungen von Kindern ab dem Alter von 4 Jahren zu untersuchen.
Anlass der geplanten Studie ist die zunehmende Entwicklung von Islamophobie
und die damit einhergehenden Vorurteile gegenüber Moslems in Deutschland. Deutschland
schafft sich also neue Feindbilder - die Moslems und der Islam. In einem Experiment soll
untersucht werden, ob bereits auch Kinder im Grundschulalter religionsbezogene, implizite
Vorurteile gegenüber dem Islam besitzen und inwiefern, die Etablierung von islamischen Religionsunterricht
darauf Einfluss nehmen kann. Es wird erwartet, dass islamischer Religionsunterricht
als Möglichkeit der präventiven Aufklärung dazu beiträgt Vorurteilen vorzubeugen
und eine bessere Basis für den Austausch zwischen Moslems und Deutschen zu schaffen. Abschließend
werden Probleme des Einsatzes impliziter Messverfahren und deren Ergebnisinterpretation
diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
Abstract 1
Abstract 2
Einführung
Hypothesen und Zielsetzung
Methode
Versuchsablauf
Impliziter Assoziationstest für Kinder
Erwartete Ergebnisse
Diskussion
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1. Kinder-IAT
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1. Verwendete Stimuliitems
Abstract 1
Die Erforschung impliziter Vorurteile bei Kindern stellte bisher aufgrund mangelnder impliziter Messverfahren eine große Herausforderung dar. Durch die Modifikation des weit verbreiteten impliziten Assoziationstests (IAT; Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) ist es nun auch möglich unbewusste Einstellungen von Kindern ab dem Alter von 4 Jahren zu untersuchen. Anlass der geplanten Studie ist die zunehmende Entwicklung von Islamophobie und die damit einhergehenden Vorurteile gegenüber Moslems in Deutschland. Deutschland schafft sich also neue Feindbilder - die Moslems und der Islam. In einem Experiment soll untersucht werden, ob bereits auch Kinder im Grundschulalter religionsbezogene, implizite Vorurteile gegenüber dem Islam besitzen und inwiefern, die Etablierung von islamischen Religionsunterricht darauf Einfluss nehmen kann. Es wird erwartet, dass islamischer Religionsunterricht als Möglichkeit der präventiven Aufklärung dazu beiträgt Vorurteilen vorzubeugen und eine bessere Basis für den Austausch zwischen Moslems und Deutschen zu schaffen. Abschließend werden Probleme des Einsatzes impliziter Messverfahren und deren Ergebnisinterpretation diskutiert.
Schlüsselworte
Impliziter Assoziationstest (für Kinder), Vorurteile, Islamophobie
Abstract 2
Einführung
In der Sozialpsychologie werden Vorurteile als ungerechtfertigte, sehr stabile und für gewöhnlich negative Einstellungen gegenüber anderen Personen oder Gruppen, insbesondere Minderheiten verstanden (Samson, 1999; zitiert nach Brown, 2010), die sich auf Merkmale wie die ethnische Herkunft, das Geschlecht oder die Religionszugehörigkeit beziehen können. Als ein funktionaler Aspekt von Abgrenzungsprozessen gegenüber Fremdgruppen (Young-Bruehl, 1996) dienen Vorurteile als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Stereotypen, die auf vermuteten Eigenschaften von Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit basieren. Vorurteile und Stereotype fördern die Entstehung von Rassismus und sozialer Diskriminierung, worunter Güttler (2003) die negative sowohl auch positive Unterschiede in der Behandlung von Menschen versteht, ohne dass ihre individuellen Eigenschaften und Vorzüge berücksichtigt werden.
Der Besitz von Vorurteilen geht nicht automatisch damit einher sie auch zu äußern. Die psychologische Forschung unterscheidet zwischen expliziten und impliziten Vorurteilen (Aronson, Wilkert & Akert, 2008) wobei letztere, anders als explizite, nicht bewusst zugänglich und kognitiv kontrollierbar sind (Cvencek, Meltzhoff & Greenwald, 2011). Inwieweit implizite Vorurteile das Verhalten von Personen bewusst beeinflussen ist in der Forschung nicht gänzlich geklärt. Hinweise deuten darauf, dass sie besonders in unkontrollierten Erlebniszuständen wie Nervosität Ausdruck finden und somit nicht aufgrund der Einhaltung sozial erwünschter Normen verhindert werden können (Dovidio, Gartner & Kawakami, 2002).
Die wissenschaftliche Vorurteilsforschung der letzten Jahre begründet sich auf die stetige Zunahme der Fremdenfeindlichkeit (Weins, 2000). Ein wichtiger Einwand an dieser Stelle sei, dass die Entwicklung von rassistischen Vorurteilen kein primär deutsches Gesellschaftsproblem darstellt (Weins, 2000). Dennoch sollte gerade Deutschland aufgrund seiner historischen Vergangenheit und den antisemitischen Verbrechen der Nationalsozialisten dieser Thematik besondere Bedeutung beimessen.
An aktueller Brisanz gewinnt die wissenschaftliche Auseinandersetzung dadurch, dass Deutschland sich scheinbar ein neues Feindbild schafft - die Moslems und der Islam. Eine bedeutende Rolle in der Entstehung der scheinbar wachsenden Islamophobie spielen dabei die Terroranschläge des 11. September 2001 und Ehrenmorde (Pollack, 2008). Etliche populistische Bücher mit Anti-Islam Parolen erschienen in den Bestsellerlisten und berichteten über die Gefahr der Enteignung christlicher Werte (Pollack, 2008). Die vorliegende Fragestellung möchte daher überprüfen, ob sich tatsächlich implizite islamophobische Vorurteile in der Gesellschaft nachweisen lassen.
Im Zuge politischer Integrationsbemühungen wird zunehmend versucht eine bessere Basis für den Austausch zwischen Moslems und Deutschen zu schaffen. Ein Ansatz ist die Piloteinführung von islamischen Religionsunterricht an Grundschulen, mit dem Fokus der Aufklärung und Abgrenzung des Islams vom Islamismus, um somit den Ängsten der Bevölkerung präventiv zu entgegnen. An diesem Punkt möchte das vorliegende Untersuchungsvorhaben anknüpfen und die bisherige, ausschließlich erwachsenorientierte Vorurteilsforschung damit erweitern implizite Vorurteile bei Kindern näher zu betrachten. Es gibt Hinweise dafür, dass implizite Einstellungen hinsichtlich der Merkmale Geschlecht und ethnischer Identität bereits bei Kindern ab dem 4. Lebensjahr feststellbar sind (Cvencek et al., 2010, 2011; Dunham, Baron & Banaji, 2007). Daher ist davon auszugehen, dass beim Vorliegen kollektiver Vorurteile gegenüber dem Islam, auch Kinder Denkweisen zu diesem Thema übernehmen und entwickeln.
Hypothesen und Zielsetzung
Bis heute wurde in der sozialpsychologischen Forschung keine Studie an Grundschulkindern durchgeführt, in der mithilfe eines impliziten Messverfahrens die Ausprägung religiöser Vorurteile untersucht wird. Die vorliegende Studie möchte die Schlussfolgerungen der genannten Analysen experimentell validieren und die Hypothese überprüfen, dass bereits Grundschulkinder implizite Vorurteile gegenüber dem Islam besitzen. Zudem weisen aktuelle Befunde auf die Möglichkeit hin, dass Vorurteile durch die Erhöhung gemeinsamer Interaktionen von Eigen- und Fremdgruppe (Oskamp, 2000) reduziert werden können. Daher testen wir in der Analyse, ob sich islamischer Religionsunterricht als soziale Interaktionsplattform zwischen Deutschen und Moslems positiv, im Sinne von abträglich auf die Entwicklung impliziter Vorurteile bei Grundschulkindern im Vergleich zu Kindern ohne islamischen Religionsunterricht auswirkt. Da sich implizite Vorurteile aufgrund der fehlenden bewussten Zugänglichkeit im Vergleich zu expliziten, nicht durch Messinstrumente wie Fragebögen erfassen lassen, wird zur Hypothesenprüfung der implizite Assoziationstest für Kinder (Child-IAT; Cvencek et. al, 2011) verwendet. Dieses Paradigma basiert auf dem IAT für Erwachsene (Greenwald et al., 1998) und wurde bereits mehrmals validiert (Rutland, Cameron, Milne & McGeorge, 2005; Dunham et al., 2007). Modifikationen wurden insofern vorgenommen, dass die Trialanzahl innerhalb der IAT-Blockstruktur verringert wurde, um Ermüdungseffekten bei den Kindern vorzubeugen.
Der manipulierte Faktor ist das Vorhandensein oder Fehlen von islamischen Religionsunterricht. Eine Hälfte der Stichprobe besucht den Religionsunterricht, die anderen Kinder erhalten zum Ausgleich Sportunterricht. Bei letzterem wird angenommen, dass die Entwicklung impliziter Religionsvorurteile unbeeinflusst bleibt.
Methode
Die zu untersuchende geschlechtsheterogene Stichprobe von Kindern soll aus einer deutschen Grundschule rekrutiert werden, in welcher die Einführung von fakultativem, islamischen Religionsunterricht bereits stattgefunden hat. Voraussetzung ist, dass kein weiterer Religionsunterricht an der Schule angeboten wird. Die Ausschlusskriterien werden vor Beginn der Studie durch Kontaktaufnahme zu den Eltern der Kinder kontrolliert. An der Studie nehmen lediglich gesunde Kinder teil (gemäß der Aussage der Eltern) die einer christlichen Konfession angehören. Vor erstmaligem Beginn des islamischen Religionsunterrichts werden die Kinder randomisiert einer der beiden Untersuchungsbedingungen zugeordnet (SPO = Sportunterricht oder REL = Religionsunterricht).
Versuchsablauf
Die implizite Vorurteilsmessung wird zweimalig individuell (vor Beginn des Religionsunterrichts = Zeit 1 und nach einem Zeitintervall von einem Jahr = Zeit 2) durchgeführt. Jede Testung beginnt mit einer Einleitungsphase in der sich die Kinder mit der Testapparatur vertraut machen können. Die Kinder werden informiert, dass sie ein Computerspiel spielen werden, indem sie Worte hören und sehen. Anschließend sollen sie einen Knopf drücken um zu sagen, um welches Wort es sich handelt.
Impliziter Assoziationstest für Kinder
Das Verfahren beruht auf einer computergestützten Diskriminationsaufgabe,
bei der die Stimuli zweier Dimensionen so schnell wie möglich kategorisiert werden sollen (Gawronski & Conrey, 2004). Zudem wird eine evaluative Entscheidungsaufgabe vorgegeben, in welcher positive und negative Stimuli den Kategorien zugeordnet werden müssen. Ziel des Verfahrens ist demnach die Messung der Assoziationsstärke zwischen zwei Konzepten (Islam, Christentum) und deren Attribute (negativ, positiv).
[...]
- Citar trabajo
- Cand. M.Sc. Psych. Alexandra Schulz (Autor), 2011, Implizite Vorurteile von Grundschulkindern gegenüber dem Islam, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215277