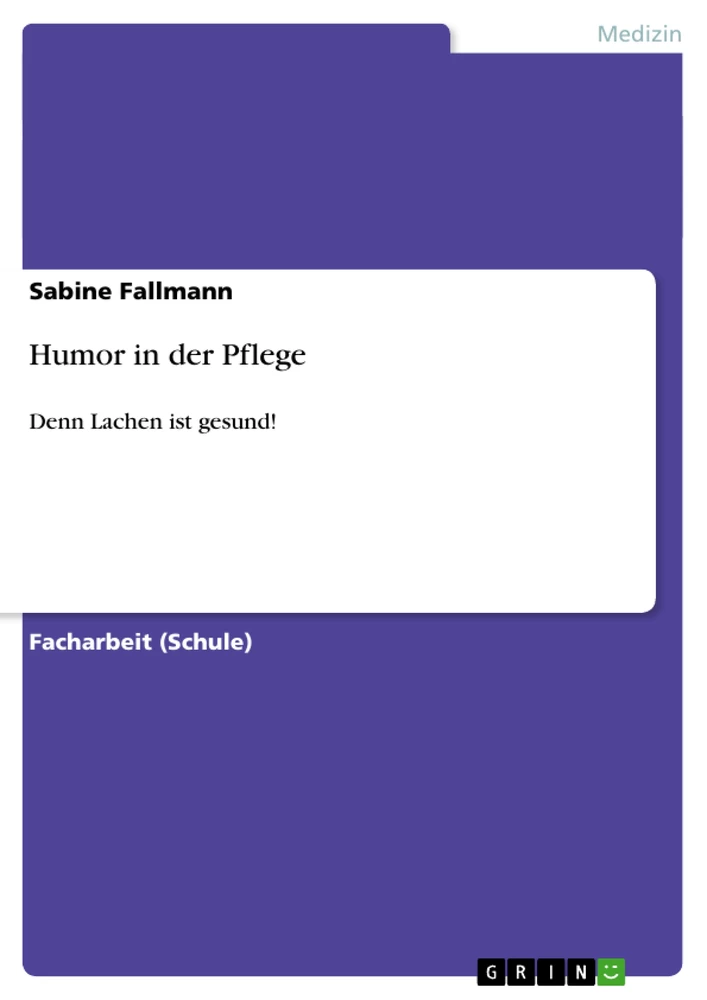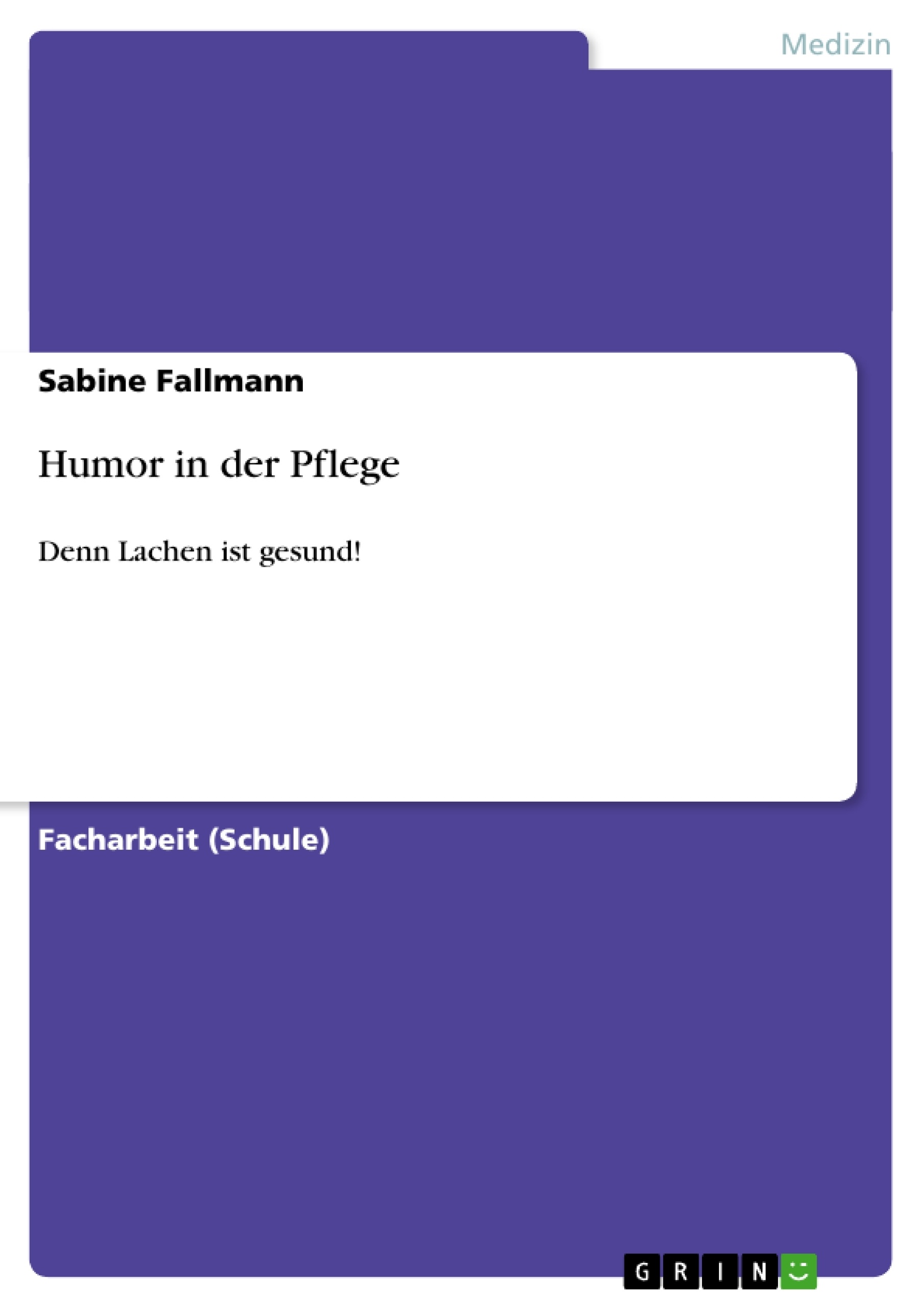Da diese Fachbereichsarbeit über Humor in der Pflege handelt, wurden verschiedene Wirkungen, positive als auch negative, physische als auch psychische, von Humor und Lachen beschrieben und näher auf diese eingegangen. Außerdem wurde der evolutionären Bedeutung und der Entwicklung von Humor und Lachen in der Pflege auf den Grund gegangen.
Nachdem Humor ein wichtiges Element in der Pflege ist, wurden auch Hilfen bei der Anwendung von Humor in der Pflege wie z.B. Voraussetzungen, Interventionsbeispiele und Ziele von Humor aufgezeigt.
Über dies hinaus wurden auf etliche Lachtherapien eingegangen, mit dem Hauptaugenmerk auf Clowns wie z.B. CliniClowns, Gericlowns und Psychiatry Clowns.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung in die Problemdarstellung
2 Definitionen
2.1 Humor
2.1.1 Indirekter Humor
2.1.2 Direkter Humor
2.1.3 Humortheorien
2.2 Witz
2.3 Lachen
2.4 Heiterkeit
2.5 Gelotologie
3 Warum Lachen wir?
3.1 Evolutionäre Bedeutung von Lachen
3.2 Verschiedene Theorien von Lachen
3.3 Entwicklung von Humor in der Pflege
4 Auswirkungen von Humor und Lachen
4.1 Physiologische Wirkungen
4.1.1 Herz
4.1.2 Lunge
4.1.3 Skelettmuskeln
4.1.4 Gehirn
4.1.5 Tränen
4.1.6 Blut
4.1.7 Darm
4.2 Psychologische und emotionale Wirkungen
4.3 Soziologische Auswirkungen
4.4 Unerwünschte Wirkungen
5 Lachtherapie
5.1 Verschiedene Arten der Lachtherapie
5.2 Clowns
5.2.1 CliniClowns
5.2.2 Gericlowns
5.2.3 Psychiatry Clowns
5.3 Umsetzung in die Pflege
5.3.1 Voraussetzung
5.3.2 Interventionsbeispiele
5.3.3 Ziel von Humor in der Pflege
6 Zusammenfassende Darstellung
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
Anhang 1 : Standard für „Humor und Lachen in der Pflege"
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Eine Humorvolle Situation
Abb. 2: Comic „Tiere"
Abb. 3: Comic „Schlaganfall"
Abb. 4: Comic „Pflege"
Abb. 5: Comic „Krankenhauserlebnisse"
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung in die Problemdarstellung
Im Volksmund hört man oft „Lachen ist Gesund" oder „Lachen ist die beste Medizin", aber stimmt das wirklich? Mit dieser Fachbereichsarbeit möchte ich versuchen diese Frage zu beantworten.
Ein Vorreiter in Sachen Humor ist Dr. Patch Adams. Er entdeckte bereits 1971, dass Patienten schneller genesen, wenn sie öfter lachen.[1]
Ziel dieser Arbeit ist es zu verdeutlichen, dass Humor viele positive Effekte auslösen kann. Außerdem versuche ich aufzuzeigen, dass Humor auch in der Gesund- heits- und Krankenpflege eingesetzt werden kann.
Deshalb versuche ich in dieser Fachbereichsarbeit, folgende Fragen zu beantworten:
- Warum lachen wir eigentlich?
- Auswirkungen von Lachen und der physiologische Vorgang.
- Wann kann man Humor in der Betreuung und Pflege von Patienten gezielt einsetzten, auf was sollte man achten, was sollte man gar vermeiden?
- Lachtherapie, was ist das? Wie kann ich Lachen in die Pflege einbeziehen? Welche Lachtherapien gibt es? Dabei wird auf die CliniClowns näher eingegangen.
Da eine Facharbeit eine Literaturarbeit ist, habe ich zu Beginn im Internet und über verschiedene Suchmaschinen recherchiert. Weiteres erfolgte eine Ermittlung in Bibliotheken, Buchhandlungen und in Fachzeitschriften. Die Orientierung stützte sich auf dem Schneeballsystem, die das Inhaltsverzeichnis und ein Querlesen umfasste.
2 Definitionen
„Was ist Humor und was nicht? Diese Frage mag auf den ersten Blick leicht zu beantworten sein, denn Humor kennt ja jeder. Und doch macht vielleicht erst der Versuch einer Beschreibung deutlich, wie vielgestaltig, bunt, abwechslungsreich und nahezu unbezwingbar sich dieses Phänomen einer allumfassenden Definition entzieht."[2]
„Humor zu umschreiben ist eine denkbar humorlose Angelegenheit, mehr nochHumor ist offenbar genau das, was abhanden kommt, wenn er definiert werden soll.“[3]
2.1 Humor
Die Definition von Humor hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert.[4] Um diesen Unterschied aufzuweisen hat die Autorin zwei verschiedene Definitionen angeführt.
„Umor (lat.) bedeutet Feuchtigkeit oder Flüssigkeit. „Humores" wurden, basierend auf der Lehre des römischen Arztes Gallen, die Körpersäfte genannt und dem menschlichen Temperament zugeordnet."[5]
Humor wird auch als warmherzige oder auch wohlwollende Heiterkeit bezeichnet. Humor erhielt durch die englischen Humoristen seine eigentliche Bedeutung als besondere Anschauungs- und Darstellungsweise des Komischen.[6]
Um sich unter dem Begriff „Humor" mehr vorstellen zu können, werden nun einige verschiedene Arten von Humor näher aufgezeigt:
2.1.1 Indirekter Humor
Humor und Lachen wird in Form von verschiedenen Utensilien ermöglicht und unterstützt, z.B. Comics, Filme, Bücher, Humortagebuch, Lachkoffer usw.
Humor und humorvolle Anregungen sind mittels verschiedener Hilfsmittel jederzeit zugänglich diese können nach individuellen Bedürfnissen genutzt werden.[7]
2.1.2 Direkter Humor
Humor wird von der initiierenden Person durch verbale oder nonverbale Kommunikation, z.B. durch Wortspiele, Scherzen oder Augenzwinkern gefördert.
Humor soll in der persönlichen Kommunikation erlebt und angewandt werden können.[8]
2.1.3 Humortheorien
Das Phänomen Humor ist sehr komplex. Dies wird auch an den fünf von der Autorin ausgewählten Humortheorien - der Überlegenheitstheorie, der Diskrepanztheorie, der Spieltheorie, den Entlastungs- und Befreiungstheorien sowie den sozialen Theorien des Humors - deutlich. Diese Theorien widersprechen sich nicht, sie stellen vielmehr den Versuch dar, den Humor aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Die Überlegenheits-, die Diskrepanz- und die Spieltheorie beleuchten das Wesen des Humors, wohingegen sich die Entlastungs- und Befreiungstheorien und die sozialen Theorien mit dem Zweck des Humors auseinandersetzen.[9]
2.1.3.1 Die Überlegenheitstheorie
Die Überlegenheitstheorie geht davon aus, dass wir über das Versagen, das Pech oder die Unterlegenheit anderer lachen, um unsere Überlegenheit zu demonstrieren. Diese Spielart des Humors ist oft Ausdruck einer gewissen Aggression. Dazu werden Ironie, Sarkasmus und Zynismus gezählt.[10]
2.1.3.2 Die Diskrepanztheorie
Die Diskrepanztheorie geht davon aus, dass etwas Überraschendes, Unerwartetes passieren muss, um das Phänomen Humor hervorzurufen. Dabei liegt eine Diskrepanz oder auch Inkongruenz zwischen bestehenden Vorstellungen und Erwartungen von etwas, was sich ereignen wird, um dem tatsächlich „sich Ereignendem" vor.[11] Zum Beispiel:
Eine ältere Dame, Diabetikerin, geht in ein Café und bestellt beim Ober: „Ein Kännchen Kaffe, bitte."
Der Ober fragt nach: „Mit Milch und Zucker?", worauf die Dame antwortet: „Nur mit Milch, Zucker habe ich selber".[12]
2.1.3.3 Die Spieltheorie
Die Spieltheorie geht davon aus, dass Humor immer auch ein spielerisches Element beinhaltet. Sie sieht beide, den Humor und auch das Spiel als eine Form zwischen menschlicher Kommunikation, für die sowohl ein spontaner als auch ein wohlüberlegter Moment charakteristisch ist.[13]
2.1.3.4 Die Entlastungs- und Befreiungstheorie
Die Entlastungs- und Befreiungstheorien gehen davon aus, dass Humor Ängste, Spannungen oder Frustrationen vermindern kann. Diese Entlastung kann auf kognitiver Ebene und/ oder auf emotionaler Ebene stattfinden. Wichtigster Vertreter dieses Konzepts ist Sigmund Freud. Er vertritt die Meinung, dass das, worüber wir lachen, auf unsere Probleme und verdrängten unbewussten Konflikte hinweist. Das Lachen ist für ihn eine gesunde Form, mit diesen Problemen umzugehen.[14]
2.1.3.5 Die sozialen Theorien des Humors
Die sozialen Theorien des Humors gehen davon aus, dass der Humor eine sozial verbindende Komponente besitzt. Dies macht sich innerhalb einer Gruppe durch eine Stärkung des Solidaritäts- und Kohäsionsgefühls bemerkbar.'[15] Eine Kohäsion ist die Summe aller Kräfte von außen, die auf jedes einzelne Gruppenmitglied wirkt und es an die Gruppe bindet.[16]
So bemerken z.B. Titze und Eschenröder, dass „Im gemeinsamen Lachen eine starke emotionale Nähe zwischen den einzelnen Mitgliedern herstellt, aus der ein vergnügliches Wir- Gefühl entsteht, das die Gruppenkohäsion festigt." Demzufolge hat Humor also die Wirkung die Zusammengehörigkeit einer Gruppe zu festigen.[17]
2.2 Witz
Witz heißt „Wissen, Verstand" (vom althochdeutschen Wort wizzi „Wissen"). Im 17. Jahrhundert wurde daraus das „Talent zum geistreichen Formulieren". Heute versteht man unter Witz hauptsächlich eine pointierte, sehr kurze mündliche Erzählung die Gelächter erregt.[18]
2.3 Lachen
Lachen ist eine offenbar angeborene, zumeist willkürliche mimische Ausdrucksbewegung des Menschen bei heiterer oder freudiger Stimmung. Kinder lächeln durchschnittlich bereits ab dem 3. Lebensmonat, meist im Blickkontakt mit der Mutter. Das Lachen spiegelt, z.B. als gefühlloses, ironisches, gemütvolles, verzweifeltes, kokettes Lachen, Gemüts- und Charakterwerte.
Die Psychiatrie unterscheidet bei Erkrankungen der Nervenbahnen und bei Psychosen einerseits triebartiges Lachen als Lachzwang, andererseits sardonisches Lachen, begleitet von Gesichtsverzerrungen, und hysterisches Lachen als Lach- krampf.[19]
2.4 Heiterkeit
Heiterkeit kann man als einen Zustand beschreiben, der durch einen vorhergehenden, mehr oder minder biochemischen oder physiologischen bzw. neurologischen, emotionalen und unbewussten und mit Lachen verbundenen Vorgang im Gehirn hervorgerufen wird. Bei Dingen, die uns erheitern und in eine gute Stimmung versetzen, werden so genannte Glückshormone freigesetzt, die unsere Stimmung wiederum nachhaltig verbessern. Heiterkeit kann sowohl die Grundlage als auch das Ziel humoristischer Interventionen und Haltungen sein. Heiterkeit, Freude und Fröhlichkeit sind ein wesentliches Element der Entstehung menschlicher Motivation und Antriebskraft.[20]
2.5 Gelotologie
Gelotologie ist die Wissenschaft vom Lachen.
Den Anstoß dazu gab Erich Kästner schon vor Jahrzehnten durch seine- so wie er sie nannte- „Lachkunde“. Dies regte die Errichtung eines Zweiges der Wissenshaft an. In den letzten Jahren entwickelt sich in den USA die Gelotologie.[21] Ihre Studien beweisen die heilsame Kraft des Lachens.[22]
Siegel schrieb dazu: „Der Gelotologe Fry geht in seinem Forschungsbericht über die „Physiologie des Humors" davon aus, dass das Humorvolle einer Situation mit den folgenden drei Komponenten beschrieben werden kann: einem Stimulus, einer emotionalen Reaktion und einem Begleitverhalten.
Abb. 1: Eine Humorvolle Situation[23]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3 Warum Lachen wir?
3.1 Evolutionäre Bedeutung von Lachen
Humor ereignet sich auf allen Lebenswegen, in allen Gesellschaften und Kulturen. Lachen, ist ein möglicher Ausdruck von Heiterkeit, es bedeutet Mensch- Sein. Es ist ein sehr natürliches und biologisch- physiologisches Phänomen. Die Weltliteratur ist voll von Komödien, die Menschen zum Lachen anregen. Karikaturen als visueller Ausdruck von Humor wurden sogar in Höhlenmalereien gefunden.[24]
In der Frühzeit seiner Evolution verfügte der Mensch nur über ein rudimentäres Sprachvermögen. Die Spezies Homo habilis, der bereits einfache Werkzeuge benutzende Urahne von uns heutigen Menschen, besaß vor rund zwei Millionen Jahren mit rund sechs- bis siebenhundert Kubikzentimetern Hirnmasse etwa die Hälfte dessen, was dem modernen Homo sapiens an grauen Zellen zur Verfügung steht. Das reichte nicht für ausgefeilte Dialoge, wohl aber für Körpersignale und einfache Zurufe: Knirschen, Knurren, Fauchen und eben auch Lachen. Die moderne Anthropologie zählt deshalb Lächeln und Lachen zu den ältesten und wichtigsten Formen der Kommunikation, ein universell verständliches Zeichen, über das alle Menschen verfügen, dass weltweit alle Menschen verstehen.[25]
Der anerkannte Emotionsforscher und Professor für Psychologie Paul Ekman, führte in Kalifornien an der Universität von San Francisco, ein Experiment im Zusammenhang mit Emotionen durch. Ekman wies je eine Gruppe von Männern und Frauen an, sich in einer Distanz von hundert Metern voneinander aufzustellen. Gruppe A musste eine ganze Reihe emotionale Regungen darstellen: Weinen, grimmig Blicken, Zähnefletschen, Lächeln und Lachen. Gruppe B sollte bestimmen, welche Emotionen gezeigt wurden. Weil das auf diese Entfernung nicht möglich war, ließ er beide Gruppen schrittweise aufeinander zugehen und das Experiment so lange wiederholen, bis eine eindeutige Aussage gelang.[26]
Mit erstaunlichem Ergebnis, denn bereits bei neunzig Metern registrierten die Gruppen, dass Personen der gegenüberliegenden Gruppe lachten, während andere Regungen nicht erkannt wurden. Keine andere emotionale Äußerung können wir aus so großer Distanz erkennen. Aus diesem Experiment wurde erkennbar, dass wir keine andere emotionale Äußerung aus so großer Distanz erkennen können.[27]
Eine Entfernung von neunzig Metern ist deutlich weiter als der weiteste Speerwurf eines frühzeitlichen Jägers und damit ein ausreichender Fluchtvorsprung. Unsere in Savannen und Tundren lebenden Vorfahren konnten demnach bei einem Zusammentreffen mit einer ihnen fremden Horde aus sicherer Distanz abwägen, ob sie aufeinander zugehen oder ihren Speer griffbereit halten sollten. Für jede dieser Alternativen war die bereits aus großer Entfernung erkennbare Mimik entscheidend: Lachten sich die Anführer an, signalisierten sie ihre friedliche Haltung. Denn Lächeln und Lachen sind Friedensgesten. Lachen enthält eine elementar, für unsere Urahnen wie für uns geltende Information: Wer lacht, entspannt die Kiefermuskulatur, ein kräftiges Zubeißen ist während des Lachen unmöglich. „Du musst vor mir keine Angst haben, ich will dir nichts Böses, von mir geht keine Gefahr aus" hat schon in grauer Vorzeit jede Lachbotschaft bedeutet.[28]
Lachen ist das effektivste, über zigtausend Generationen weitergegebene, vertrauensbildende Signal zwischen Menschen. Deshalb sind wir wie vor hunderttausend Jahren einem freundlich lachenden Gesicht mehr zugeneigt als einem miesepeterigen. Dahinter steht das tief in unserer Erfahrung verankerte „Urwissen" des Lachens als Friedenssignal.[29]
Wenn wir mit einem Fremden kommunizieren und dabei lächeln, geben und bekommen wir einen Vorschuss an Vertrauen. Weil Vertrauen für das Überleben sehr wichtig ist, verfügen wir über ein hoch sensibles Sensorium, das sehr genau ein authentisches Lachen von einem gekünstelten unterscheiden kann. Ohne ganz genau und bewusst zu wissen, woran wir echtes Lachen erkennen, nehmen wir es an seinem Klang wie an der Mimik wahr.[30]
3.2 Verschiedene Theorien von Lachen
Bereits Sigmund Freud versuchte dem Lachen auf den Grund zu gehen und entwickelte dabei drei Haupttheorien warum wir lachen:[31]
1. Die erste Theorie beschreibt das Lachen aus Überlegenheit. Der Theorie zufolge versucht der Lachende mit seinen Lachen den Gesprächspartner oder jemand anderen, der vor ihm steht, zu beherrschen, also ein machtbewusstes Lachen aus einer Position der Überlegenheit.[32]
2. Die zweite Theorie beschäftigt sich mit dem ungebührlichen Lachen. Ihr zufolge lacht eine Person grundsätzlich dann, wenn sie etwas wahrnimmt, das nicht in die normale natürliche oder gesellschaftliche Ordnung passt.[33]
3. Bei der dritten Theorie handelt es sich um die sogenannte „relief theory" Freuds, die Theorie der Entspannung oder des Sich- etwas- Ersparens, nach der sich der Lachende durch sein Lachen Verhaltensweisen erspart, die für ihn sowohl in der Form ihrer Äußerung als auch wegen ihrer Gründe und Motive relativ schwierig auszudrücken wären.[34]
3.3 Entwicklung von Humor in der Pflege
Humor zeigt sich auch in sehr tragischen Momenten, bei Krankheit, im Angesicht des Todes und sogar in Kriegen. Lachen hat auch einen Gegenpol, die Tränen. Diese Beiden Mechanismen, sind sozusagen die im Körper eingebauten Zeichen für Erleichterung.[35]
In der Pflegewelt kennen wir Humor seit den Zeiten von Florence Nightingale. Ein Beispiel aus ihrer Arbeit im Krimkrieg kann dies darlegen: Als Reaktion auf die schrecklichen Zustände während des Krieges und in den Krankenhäusern im Kriegsgebiet schrieb sie an den britischen Kriegsminister: „Es gibt so viel Ungeziefer hier. Wenn all die Käfer wollten, könnten sie die unendlich langen Bettenreihen auf den Rücken schnallen und in einer endlos langen Reihe direkt zu Ihnen ins Kriegsdepartement tragen." So könnte diese Aussage, als erster dokumentierter Gebrauch von Galgenhumor in der Pflege gedeutet werden.[36]
Als Nightingale 1860 den ersten Berufslehrgang für Pflegefachpersonen aufbaute, fügte sie im Pflichtenheft an, dass die professionell Pflegenden geduldig, heiter und freundlich sein sollten.[37]
In den nachfolgenden Jahrzehnten, als der Versuch unternommen wurde, die Pflege zu einer respektierten und ersthaften Profession zu machen, wurde Humor wieder zurückgedrängt. Pflegefachpersonen wurden nicht nur dazu angehalten, sondern geradezu sozialisiert, nicht zu lachen. Der therapeutische Wert von Humor wurde nicht wahrgenommen und vom Gesundheitssystem auch nicht genehmigt. Aus dieser Zeit gibt es kaum Dokumente, die Humor thematisieren. Aber wir wissen dennoch, dass Humor präsent war, denn es gibt viele persönliche Erinnerungen und mündliche Überlieferungen über den Gebrauch von Humor, der angesichts des Realitätsschocks und der Stränge nicht ausblieb.[38]
Ein anderer Grund für die jahrelange Verbannung von Humor aus dem Gesundheitssystem mag der Humorstil sein, der in einschlägigen Kreisen gepflegt wurde. Er ist oft rauh, verletzend, gallig und beißend, beispielsweise der makabre Humor, der als typisch medizinischer Humor bekannt ist. Die Natur von Humor ist eben, dass sich Lustiges immer im Zusammenhang mit der jeweiligen Situation ergibt, und dieser Zusammenhang ist oft im Gesundheitswesen von Stress, Krankheit, nackten Körpern, Exkrementen, Blut, invasiven Prozeduren, Trauma, Behinderung und Tod geprägt. Natürlich bieten diese Situationen auch einen Nährboden für den Missbrauch von Humor.[39]
In den 1960ern hat sich die Situation entscheidend verändert und Forscher begannen die körperlichen und psychischen Auswirkungen des Lachens zu untersuchen. Inzwischen gibt es schon die Wissenschaft vom Lachen- die Gelotologie, sowie Lachtherapien, Lachseminare und Lachklubs.[40]
[...]
[1] vgl. Kreichgauer, 2010
[2] Siegel, 2005, S.17
[3] Johannes Gruntz- Stoll in Siegel, 2005, S.17
[4] vgl. Ehms, 2008, S.3
[5] Bremmer/ Roodenburg, 1999, zit. Bischofberger, 2008, S. 34
[6] vgl. Duden, 1996, S. 1551
[7] vgl. Bischofberger, 2008, S. 76
[8] vgl. Bischofberger, 2008, S. 76
[9] vgl. Siegel, 2005, S. 21
[10] vgl. Siegel, 2005, S. 22
[11] vgl. Siegel, 2005, S. 22
[12] vgl. Siegel, 2005, S. 22
[13] vgl. Siegel, 2005, S. 22
[14] vgl. Siegel, 2005, S. 22
[15] vgl. Siegel, 2005, S. 21
[16] vgl. Jacoby, 2003
[17] vgl. Siegel, 2005, S. 23
[18] vgl. Duden, 1996, S. 3860
[19] vgl. Bertelsmann Lexikon, 1982, S. 74
[20] vgl. Effinger, 2008, S. 34
[21] vgl. Titze, 2007, S. 242
[22] vgl. Kienzl, 2005, S. 19
[23] Siegel, 2005, S. 20
[24] vgl. Bischofberge, 2008, S. 21
[25] vgl. Uber & Steiner, 2006, S. 23
[26] vgl. Uber & Steiner, 2004, S. 16
[27] vgl. Uber & Steiner, 2004, S. 17
[28] vgl. Uber & Steiner, 2004, S. 17
[29] vgl. Uber & Steiner, 2004, S. 20
[30] vgl. Uber & Steiner, 2004, S. 20
[31] vgl. Le Goff, 2004, S. 28
[32] vgl. Le Goff, 2004, S. 28
[33] vgl. Le Goff, 2004, S. 29
[34] vgl. Le Goff, 2004, S. 29
[35] vgl. Bischofberger, 2008, S. 21
[36] vgl. Bischofberger, 2008, S. 21
[37] vgl. Bischofberger, 2008, S. 22
[38] vgl. Bischofberger, 2008, S. 22
[39] vgl. Bischofberger, 2008, S. 22
[40] vgl. Springer Medizin, 2007
- Quote paper
- Sabine Fallmann (Author), 2011, Humor in der Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215235