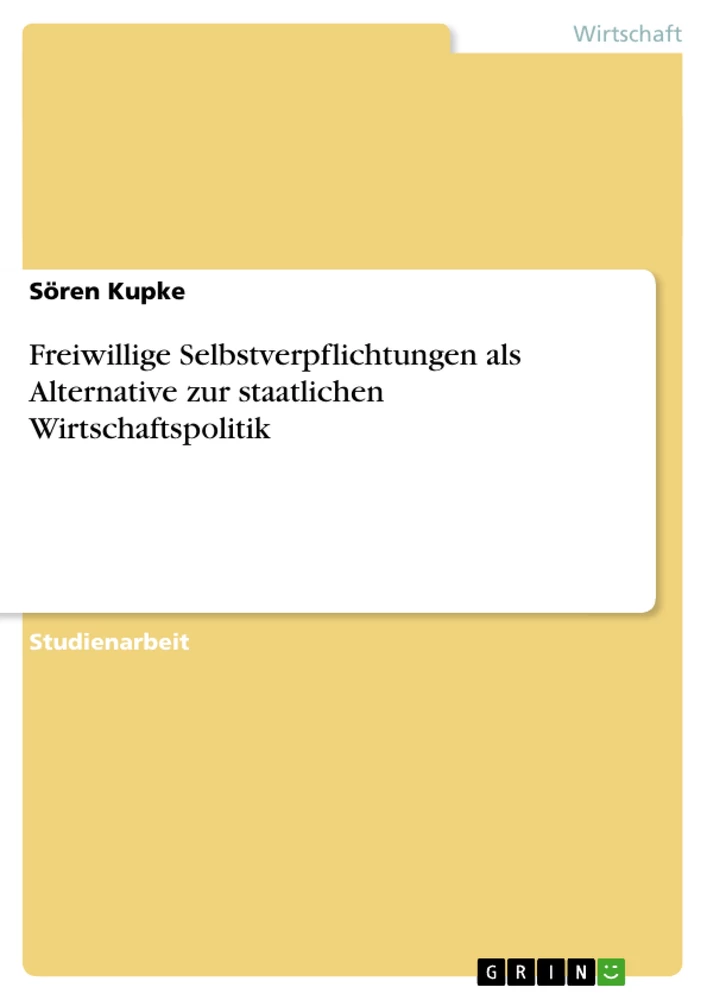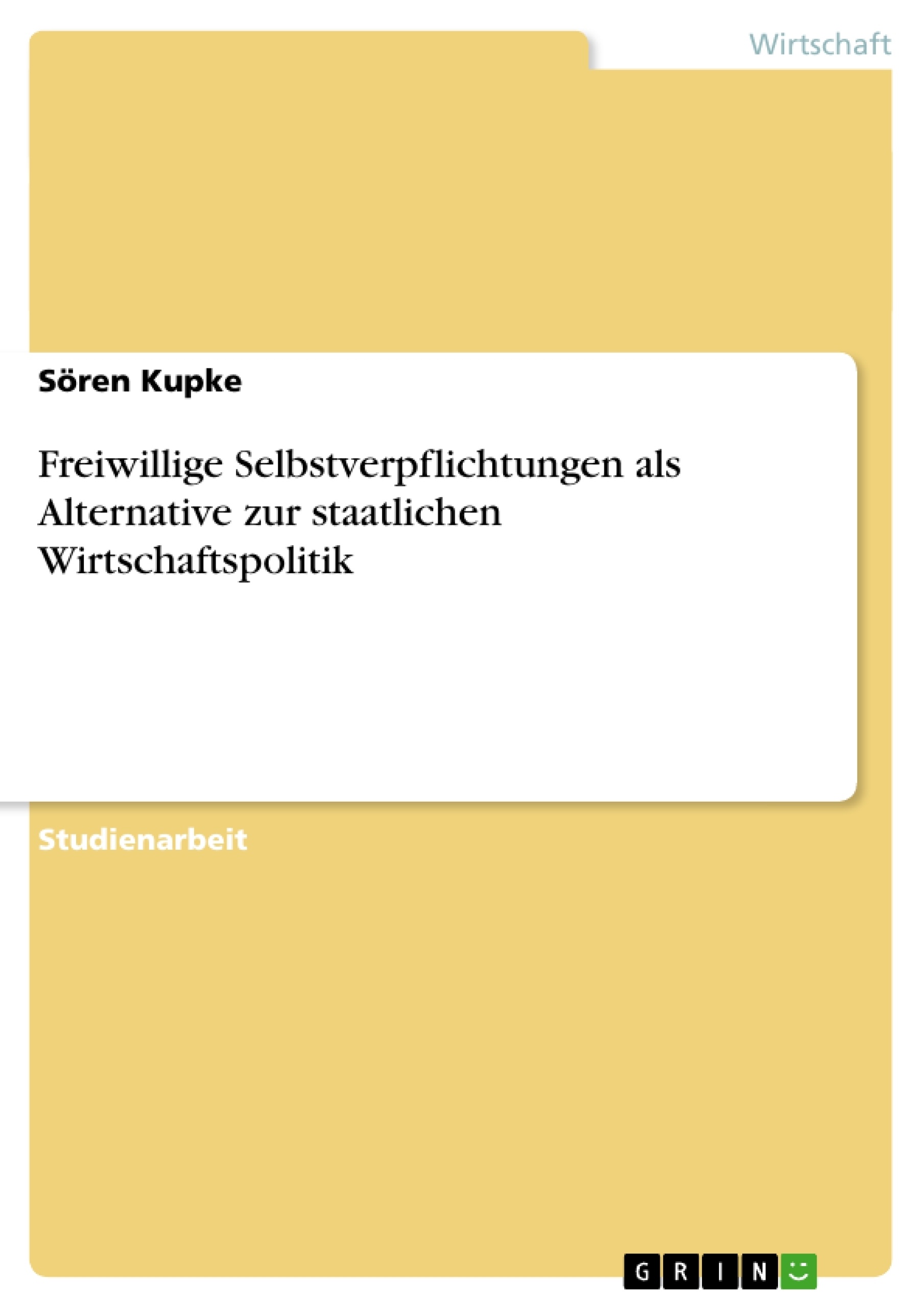Umweltpolitische Themen, wie Klimaschutz oder Abfallentsorgung, haben seit den 70er Jahren in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Im Zuge dieses Trends hat sich auch ein neues Instrument zur Lösung von umweltpolitischen Herausforderungen zunehmend etabliert: Freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen (FSVE). Allein zwischen 1980 und 1997 sind in Deutschland 93 FSVE ausgehandelt worden, in den Niederlanden sogar 107 und in der Europäischen Union (EU) 322. Im Vergleich zu Japan erscheinen diese Zahlen jedoch noch auf niedrigem Niveau zu liegen, dort werden jährlich ca. 2.000 FSVE abgeschlossen. Wie ein Überblick über die wichtigsten Erklärungen im Anhang darstellt, werden FSVE in Deutschland fast ausschließlich im Umweltschutz abgeschlossen. Es ist jedoch zu erwähnen, dass FSVE nicht nur in der Umweltpolitik eine Rolle spielen, sondern sich auch in anderen Politikbereichen erfolgreich etabliert haben. So gibt es im Bereich der Medien eine Werbedisziplin und eine Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) der Filmwirtschaft. Auch im Bereich des Außenhandels gibt häufig Selbstverpflichtungen in Form von freiwilligen Handelsbeschränkungen auf Exporte oder Importe. Da FSVE jedoch überwiegend im Bereich der Umweltpolitik eingesetzt werden5, fokussiert diese Arbeit ebenfalls auf diesen Bereich. Der Einsatz von FSVE als praktische Umsetzung des Kooperationsprinzips in der Umweltpolitik wird in wissenschaftlichen Publikationen thematisiert und kritisch diskutiert. Der Kern der Diskussion bewegt sich um die Fragestellungen, ob FSVE als Instrument zu einer effizienten umweltpolitischen Steuerung geeignet sind und ob sie systemkonform sind. Zielsetzung dieser Arbeit ist die Definition des Begriffes FSVE und die Einordnung in das umweltpolitische Instrumentarium des Staates. Des Weiteren sollen Motive dargestellt werden, die entweder Staat oder Wirtschaft mit dem Abschluss von FSVE verfolgen. Es schließt sich eine Diskussion der rechtlichen und demokratischen Implikationen von FSVE an. Ausführlich soll die Stellung von FSVE in der Volkswirtschaftlichen Theorie betrachtet werden, an die sich eine Bewertung von FSVE anfügt.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Definition und Einordnung
- C. Motive
- D. Juristische Bewertung
- I. Wettbewerbsrechtliche Aspekte
- II. Verfassungsrechtliche Aspekte
- E. Ordnungspolitische Einordnung
- F. Volkswirtschaftliche Bewertung
- G. Fazit
- I. Effektivität
- II. Effizienz
- III. Systemkonformität
- IV. Beherrschbarkeit
- H. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Frage, ob freiwillige Selbstverpflichtungen eine Alternative zur staatlichen Wirtschaftspolitik darstellen können. Sie analysiert die Definition, die Motive und die rechtliche Bewertung von Selbstverpflichtungen. Darüber hinaus werden die ordnungspolitische Einordnung und die volkswirtschaftliche Bewertung dieser Instrumente beleuchtet.
- Definition und Einordnung von Selbstverpflichtungen
- Motive für die Einführung von Selbstverpflichtungen
- Juristische Bewertung von Selbstverpflichtungen
- Ordnungspolitische Einordnung von Selbstverpflichtungen
- Volkswirtschaftliche Bewertung von Selbstverpflichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
- A. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der freiwilligen Selbstverpflichtungen ein und erläutert die Relevanz dieser Thematik im Kontext der Wirtschaftspolitik.
- B. Definition und Einordnung: In diesem Kapitel wird der Begriff "freiwillige Selbstverpflichtung" definiert und in verschiedene Typen von Selbstverpflichtungen eingeordnet.
- C. Motive: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Motive, die Unternehmen und Organisationen zur Einführung von Selbstverpflichtungen bewegen.
- D. Juristische Bewertung: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für Selbstverpflichtungen, insbesondere die wettbewerbsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte.
- E. Ordnungspolitische Einordnung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einordnung von Selbstverpflichtungen in die ordnungspolitische Diskussion.
- F. Volkswirtschaftliche Bewertung: Dieses Kapitel evaluiert die volkswirtschaftlichen Folgen von Selbstverpflichtungen unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Schlüsselwörter
Freiwillige Selbstverpflichtungen, Wirtschaftspolitik, Wettbewerbsrecht, Verfassungsrecht, Ordnungspolitik, Volkswirtschaft, Effektivität, Effizienz, Systemkonformität, Beherrschbarkeit.
- Quote paper
- Dipl.-Kfm. Sören Kupke (Author), 2003, Freiwillige Selbstverpflichtungen als Alternative zur staatlichen Wirtschaftspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21478