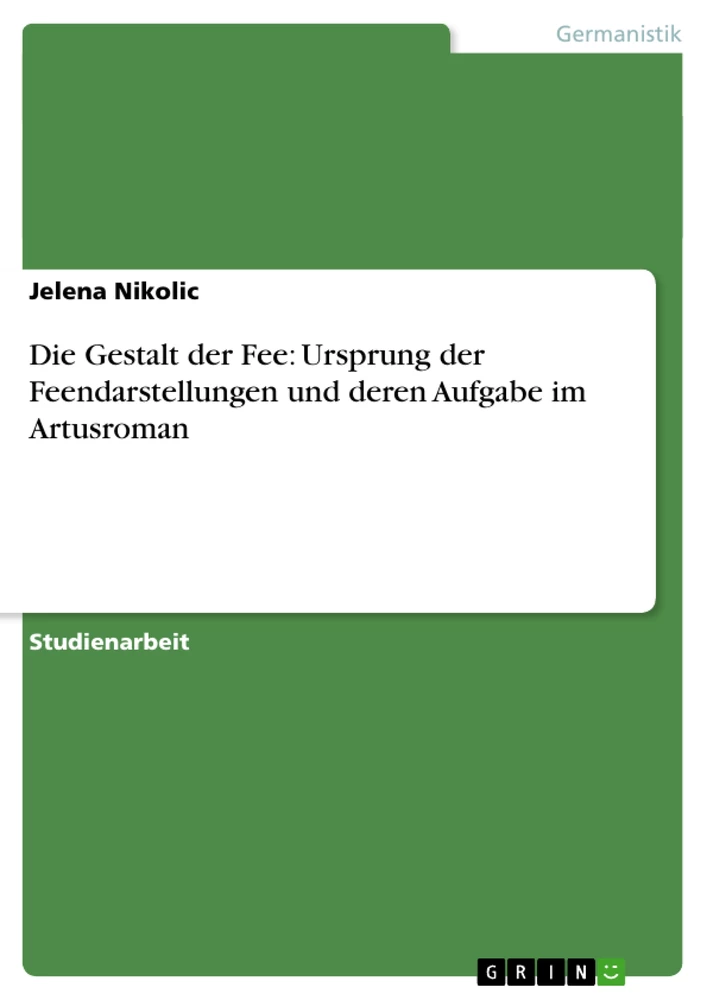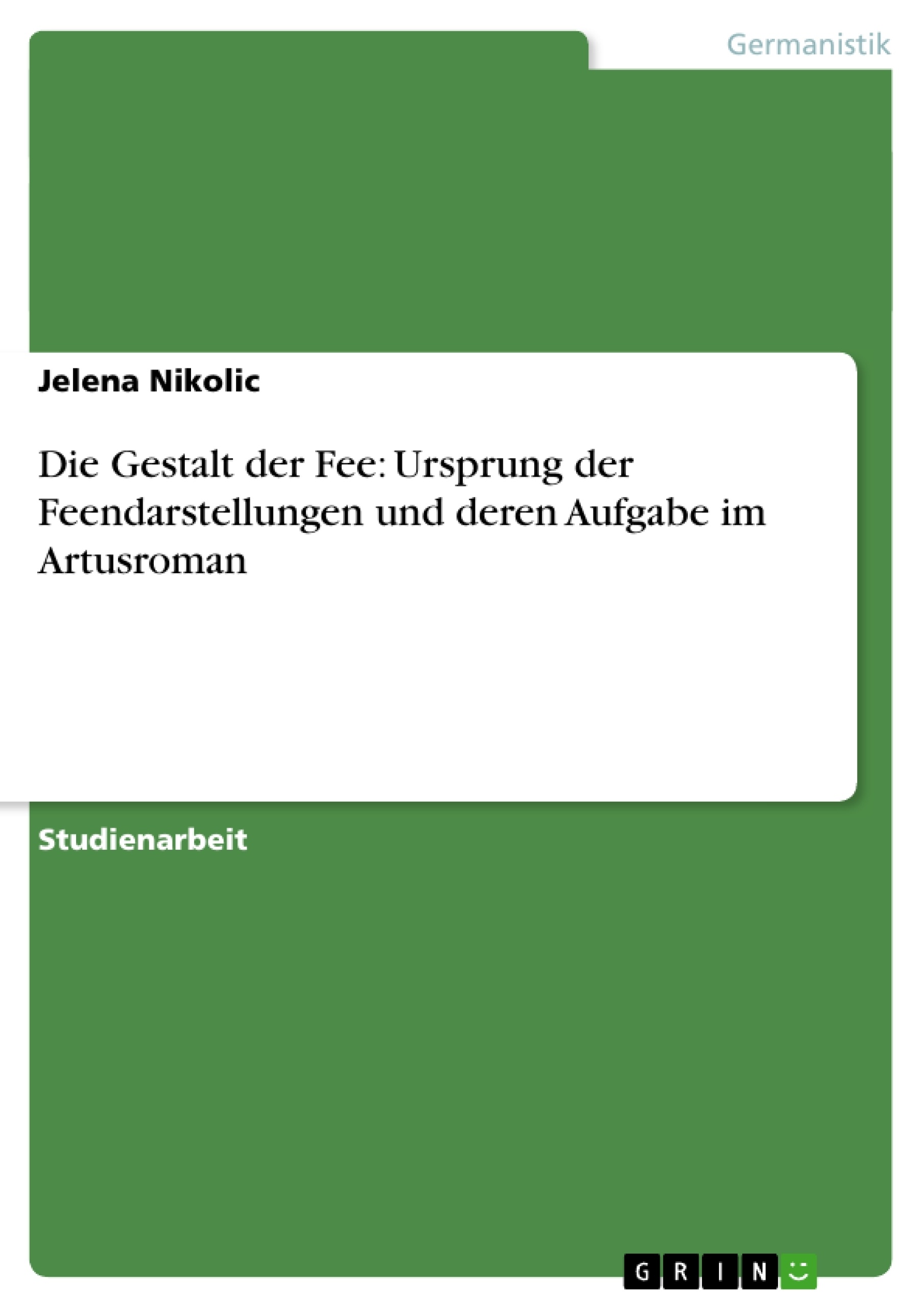Die Forschungsliteratur zu der Gattung Artusroman nimmt an, dass dieser ihre Hauptquelle in
Britannien (England, Irland, Bretagne) hat. Weiter zurück liegt die Annahme, die mündlichen
keltischen Erzählungen, d.h. keltische Mythologie sei die Hauptquelle der arthurischen
Tradition.
Viel ist über König Artus und seine Tafelrunde geschrieben worden. Auch von den deutschen
Gelehrten, aber nur wenige wussten, dass sie diese wunderbaren Sagen den Kelten zu
verdanken haben. Ihre Mythen haben die europäische Literatur bereichert. Keltische Literatur
wird kaum von einer anderen übertroffen, da sie sehr reich an Einbildungskraft und
glänzender Schilderung ist. Genau wegen dieser Vielfältigkeit hat man gerne die Motive aus
den Mythen übernommen und sie der damaligen mittelalterlichen Kultur angepasst.
Die Artusepik geht zurück auf die Kämpfe des keltischen Königs Artus gegen die
Angelsachsen im 6. Jahrhundert und ist durch keltische Mythologie geprägt.
Die märchenhafte Gestaltung des Artusromans ist mit seiner Stoffquelle eng verbunden. Die
Schauplätze (Schlösser, Wälder, Quellen, Brunnen) und das Auftreten der Märchen- und
Fabelwesen (sprechenden Tieren, Drachen, Riesen und Zwergen) bilden den Hintergrund für
das Märchenhafte. Diese Tradition, die in Irland, Wales und Cornwall entstanden ist, wurde
von den Gechichtenerzählern an die Bretonen weitergegeben. Diese widerum gaben sie an
Franzosen und Anglonormanen weiter.
Sowohl die Topographie des Artusromans, als auch die verschiedene Gestalten wurden als
Motive aus der keltischen Mythologie übernommen. Zudem nimmt man an, dass die
arthurischen Feen der keltischen Mythologie entsprungen sind, da man eine enge Beziehung
zwischen ihnen und den keltischen Göttinnen ausmachen kann.
Diese Arbeit beschäftigt sich dementsprechend mit der Motivik der Feen im
mittelhochdeutschen Artusroman und welche Funktion sie in der Handlung des Romans zu
erfüllen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Herkunft der Feenfiguren in der Artusliteratur
- 2.1 Keltische Mythen
- 2.2 Fee Morgane
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Feen im mittelhochdeutschen Artusroman und deren Funktion innerhalb der Handlung. Die Arbeit beleuchtet die Ursprünge der Feenfiguren in der keltischen Mythologie und analysiert deren Rolle im Kontext der Artus-Epik.
- Ursprung der Feenfiguren in der keltischen Mythologie
- Beziehung zwischen keltischen Göttinnen und Feen im Artusroman
- Die Funktion der Feen in der Handlung des Artusromans
- Charakterisierung der Fee Morgane und ihre Parallelen zu keltischen Göttinnen
- Die Anderwelt und ihre Verbindung zur Feenwelt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Motivik der Feen im mittelhochdeutschen Artusroman und deren Funktion in der Handlung. Sie verortet den Artusroman in seiner keltischen Traditionslinie und hebt die Bedeutung keltischer Mythen als Inspirationsquelle hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die Übernahme und Adaption keltischer Motive in die mittelalterliche Kultur und die enge Verbindung zwischen arthurischen Feen und keltischen Göttinnen. Die Vielfältigkeit der keltischen Mythologie und deren Einfluss auf die märchenhafte Gestaltung des Artusromans werden betont.
2. Herkunft der Feenfiguren in der Artusliteratur: Dieses Kapitel untersucht die etymologische Herkunft des Wortes "Fee" und verortet die Ursprünge der Feenfiguren in der keltischen Mythologie. Es wird die These vertreten, dass Feen frühere keltische Gottheiten darstellen, die zwar nicht unsterblich sind, aber langsamer altern und in einer von den Menschen abgetrennten, aber dennoch verbundenen Welt – der Anderwelt – leben. Die Feen werden als höhere Wesen beschrieben, die jedoch im Gegensatz zu den fernen Göttern, sich unter die Menschen mischen, oftmals als heiter, schön und glückbringend dargestellt werden. Der Abschnitt über Fee Morgane vertieft die Thematik, indem er sie als die bekannteste Fee, Schwester Artus' und Herrscherin über Avalon darstellt und Parallelen zu keltischen Göttinnen wie Mórrígan und Modron aufzeigt, welche als kriegerische und zugleich lebensgebende Göttinnen beschrieben werden, um die Vielschichtigkeit der Fee Morgane zu unterstreichen und die komplexen mythologischen Ursprünge zu beleuchten. Der Bezug zu Hartmann von Aues Erec und der Figur Fâmurgân wird hergestellt, um die Übernahme und Transformation der keltischen Göttinnenfiguren in die literarische Figur der Fee Morgane zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Artusroman, Fee, keltische Mythologie, Fee Morgane, Mórrígan, Modron, Anderwelt, Avalon, mittelhochdeutsch, Zauberkräfte, Göttinnen, Mythen, Literatur, mittelalterliche Kultur.
Häufig gestellte Fragen zum mittelhochdeutschen Artusroman und seinen Feenfiguren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Feen im mittelhochdeutschen Artusroman, ihre Funktion innerhalb der Handlung und ihre Ursprünge in der keltischen Mythologie. Sie analysiert die Rolle der Feen im Kontext der Artus-Epik und die Beziehung zwischen keltischen Göttinnen und den Feenfiguren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themenschwerpunkte: den Ursprung der Feenfiguren in der keltischen Mythologie, die Beziehung zwischen keltischen Göttinnen und Feen im Artusroman, die Funktion der Feen in der Handlung, die Charakterisierung der Fee Morgane und ihre Parallelen zu keltischen Göttinnen sowie die Verbindung zwischen Anderwelt und Feenwelt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, welche die Forschungsfrage und den Kontext der Arbeit erläutert. Kapitel 2 befasst sich mit der Herkunft der Feenfiguren in der Artusliteratur, untersucht die etymologische Herkunft des Wortes "Fee" und verortet die Ursprünge in der keltischen Mythologie. Es analysiert insbesondere die Figur der Fee Morgane und ihre Parallelen zu keltischen Göttinnen wie Mórrígan und Modron. Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in die jeweiligen Inhalte.
Welche Rolle spielt die keltische Mythologie?
Die keltische Mythologie bildet die Grundlage für das Verständnis der Feenfiguren im Artusroman. Die Arbeit argumentiert, dass die Feen frühere keltische Gottheiten darstellen, die in einer von den Menschen abgetrennten, aber verbundenen Welt – der Anderwelt – leben. Die Übernahme und Adaption keltischer Motive in die mittelalterliche Kultur und die enge Verbindung zwischen arthurischen Feen und keltischen Göttinnen werden hervorgehoben.
Welche Bedeutung hat die Figur der Fee Morgane?
Fee Morgane wird als die bekannteste Fee, Schwester Artus' und Herrscherin über Avalon dargestellt. Die Arbeit untersucht Parallelen zu keltischen Göttinnen wie Mórrígan und Modron, um die Vielschichtigkeit der Figur und ihre komplexen mythologischen Ursprünge zu beleuchten. Der Bezug zu Hartmann von Aues Erec und der Figur Fâmurgân verdeutlicht die Übernahme und Transformation der keltischen Göttinnenfiguren in die literarische Figur der Fee Morgane.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter, die die Arbeit treffend beschreiben, sind: Artusroman, Fee, keltische Mythologie, Fee Morgane, Mórrígan, Modron, Anderwelt, Avalon, mittelhochdeutsch, Zauberkräfte, Göttinnen, Mythen, Literatur und mittelalterliche Kultur.
Wo finde ich mehr Informationen?
Der vollständige Text dieser Arbeit enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis, umfassende Kapitelzusammenfassungen und eine ausführliche Analyse der dargestellten Themen.
- Quote paper
- Jelena Nikolic (Author), 2011, Die Gestalt der Fee: Ursprung der Feendarstellungen und deren Aufgabe im Artusroman, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214649