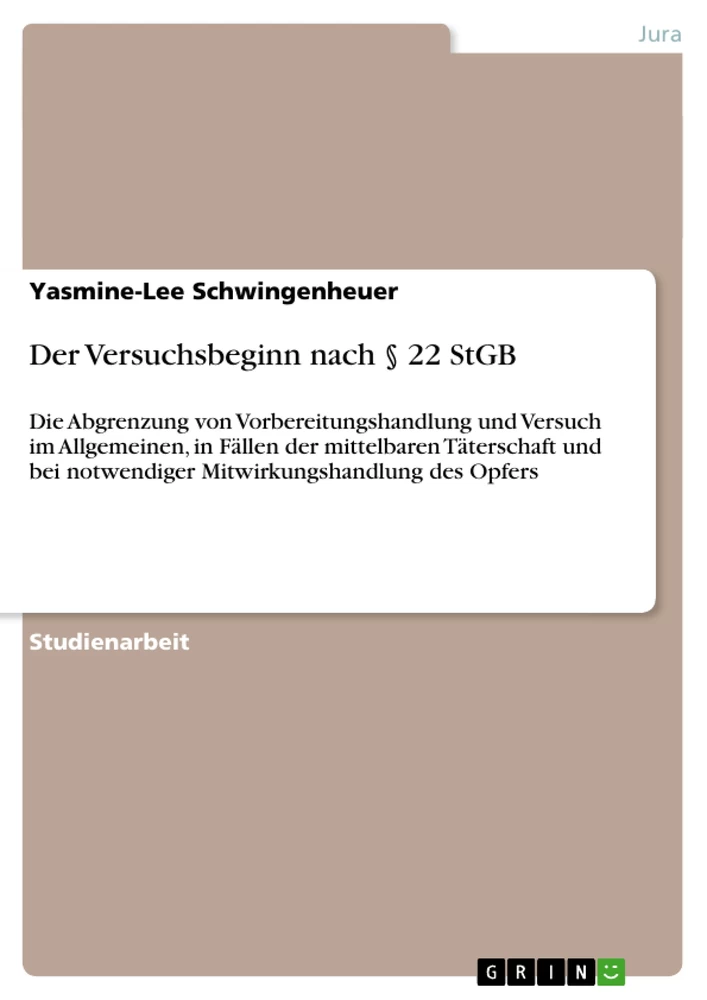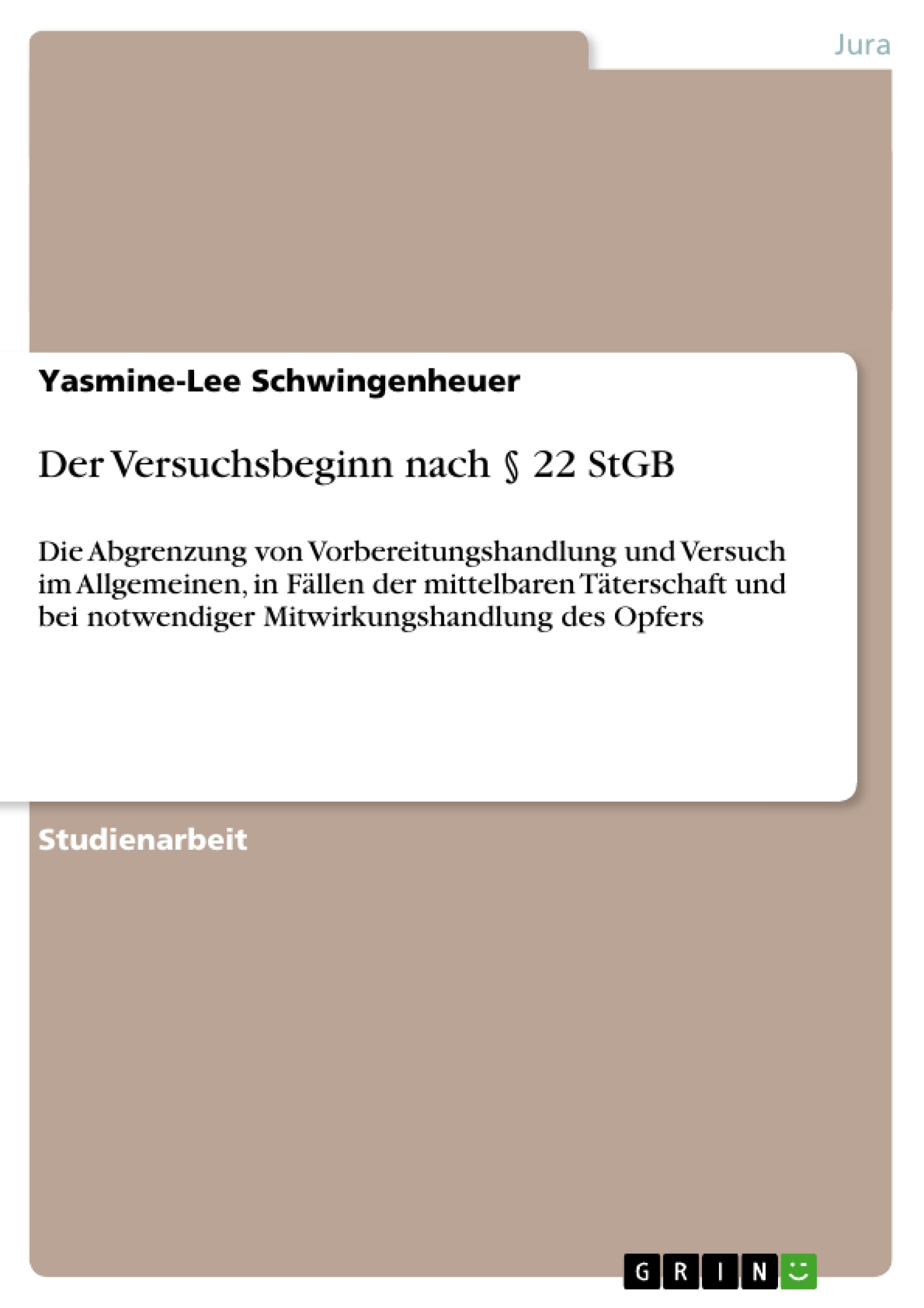Straftaten beginnen mit einem Gedanken und enden in der Regel mit einem Erfolg. Zwischen dem Gedanken und dem Erfolgseintritt liegt jedoch ein mehr oder weniger langer Weg. Er führt von der Entschlussfassung über die Planung und die Vorbereitung, den Anfang der Tatausführung, den Abschluss der Tatbestandshandlung und den Eintritt des Erfolgs bis hin zur Beendigung der Tat. Grundgedanke der Versuchsstrafbarkeit ist demzufolge, dass jede vorsätzliche Straftat verschiedene Stufen der Willensverwirklichung durchläuft.
Nicht in jedem dieser Stadien ist das auf die Straftat gerichtete Handeln jedoch gleichermaßen strafwürdig. Die bloße Entschlussfassung eines Einzelnen wird nicht vom Strafrecht erfasst. Ebenso bleiben Vorbereitungshandlungen eines Alleintäters grundsätzlich straflos, weil zu diesem Zeitpunkt die Ausführung der Tat noch von zu vielen Unwägbarkeiten abhängt; lediglich bei bestimmten Delikten werden auch diese Handlungen aufgrund ihrer besonderen Gefährlichkeit unter Strafe gestellt. Der Versuch indessen, welcher der Vorbereitungsphase folgt, ist bei Verbrechen stets, bei Vergehen nur dann strafbar, wenn dies ausdrücklich gesetzlich bestimmt ist (§ 23 I StGB).
Gilt es folglich die Strafbarkeit bestimmter Handlungen darzulegen, ist die Abgrenzung zwischen Vorbereitungshandlung und Versuch von maßgeblicher Bedeutung. Erst das Überschreiten der Versuchsschwelle löst – ausschließlich der erwähnten Ausnahmefälle - die Strafbarkeit wegen Vorsatztat aus. Es stellt sich damit aber die Frage, wo sich diese Schwelle zum Versuch befindet. Welche Handlungen sind noch dem Stadium der Vorbereitung und welche bereits dem des Versuchs zuzuordnen?
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Allgemeine Formeln zur Abgrenzung von Vorbereitung und Versuch
- I. Traditionelle Theorien
- 1. Die formell-objektive Theorie
- 2. Die materiell-objektiven Theorien
- 3. Die subjektiven Theorien
- 4. Die gemischt subjektiv-objektiven Theorien
- II. Aktuelle Theorien
- 1. Teilverwirklichung des Tatbestands als Versuch
- 2. Versuchsbeginn im Vorfeld der Tatbestandsverwirklichung - das unmittelbare Ansetzen
- a. Die Teil- bzw. Zwischenakttheorie
- b. Die Gefährdungstheorie
- c. Der Kombinationsansatz
- d. Die Sphärentheorie
- III. Resümee
- I. Traditionelle Theorien
- C. Unmittelbares Ansetzen bei der mittelbaren Täterschaft
- I. Einvernehmen bzgl. des spätesten Zeitpunkts des Versuchsbeginns
- II. Uneinigkeit bzgl. des Versuchsbeginns vor diesem Zeitpunkt
- 1. Die Einzellösung
- 2. Die Gesamtlösung
- 3. Die Gefährdungstheorie
- 4. Die Rechtsprechung des BGH
- III. Resümee
- D. Unmittelbares Ansetzen bei abgeschlossenem Täterhandeln in Fällen geplanter Selbstschädigung des Opfers
- I. Die Begehungsform bei den Selbstschädigungsfällen
- II. Der Versuchsbeginn in den Selbstschädigungsfällen
- 1. Ansatzformel
- 2. Alternativformel
- 3. Die Rechtsprechung: Zeitnahe Gefährdung nach dem Tatplan des Täters
- III. Resümee
- E. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Beginn des Versuchs nach § 22 StGB. Ziel ist es, die Abgrenzung zwischen Vorbereitungshandlung und Versuch im Allgemeinen, bei mittelbarer Täterschaft und bei notwendiger Mitwirkungshandlung des Opfers zu klären. Die Arbeit analysiert verschiedene Theorien und die Rechtsprechung des BGH.
- Abgrenzung von Versuch und Vorbereitungshandlung
- Der Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft
- Der Versuchsbeginn bei Selbstschädigungsfällen
- Analyse verschiedener juristischer Theorien
- Auswertung der Rechtsprechung des BGH
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung dient der kurzen Einführung in das Thema der Seminararbeit und benennt die Fragestellung nach dem Beginn des Versuchs nach § 22 StGB und dessen Abgrenzung von der bloßen Vorbereitungshandlung. Die Arbeit skizziert die zentralen Probleme, die im Laufe der Untersuchung analysiert werden sollen, und legt den Fokus auf die unterschiedlichen Konstellationen der mittelbaren Täterschaft und den Fällen der Selbstgefährdung des Opfers.
B. Allgemeine Formeln zur Abgrenzung von Vorbereitung und Versuch: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Theorien zur Abgrenzung von Vorbereitung und Versuch. Es werden sowohl traditionelle Ansätze wie die formell-objektive, materiell-objektive und subjektive Theorie vorgestellt und kritisch beleuchtet, als auch aktuelle Theorien wie die Teilverwirklichungstheorie und der Ansatz des unmittelbaren Ansetzens mit seinen verschiedenen Ausprägungen (Teil- bzw. Zwischenakttheorie, Gefährdungstheorie, Kombinationsansatz, Sphärentheorie) diskutiert. Die Kapitel analysiert die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze und bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Rechtsdogmatik.
C. Unmittelbares Ansetzen bei der mittelbaren Täterschaft: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Problematik des unmittelbaren Ansetzens im Kontext der mittelbaren Täterschaft. Es werden die verschiedenen Lösungsansätze, darunter die Einzellösung (mit ihren verschiedenen Ausprägungen: strenge Einzellösung, modifizierte Einzeltheorie, nach Gefährdungsaspekten differenzierende Einzellösung und Differenzierung nach Gut- bzw. Bösgläubigkeit des Tatmittlers) und die Gesamtlösung (mit ihren verschiedenen Ausprägungen: strenge Gesamtlösung und Gesamtlösung im weitesten Sinne), im Detail analysiert und miteinander verglichen. Das Kapitel analysiert kritisch die Rechtsprechung des BGH und bewertet die jeweilige Tragfähigkeit der einzelnen Ansätze.
D. Unmittelbares Ansetzen bei abgeschlossenem Täterhandeln in Fällen geplanter Selbstschädigung des Opfers: Dieses Kapitel behandelt die spezielle Situation, in der der Täter einen anderen dazu bringt, sich selbst zu schädigen. Es untersucht verschiedene Lösungsansätze zur Bestimmung des Versuchsbeginns in solchen Fällen, insbesondere die Ansatzformel und die Alternativformel, und bezieht dabei die einschlägige Rechtsprechung mit ein. Die zentrale Fragestellung ist, wann im Kontext von Selbstgefährdung des Opfers von einem unmittelbaren Ansetzen gesprochen werden kann und welche Kriterien hierfür maßgeblich sind. Es wird dabei auch auf die Problematik der zeitnahen Gefährdung nach dem Tatplan des Täters eingegangen.
Schlüsselwörter
§ 22 StGB, Versuchsbeginn, Vorbereitungshandlung, mittelbare Täterschaft, Selbstgefährdung, unmittelbares Ansetzen, Ansatztheorien, Gefährdungstheorie, Rechtsprechung BGH, Tatbestandsverwirklichung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Beginn des Versuchs nach § 22 StGB
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Beginn des Versuchs nach § 22 StGB und die Abgrenzung zur bloßen Vorbereitungshandlung. Der Fokus liegt dabei auf der mittelbaren Täterschaft und Fällen, in denen das Opfer sich selbst schädigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien zur Abgrenzung von Versuch und Vorbereitung, den Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft und bei Selbstschädigung des Opfers, sowie die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH).
Welche Theorien zur Abgrenzung von Versuch und Vorbereitung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert sowohl traditionelle Theorien (formell-objektive, materiell-objektive, subjektive, gemischt subjektiv-objektive) als auch aktuelle Theorien (Teilverwirklichung des Tatbestands, unmittelbares Ansetzen mit Untertheorien wie Teil-/Zwischenakttheorie, Gefährdungstheorie, Kombinationsansatz und Sphärentheorie).
Wie wird der Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft behandelt?
Das Kapitel zur mittelbaren Täterschaft diskutiert verschiedene Lösungsansätze wie die Einzellösung (mit ihren verschiedenen Ausprägungen) und die Gesamtlösung (ebenfalls mit verschiedenen Ausprägungen). Die Rechtsprechung des BGH wird kritisch analysiert.
Wie wird der Versuchsbeginn bei Selbstschädigung des Opfers behandelt?
Für Fälle geplanter Selbstschädigung des Opfers werden die Ansatzformel und die Alternativformel untersucht. Die Arbeit berücksichtigt die Rechtsprechung, insbesondere die Frage der zeitnahen Gefährdung nach dem Tatplan des Täters.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel Einleitung, Allgemeine Formeln zur Abgrenzung von Vorbereitung und Versuch, Unmittelbares Ansetzen bei der mittelbaren Täterschaft, Unmittelbares Ansetzen bei abgeschlossenem Täterhandeln in Fällen geplanter Selbstschädigung des Opfers, und Fazit. Jedes Kapitel beinhaltet ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: § 22 StGB, Versuchsbeginn, Vorbereitungshandlung, mittelbare Täterschaft, Selbstgefährdung, unmittelbares Ansetzen, Ansatztheorien, Gefährdungstheorie, Rechtsprechung BGH, Tatbestandsverwirklichung.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Das Ziel ist die Klärung der Abgrenzung zwischen Vorbereitungshandlung und Versuch im Allgemeinen, bei mittelbarer Täterschaft und bei notwendiger Mitwirkungshandlung des Opfers durch Analyse verschiedener Theorien und der Rechtsprechung des BGH.
- Quote paper
- Yasmine-Lee Schwingenheuer (Author), 2003, Der Versuchsbeginn nach § 22 StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21452