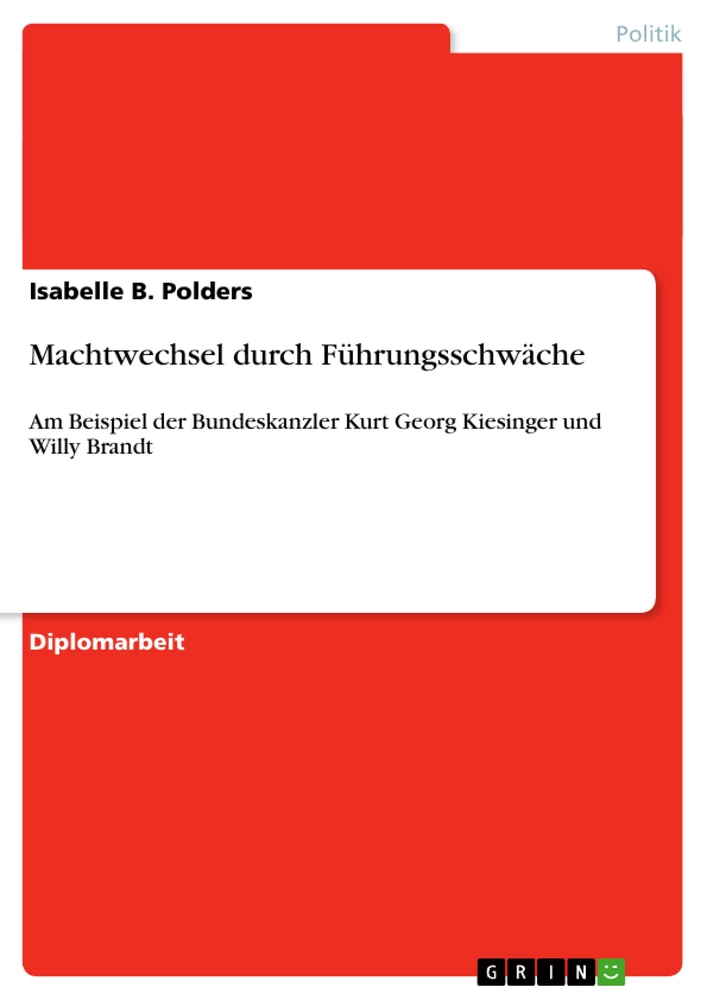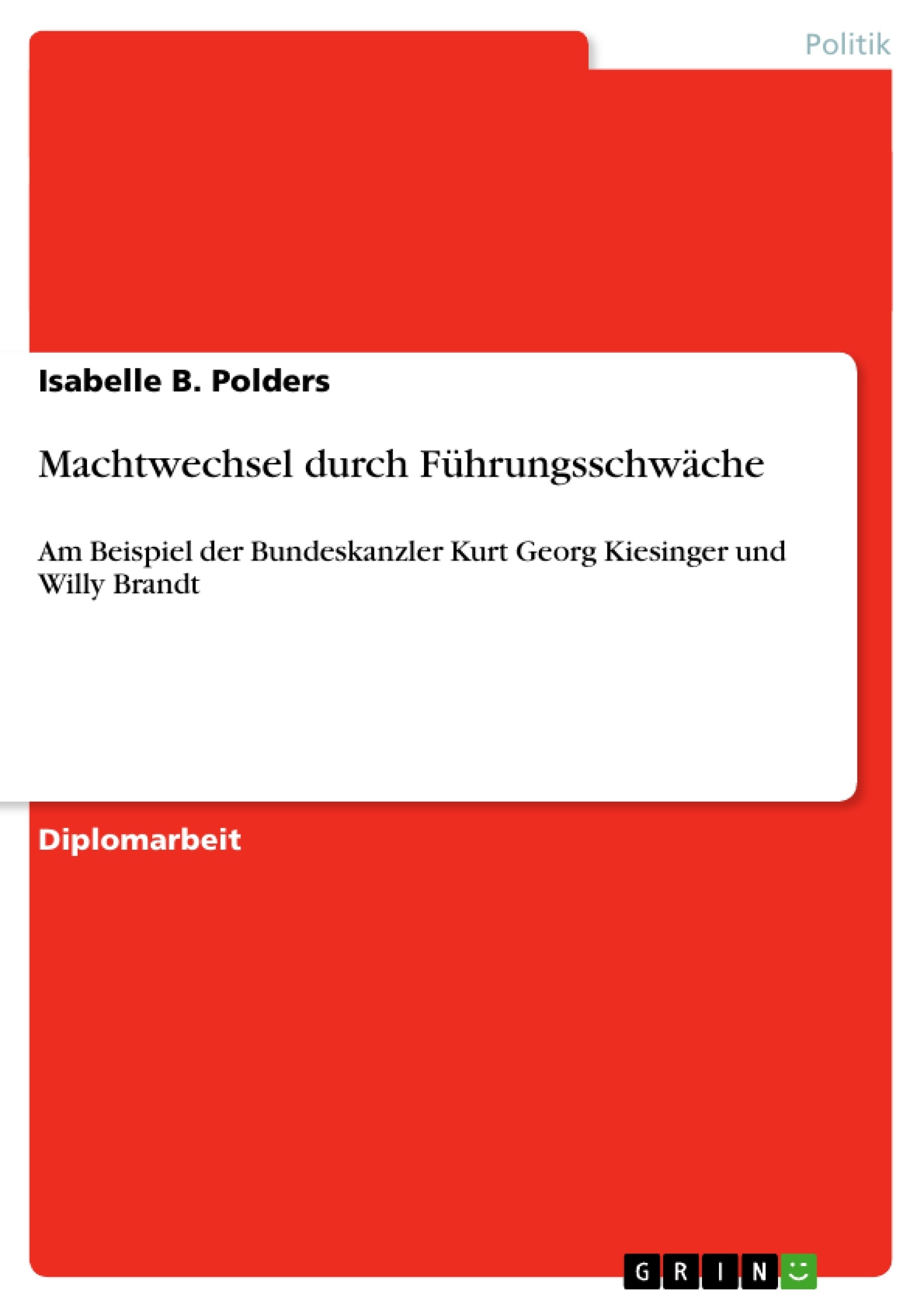Kaum ein Ereignis in der deutschen Geschichte vereint mehr Elemente eines großen „Dramas“ in sich als die Abwahl oder der Rücktritt eines Bundeskanzlers: Der einstige Held wird gestürzt, das Böse und das Gute kämpfen gegeneinander, und die gutwilligen Freunde müssen ohnmächtig zusehen, wie das Schicksal seinen Lauf nimmt und den Helden mit sich reißt.
In der vorliegenden Arbeit geht es um zwei solche „Helden“: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt. Der Christdemokrat Kiesinger war ein brillanter Politiker, zehn Jahre lang außenpolitischer Sprecher der CDU im Bundestag, ein erfolgreicher Redner mit tiefsinnigem Tonfall – er stürzte 1969 über die Große Koalition. Ihm folgte Willy Brandt, Sozialdemokrat, Friedensnobelpreisträger, der charismatische Vorkämpfer der deutschen Ost- und Friedenspolitik – er stürzte 1974 über den DDR-Agenten Guillaume. Kiesinger wurde abgewählt, Brandt trat zurück.
Die folgende Analyse untersucht die Formen und Merkmale der Machtwechsel von Kurt Georg Kiesinger zu Willy Brandt (1969) und von Willy Brandt zu Helmut Schmidt (1974) im Kontext von Kanzlerdemokratie, Koalitionsdemokratie, Parteiendemokratie und Mediendemokratie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Untersuchungsrahmen
- Machtwechsel: Kanzlertausch vs. Kanzlerwechsel
- Kanzlerschaft und Führungsverhalten
- Rahmenbedingung: Organisationsprinzipien des Regierens
- Untersuchungsmaterial
- Stand der Forschung und Verortung der eigenen Fragestellung
- Methodisches Vorgehen
- Analyseraster
- Strukturmerkmale des Regierens
- Der Kanzler in der Kanzlerdemokratie: Führungsfigur oder Vermittler?
- Der Kanzler in der Parteiendemokratie: Regierungschef oder Parteivorsitzender?
- Der Kanzler in der Koalitionsdemokratie: Bestimmer oder Bestimmter?
- Der Kanzler in der Mediendemokratie: Stellungssetzer oder Stellungsnehmer?
- Policy-Bilanz
- Strukturmerkmale des Regierens
- Bundeskanzler Kiesinger
- Kurt Georg Kiesinger – ein Mann mit Vergangenheit
- Kiesinger in der Kanzlerdemokratie: Vermittler statt Führungsfigur
- Kiesinger in der Parteiendemokratie: Regierungschef [und Parteivorsitzender]
- Kiesinger in der Koalitionsdemokratie: Bestimmter
- Kiesinger in der Mediendemokratie: Stellungsnehmer statt Stellungssetzer
- Policy-Bilanz der Kanzlerschaft Kiesingers
- Bundeskanzler Brandt
- Willy Brandt: Der Visionär
- Brandt in der Kanzlerdemokratie: Die Führungsfigur der SPD
- Brandt in der Parteiendemokratie: Regierungschef und Parteivorsitzender
- Brandt in der Koalitionsdemokratie: Bestimmer auf Zeit
- Brandt in der Mediendemokratie: Abstieg vom Stellungssetzer zum Stellungsnehmer
- Policy-Bilanz der Kanzlerschaft Brandts
- Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse
- Die Machtwechsel von 1969 und 1974
- Kiesinger und Brandt in der Kanzlerdemokratie: Führungsfigur vs. Vermittler
- Kiesinger und Brandt in der Parteiendemokratie: Regierungschef und Parteivorsitzender
- Kiesinger und Brandt in der Koalitionsdemokratie: Bestimmer auf Zeit vs. Bestimmter
- Kiesinger und Brandt in der Mediendemokratie: Stellungssetzer und Stellungsnehmer
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Machtwechsel der Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt im Kontext von Kanzler-, Parteien-, Koalitions- und Mediendemokratie. Ziel ist es, die Ursachen für den Machtverlust beider Kanzler zu analysieren und die Rolle von Führungsschwäche dabei zu beleuchten.
- Analyse der Machtwechsel von 1969 und 1974
- Bedeutung von Führungsverhalten in der Kanzlerschaft
- Einfluss von Koalitionsdynamiken auf den Machtwechsel
- Rolle der Medien im Kontext der Machtwechsel
- Konfliktmanagement als zentraler Aspekt von Kanzlerführung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Thematik der Machtwechsel von Bundeskanzler Kiesinger und Brandt als dramatische Ereignisse und kündigt die Untersuchung der Machtwechsel im Kontext verschiedener Strukturmerkmale des Regierens an. Der Fokus liegt auf der Analyse von Konflikten und der Rolle von Führungsschwäche als wesentliche Ursache für den Machtverlust beider Kanzler.
Untersuchungsrahmen: Dieses Kapitel definiert den Untersuchungsgegenstand, unterscheidet zwischen Kanzlertausch und -wechsel und analysiert die Bedeutung von Führungsverhalten im Kontext der Kanzlerschaft. Es beschreibt die relevanten Rahmenbedingungen des Regierens (Kanzler-, Parteien-, Koalitions- und Mediendemokratie) sowie das Untersuchungsmaterial und den Stand der Forschung. Das methodische Vorgehen wird ebenfalls erläutert.
Analyseraster: Dieses Kapitel stellt das methodische Vorgehen dar, mit dem die Machtwechsel der beiden Kanzler analysiert werden. Es definiert vier Strukturmerkmale des Regierens (Kanzler-, Parteien-, Koalitions- und Mediendemokratie) und zeigt auf, wie diese Merkmale den Handlungsspielraum der Kanzler beeinflussten und im Kontext von Konflikten analysiert werden.
Bundeskanzler Kiesinger: Dieses Kapitel analysiert die Kanzlerschaft Kiesingers anhand der vier Strukturmerkmale. Es beleuchtet seine Rolle als Vermittler in der Großen Koalition, seine Position als Regierungschef und Parteivorsitzender, seine Abhängigkeit innerhalb der Koalition und seine Rolle in der Medienlandschaft. Die Analyse der "Policy-Bilanz" rundet die Betrachtung ab.
Bundeskanzler Brandt: Analog zum Kapitel über Kiesinger, analysiert dieses Kapitel Brandts Kanzlerschaft durch die Linse der vier Strukturmerkmale. Es untersucht seine Rolle als charismatische Führungsfigur, seine Position als Regierungschef und Parteivorsitzender, seine Handlungsspielräume innerhalb der Koalition und seinen Umgang mit der Medienöffentlichkeit. Auch hier wird die "Policy-Bilanz" betrachtet.
Schlüsselwörter
Machtwechsel, Bundeskanzler, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Führungsschwäche, Kanzlerdemokratie, Parteiendemokratie, Koalitionsdemokratie, Mediendemokratie, Konfliktmanagement, Politikwissenschaft, Große Koalition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Machtwechsel von Kiesinger und Brandt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Machtwechsel der deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt. Der Fokus liegt auf den Ursachen ihres Machtverlusts, insbesondere der Rolle von Führungsschwäche im Kontext verschiedener demokratischer Strukturen.
Welche Aspekte der Machtwechsel werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Machtwechsel von 1969 und 1974 unter Berücksichtigung der Kanzlerdemokratie (die Rolle des Kanzlers als Führungspersönlichkeit), der Parteiendemokratie (die Beziehung zwischen Kanzleramt und Partei), der Koalitionsdemokratie (die Dynamik innerhalb der Regierungskoalition) und der Mediendemokratie (den Einfluss der Medien). Die Bedeutung von Führungsverhalten, Koalitionsdynamiken, Medien und Konfliktmanagement werden eingehend analysiert.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Analyse basiert auf einem strukturierten Analyseraster, das die vier genannten Strukturmerkmale des Regierens (Kanzler-, Parteien-, Koalitions- und Mediendemokratie) verwendet. Dieses Raster dient dazu, den Handlungsspielraum der Kanzler zu untersuchen und die Faktoren zu identifizieren, die zu ihren jeweiligen Machtverlusten beitrugen. Die Arbeit vergleicht die Kanzlerschaften von Kiesinger und Brandt systematisch anhand dieses Rasters.
Wie werden Kiesinger und Brandt im Detail analysiert?
Die Arbeit untersucht die Kanzlerschaften von Kiesinger und Brandt jeweils anhand der vier Strukturmerkmale. Es wird analysiert, wie beide Kanzler in den verschiedenen demokratischen Strukturen agierten (z.B. Kiesinger als Vermittler in der Großen Koalition, Brandt als charismatische Führungsfigur). Die "Policy-Bilanz" beider Kanzlerschaften wird ebenfalls bewertet.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die Ursachen der Machtwechsel von 1969 und 1974. Sie untersucht die Rolle von Führungsstärke oder -schwäche in der Kanzlerdemokratie und analysiert den Einfluss von Koalitionsdynamiken und Medien auf die Macht der Kanzler. Die Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse integriert die Erkenntnisse aus der Analyse der einzelnen Strukturmerkmale.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Machtwechsel, Bundeskanzler, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Führungsschwäche, Kanzlerdemokratie, Parteiendemokratie, Koalitionsdemokratie, Mediendemokratie, Konfliktmanagement, Politikwissenschaft, Große Koalition.
Was ist der Unterschied zwischen Kanzlertausch und Kanzlerwechsel?
Die Arbeit differenziert zwischen Kanzlertausch (wechsel innerhalb der gleichen Koalition) und Kanzlerwechsel (wechsel mit einer Regierungsbildung durch eine andere Koalition). Dieser Unterschied ist relevant für die Analyse der Machtverhältnisse und der Ursachen für den Machtverlust der Kanzler.
Welche Rolle spielen die Medien in der Analyse?
Die Rolle der Medien wird als ein wesentliches Strukturmerkmal des Regierens betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie die Medien die Macht der Kanzler beeinflusst haben und inwieweit sie zum Machtverlust von Kiesinger und Brandt beigetragen haben.
Welche Bedeutung hat das Konfliktmanagement in der Arbeit?
Konfliktmanagement wird als zentraler Aspekt von Kanzlerführung identifiziert und analysiert. Die Arbeit untersucht, wie gut Kiesinger und Brandt Konflikte innerhalb ihrer Koalitionen und mit anderen Akteuren bewältigten und ob dies einen Einfluss auf ihren Machtverlust hatte.
- Quote paper
- Isabelle B. Polders (Author), 2008, Machtwechsel durch Führungsschwäche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/214474